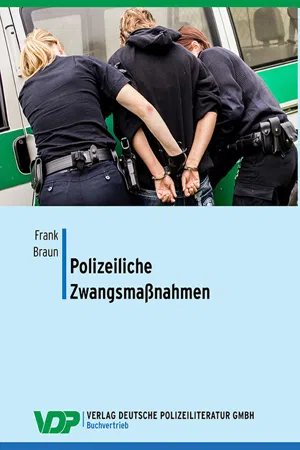![]()
Teil 1
Grundlagen
Die Prüfung polizeilicher Zwangsmaßnahmen muss in der Klausur sicher beherrscht werden. Hierfür bedarf es neben rechtlichen Grundkenntnissen vor allem Sicherheit in der Prüfung. Der nachfolgende Teil 1 fasst die unverzichtbaren dogmatischen Grundlagen des polizeilichen Zwangs zusammen. Teil 2 befasst sich – angelehnt an die Prüfungsreihenfolge in der Klausur – mit der Zwangsanwendung im gestreckten Verfahren; Teil 3 mit dem Sofortvollzug und der zwangsweisen Durchsetzung von Strafverfolgungsmaßnahmen. Der abschließende Teil 4 behandelt den polizeilichen Schusswaffengebrauch, der den Schwerpunkt der Ausbildung im abschließenden Fachmodul 4 bildet.1
A. Grundlagen
I. Allgemeines
Polizeilicher Zwang bringt das Recht zur Wirkung. Die Zwangsanwendung sorgt dafür, dass das Recht gegenüber demjenigen durchgesetzt wird, der es nicht beachtet. Insoweit haben polizeiliche Zwangsmaßnahmen zwei Funktionen: zum einen Beugefunktion; angesichts angedrohtem oder angewendetem Zwang gibt der Rechtsbrecher sein rechtswidriges Verhalten auf. Durch den Bruch des Widerstandes wird zum anderen ein rechtmäßiger Zustand hergestellt (Realisierungsfunktion).
Beispiel:
Gegen A ergeht ein Platzverweis. Diesem Platzverweis kommt A nicht nach. Die Polizei schafft ihn daraufhin nach erfolgloser Zwangsandrohung mit Gewalt von dem betreffenden Ort weg (unmittelbarer Zwang). Der entgegenstehende Wille des A wurde dadurch gebeugt (Beugefunktion). Zudem wurde durch die Zwangsanwendung ein rechtmäßiger Zustand hergestellt (Realisierungsfunktion).
Eine Straffunktion (d.h.: Sühne für begangenes Unrecht) hat die Zwangsanwendung nicht (wenn sie auch von den Betroffenen häufig „als Strafe“ empfunden wird). Durch Zwang sollen ausschließlich rechtskonforme Zustände hergestellt werden. Deswegen sind Zwangsmaßnahmen sofort einzustellen, wenn dieses Ziel erreicht wird.
Beispiel:
A wird von der Polizei gem. § 10 PolG NRW vorgeladen. In der Vorladung wird zugleich ein Zwangsgeld für den Fall des Nichterscheinens angedroht. A kommt zum festgesetzten Termin nicht. Daraufhin wird gegen ihn ein Zwangsgeld festgesetzt. Ein paar Tage später kommt A doch noch auf die Polizeidienststelle. Damit ist das Ziel der Vollstreckung erreicht, d.h. ein rechtmäßiger Zustand hergestellt. Nach § 53 Abs. 3 Satz 2 PolG NRW ist deshalb die Polizei gehindert, das Zwangsgeld beizutreiben. Hier kommt die Funktion der Zwangsmittel als Beugemittel zum Tragen. Gerade weil sie keine Strafe darstellen, ist ihre Anwendung sofort einzustellen, wenn sich die polizeiliche Verfügung erledigt hat (§ 51 Abs. 3 PolG NRW). A muss nicht bezahlen.2
Die Vollstreckung (= zwangsweise Durchsetzung) von Polizeiverfügungen unterscheidet sich von der Vollstreckung privatrechtlicher Ansprüche durch den Grundsatz der Selbsttitulierung und den Grundsatz der Selbstvollstreckung. Hierzu ein kurzer Blick auf die Vollstreckung privatrechtlicher Ansprüche: Μ zahlt seine Miete nicht. Vermieter V hat gegen Μ einen Anspruch, dass dieser seine Mietschulden bezahlt (vgl. § 535 Abs. 2 BGB). Um diesen Anspruch durchzusetzen, darf V nicht zur Selbsthilfe greifen, sondern muss Μ auf Zahlung der Miete verklagen. Das Gericht stellt dann durch Urteil fest, dass Μ die ausstehende Miete nebst Verzugszinsen zu entrichten hat (= „Titel“). Diesen Titel setzt dann, falls Μ immer noch nicht zahlt, ein Gerichtsvollzieher für den V mit Zwang (z.B. Pfändung und Verwertung) durch (= „Vollstreckung“). Bei der polizeilichen Vollstreckung läuft dies dagegen so: Durch den Erlass einer Polizeiverfügung (z.B.: „Öffnen Sie die Tür!“ bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt) kann sich die Polizei selbst einen Vollstreckungstitel schaffen, ohne dass zuvor ein gerichtliches Verfahren durchgeführt werden muss (Grundsatz der Selbsttitulierung). Zum anderen kann die Polizei ihre Polizeiverfügung durch eigene Vollzugsbeamte vollstrecken, ohne, wie der Vollstreckungsgläubiger im Privatrecht, spezielle Vollstreckungsorgane (den Gerichtsvollzieher) einschalten zu müssen (Grundsatz der Selbstvollstreckung). Kommt also der Pflichtige dem Befehl, die Tür zu öffnen, nicht nach, kann die Polizei diesen Befehl selbst vollstrecken, indem sie die Tür eintritt.
Aus der Befugnis, einen Verwaltungsakt zu erlassen, folgt noch nicht das Recht, diesen auch zu vollstrecken. Vollstreckungshandlungen bedürfen, ebenso wie die zu vollstreckende Verfügung selbst (z.B. „Öffnen Sie die Tür!“ = Begleitverfügung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 PolG NRW), einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage (Vorbehalt des Gesetzes), die in den §§ 50 ff. PolG NRW zu finden ist.
Hinweis: „Einsteiger“ sollten an dieser Stelle aufmerksam die §§ 50 ff. PolG NRW lesen. Auch bei der weiteren Lektüre des Beitrages sind stets die genannten Vorschriften nachzuschlagen und aufmerksam zu studieren. Nur so baut sich tieferes Verständnis auf. Zudem: Das Gesetz selbst gibt regelmäßig die zur Klausur notwendigen Informationen. Es gilt, stets „eng am Gesetzestext“ zu arbeiten.
II. Die Zwangsmittel
Die Zwangsmittel, die der Polizei zur Verfügung stehen, sind in § 51 Abs. 1 PolG NRW genannt. Das sind Ersatzvornahme, Zwangsgeld und unmittelbarer Zwang. Die Aufzählung ist abschließend. Die Ersatzzwangshaft (§ 54 PolG NRW) ist kein eigenes Zwangsmittel, sondern nur Verstärkung des Beugemittels Zwangsgeld.
1. Ersatzvornahme (§§ 51 Abs. 1 Nr. 1, 52 PolG NRW)
Die Ersatzvornahme besteht in der Ausführung einer dem Polizeipflichtigen obliegenden vertretbaren Handlung („Handlung, deren Vornahme durch einen anderen möglich ist“, § 52 Abs. 1 PolG NRW) durch die Polizei (= Selbstvornahme) oder einen Dritten („anderen“, § 52 Abs. 1 PolG NRW), z.B. einen Unternehmer (= Fremdvornahme).
Eine Handlung ist vertretbar, wenn sie durch einen anderen als den Störer vorgenommen werden kann und es der Polizei gleichgültig ist, ob der Pflichtige oder ein anderer diese Handlung vornimmt. Aus dem Wort „Handlung“ (§ 52 Abs. 1 PolG NRW) ergibt sich, dass ein Dulden oder Unterlassen als Polizeipflicht stets unvertretbar, d.h. „höchstpersönlich“, ist. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Handlung (Grundverfügung), die dem Störer aufgegeben wird und dann mittels Zwang durchgesetzt wird.
Beispiel:
Ein Baum aus dem Garten des A ist nach einem Sturm umgestürzt, liegt nun auf der vorbeiführenden Bundesstraße und gefährdet den Verkehr. Die Polizei gibt dem A auf, den Baum unverzüglich zu entfernen (Verfügung nach § 8 Abs. 1 PolG NRW). Das tut A nicht. Entfernt die Polizei nun den Baum selbst, liegt eine Ersatzvornahme vor. Die dem Polizeipflichtigen obliegende Handlung („Baum entfernen“) kann nicht nur von A, sondern auch von „anderen“ vorgenommen werden. Weil die Polizei den Baum selbst entfernt, handelt es sich um einen Fall der Selbstvornahme. Würde die Polizei (auf Kosten des A) ein Baumfällunternehmen beauftragen, läge eine Ersatzvornahme in Form der Fremdvornahme vor.
Ein weiterer – typischer – Fall einer Ersatzvornahme wäre das Abschleppen eines verkehrswidrig geparkten Fahrzeuges (als vertretbare Handlung wird durch die Grundverfügung aufgegeben: „Entfernen Sie das Fahrzeug von diesem Ort!“). Keine Fälle einer Ersatzvornahme mangels vertretbarer Handlung sind z.B. die Wegnahme einer Sache (Grundverfügung: „Geben Sie den Schlagring heraus!“ Diese Verfügung kann nur durch den Störer erfüllt werden und durch keinen anderen) oder das Wegtragen von Demonstranten nach Auflösung einer Sitzblockade (Grundverfügung: „Gehen Sie von hier weg!“).
Unvertretbare (höchstpersönliche) Handlungen können ausschließlich durch unmittelbaren Zwang (und mittels Zwangsgeldes) durchgesetzt werden. Allerdings ist die Unterscheidung zwischen Ersatzvornahme und unmittelbarem Zwang nicht immer eindeutig. Teils bestehen schwierige Abgrenzungsfragen (etwa, ob das Eintreten einer Tür als Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang gegen Sachen zu qualifizieren ist – entscheidend ist, ob die Grundverfügung „Öffnen Sie die Tür!“ als eine vertretbare Handlung zu bewerten ist oder nicht), dazu näher in Teil 2 B. III. 3. a).
2. Zwangsgeld (§§ 51 Abs. 1 Nr. 2, 53 f. PolG NRW)
Zwangsgeld meint die Auferlegung einer bestimmten Geldschuld, die vom Polizeipflichtigen zu begleichen ist, wenn er sich nicht wie polizeilich gefordert verhält. Das Zwangsgeld kann nicht nur (wie die Ersatzvornahme) zur Durchsetzung vertretbarer Handlungen verhängt werden, sondern kommt auch zur Erzwingung unvertretbaren Verhaltens in Betracht. Das Zwangsgeld muss – wie jedes andere Zwangsmittel, vgl. § 56 PolG NRW – zuerst angedroht werden („wenn Sie der Verfügung nicht nachkommen, wird gegen Sie ein Zwangsgeld festgesetzt!“).
Reagiert der Polizeipflichtige darauf nicht, wird das Zwangsgeld (gem. § 53 Abs. 2 PolG NRW) festgesetzt. Das bedeutet, dass ein Verwaltungsakt von der Polizei erlassen wird, der dem Störer aufgibt, das hiermit festgesetzte Zwangsgeld innerhalb einer bestimmten Frist zu bezahlen. Damit wird natürlich die ursprüngliche Polizeipflicht nicht erfüllt (insoweit hat das Zwangsgeld – im Gegensatz zu Ersatzvornahme und unmittelbarem Zwang – keine unmittelbare Realisierungsfunktion, weil durch dessen Verhängung kein rechtmäßiger Zustand hergestellt wird). Allerdings kommt der Maßnahme psychische Beugewirkung zu, da der Betroffenen für die verursachte Störung zur Kasse gebeten wird, wenn er diese nicht beseitigt. Zahlt der Störer, wie ihm durch den Festsetzungsbescheid aufgegeben wurde, nicht, so kann das Zwangsgeld im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden, vgl. § 53 Abs. 3 PolG NRW. Wie die Beitreibung genau erfolgt, ist nicht Prüfungsstoff. Sie richtet sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), das u.a. die Vollstreckung von Geldforderungen des Staates gegen den Bürger (z.B. durch Pfändung) regelt.
Wenn die Beitreibung des Zwangsgeldes ohne Erfolg versucht worden ist oder wenn von vornherein feststeht, dass sie keinen Erfolg haben wird (z.B. weil bekannt ist, dass der Betroffene völlig mittellos ist), ist das Zwangsgeld „uneinbringlich“ (vgl. § 54 PolG NRW) und es kann als Ultima Ratio Ersatzzwangshaft beim Verwaltungsgericht beantragt werden.
Die Ausführungen zeigen, dass ein Zwangsgeld als Vollstreckungsmittel der Polizei (mangels unmittelbarer Realisierungswirkung) regelmäßig nur in aufschiebbaren Fällen in Betracht kommt und nicht – wie in der vollzugspolizeilichen Praxis vorherrschend – in Eilfällen.
Beispiel:
In dem obigen Beispielsfall zur Ersatzvornahme (umgestürzter Baum) wäre grundsätzlich als Zwangsmittel auch ein Zwangsgeld in Betracht gekommen. Da allerdings die Störung sofort beseitigt werden muss (der Verkehr ist gefährdet), ist hier als Vollstreckungsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen die Ersatzvornahme zu wählen.
Deswegen hat das Zwangsgeld im Bereich des Polizeirechts nur untergeordnete Bedeutung. In der Praxis (und in der Klausur) kommt Zwangsgeld im Wesentlichen nur in drei Fällen regelmäßig als Zwangsmittel zum Einsatz. Nämlich zur Durchsetzung einer Vorladung nach § 10 PolG NRW (Durchsetzung einer nicht vertretbaren Handlungspflicht: „Erscheinen Sie auf der Polizeidienststelle!“) und zur Durchsetzung eines Rückkehrverbotes nach § 34a PolG NRW sowie eines Aufenthaltsverbotes nach § 34 Abs. 2 PolG NRW (jeweils Durchsetzung einer Unterlassungspflicht: „Betreten Sie den betreffenden Ort für eine bestimmte Zeit nicht mehr!“).
3. Unmittelbarer Zwang (§§ 51 Abs. 1 Nr. 3, 55, 57 ff. PolG NRW)
In § 58 Abs. 1 PolG NRW ist der unmittelbare Zwang als Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt (vgl. § 58 Abs. 2 PolG NRW), ihre Hilfsmittel (vgl. § 58 Abs. 3 PolG NRW) und durch Waffen (vgl. § 58 Abs. 4 PolG NRW) definiert.
Beispiele:
Ein Polizeibeamter wird angegriffen (Grundverfügung, die mit Zwang durchgesetzt werden soll: „Greifen Sie mich nicht an!“ Damit wird dem Pflichtigen eine Unterlassung aufgegeben.). Wehrt der Beamte den Angriff mit einem Schlag oder sonstigen Eingriffstechniken ab, liegt unmittelbarer Zwang in Form von („einfacher“) körperlicher Gewalt vor (§ 58 Abs. 2 PolG NRW); benutzt er zur Abwehr des Angriffs sein Reizstoffsprühgerät (RSG), handelt es sich um den Einsatz von Hilfsmitteln körperlicher Gewalt (§ 58 Abs. 3 PolG NRW); sollte der Beamte seine Dienstpistole zur Abwehr des Angriffs nutzbar machen, liegt unmittelbarer Zwang durch Waffen vor (§ 58 Abs. 4 PolG NRW). Wird auf einen Polizeibeamten ein Hund gehetzt (Grundverfügung: „Pfeifen Sie Ihren Hund zurück!“ o.Ä. als höchstpersönliche Handlungspflicht) und versetzt der Beamte dem Hund daraufhin einen Tritt, handelt es sich um einfache körperliche Gewalt gegen Sachen; denn der Hund ist gem. § 90a BGB als Sache zu behandeln.
Unmittelbarer Zwang darf gem. § 55 PolG NRW erst zur Anwendung kommen, wenn Ersatzvornahme und Zwangsgeld nicht zum Ziel geführt haben bzw. den Vollstreckungserfolg nicht herbeiführen können. Da es sich beim unmittelbaren Zwang regelmäßig um den schärfsten Eingriff (meist in die körperliche Integrität) handelt, ist dieser stets letztes polizeiliches Mittel zur Herstellung rechtmäßiger Zustände (Ultima Ratio).
Wegen der mit dem unmittelbaren Zwang verbundenen besonders intensiven Grundrechtseingriffe (dazu noch unten IV), bestehen in den §§ 57 ff. PolG NRW – im Gegensatz zu den anderen Zwangsmitteln – sehr ausführliche Regelungen, die im Wesentlichen am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausgerichtet sind. Bis auf die Regelungen zum Schusswaffengebrauch bedarf es diesbezüglich keiner über den Gesetzeswortlaut hinausgehenden Detailkenntnisse. Die Regelungen sind aus sich heraus verständlich und erschließen sich durch aufmerksame Lektüre.
Hinweis: Lesen Sie die §§ 57 ff. PolG NRW aufmerksam durch. In § 58 finden sich die notwendigen Begriffsbestimmungen; in § 60 die Pflicht, nach Anwendung unmittelbaren Zwangs Verletzten Hilfe zu leisten; in § 61 PolG NRW Regelungen zur Androhung; spezielle Bestimmungen zur Fesselung als Hilfsmittel körperlicher Gewalt in § 62 und in den §§ 64 ff. PolG NRW Regelungen zum Schusswaffengebrauch. Studieren Sie insbesondere auch die zu den gesetzlichen Regelungen ergangenen Verwaltungsvorschriften! Dort ist z.B. genauer erläutert, wann welche Mittel des unmittelbaren Zwangs eingesetzt werden dürfen, etwa ein RSG (vgl. VVPolG NRW 58.36); diese Informationen können in Klausuren häufig bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahme nutzbar gemacht werden.
III. Gestrecktes Verfahren und Sofortvollzug
1. Der gesetzliche Regelfall: Das gestreckte Verfahren (§ 50 Abs. 1 PolG NRW)
a) Die Grundkonstellation: Befehl und Zwang
§ 50 Abs. 1 PolG NRW beschreibt die polizeiliche Grundkonstellation von „Befehl und Zwang“. Das bedeutet, dass die Polizei nach Erkenntnis einer Gefahrenlage einen Verwaltungsakt (§ 35 Satz 1 VwVfG) erlässt, durch den der Adressat aufgefordert wird, durch zwecktaugliches Verhalten (= Tun, Dulden oder Unterlassen) die Gefahr abzuwehren. Rechtsgrundlage der Verfügung ist regelmäßig eine Standardbefugnis oder die Generalklausel.
Beispiel:
Die Aufforderung, sich von einem Ort zu entfernen (Platzverweis nach § 34 Abs. 1 PolG NRW).
Im Idealfall wird dieser polizeiliche Befehl (= Grundverfügung) befolgt, sodass die Gefahr abgewehrt ist. Wird der Befehl der Grundverfügung missachtet, kann dieser ggf. mit Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden, § 50 Abs. 1 PolG NRW.
Beispiel:
Derjenige, der dem Platzverweis nicht nachkommt, wird von den Beamten von dem betreffenden Ort weggetragen (Anwendung unmittelbaren Zwangs im gestreckten Verfahren nach § 50 Abs. 1 i.V.m. §§ 55, 57 ff. PolG NRW).
b) Reichweite der Standardmaßnahmen und gestörte Polizeitätigkeit
Allerdings – und das stellt Anfänger häufig vor Verständnisprobleme – ermächtigen nicht alle Standardmaßnahmen (so wie der Platzverweis, § 34 Abs. 1 PolG NRW, oder die Befragung, § 9 Abs. 1 PolG NRW) ihrem Wortlaut nach zum Erlass eines Verwaltungsaktes (= Grundverfügung), der bei Nicht-Befolgen durch Zwangsmaßnahmen vollstreckt werden kann. Manche Standardmaßnahmen – wie etwa die Durchsuchung, §§ 39, 4...