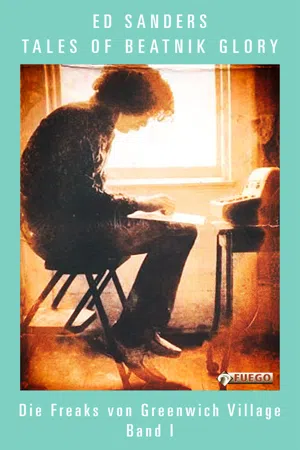![]()
DER FRIEDENSMARSCH
I
Kurz, nachdem der Fahrer des hellblauen Ford die Kuppe des Hügels etwa zwei Meilen vor der Stadt passiert hatte und die abfallende Straße hinuntersteuerte, stieß er auf eine Schlange von hintereinander marschierenden Fußgängern, die wohl so was Ähnliches wie Transparente bei sich hatten.
»Ja aber Melvin, wieso bremst du denn hier?« fragte seine Frau. Er gab keine Antwort, sondern deutete auf die schildertragenden Märschler rechts von ihnen.
»Aber Melvin, warum lehnst du dich denn so weit raus?«, löcherte sie ihn weiter.
Melvin beugte sich jetzt tief übers Lenkrad und verrenkte sich fast den Hals, als er versuchte, die Transparente zu entziffern. Während er ihr eines vorlas — »Nationale Verteidigung durch gewaltlosen Widerstand! Was soll denn das nun wieder heißen?« — rollte sein Wagen nur noch mit fünf Meilen Geschwindigkeit über die Straße. Melvin konnte beim besten Willen nicht sehen, dass hinter ihm ein kleiner Transporter mit Vollgas den Berg heraufgeprescht kam. Und dann hörte er nur noch Quietsch! Bumm! Krach! und das Knirschen und Splittern der Windschutzscheibe, als der Schädel seiner besseren Hälfte mit voller Wucht dagegen prallte. Als sie die quietschenden Bremsen hörten, stoben die Marschierer nach allen Seiten auseinander und fielen kopfüber in den Straßengraben — die Transparente flogen achtlos zu Boden, und die Flugblätter wirbelten wild durcheinander über den Asphalt.
Aus Furcht vor anderen Autos, die blindlings in den Straßengraben stürzten und sich dabei überschlugen, sprinteten ein paar von den Teilnehmern sogar den Damm hinauf und hielten erst wieder an, als sie den Rand einer Kuhweide erreicht hatten.
Zum Glück hatte Melvins Frau keine ernsthaften Verletzungen davongetragen. Später dachte er manchmal, dass es vielleicht an der hammerähnlichen Form ihres Schädels lag, dass sie eine Windschutzscheibe zerschmettern konnte, ohne dass ihr dabei etwas passierte. Wenig später trafen ein Krankenwagen und mehrere Streifenwagen an der Unfallstelle ein. Polizisten hielten die Märschler fest und verhörten sie. Sie überreichten den Bullen ihren Begleitbrief von der Amerikanischen Gesellschaft für Bürgerrechte, der in groben Zügen ihre Rechte umriss.
»Habt ihr denn eigentlich schon einen Platz zum Schlafen für heute Nacht?«, fragte der Beamte und schob einen Stapel Akten von seinem Rücksitz als bereitete er sich im Geiste schon darauf vor, ihnen die Gastfreundschaft des Stadtgefängnisses anzubieten.
»Oh ja, natürlich, Kommissar, wir werden in der Shiloh Baptistenkirche übernachten.« Die Friedensmärschler machten ein Gesicht, als könnten sie kein Wässerchen trüben, um den Gedanken an eine Verhaftung wegen Landstreicherei schon im Keim zu ersticken.
Nachdem die Streifenwagen abgezogen waren, brach unter den Teilnehmern des Marsches eine heftige Debatte aus. Ihre Transparente bestanden aus großen, rechteckigen Wachstüchern, die sie um Rahmen aus Leichtmetall gewickelt hatten. Diese Röhren wiederum steckten auf federleichten Aluminiumstangen mit Griffen an den Enden. Ihre Slogans waren so groß gepinselt, wie es nur eben ging, und zwar auf beiden Seiten, und weil sie so leicht waren, machte es den Trägern auch nichts aus, sie den ganzen Tag lang aufrecht mit sich zu tragen. Am Schluss der Debatte waren sie sich einig, dass sie, um die allgemeine Sicherheit auf dem Highway nicht zu gefährden, eigentlich nicht viel mehr tun konnten, als die Transparente möglichst gerade zu halten, die Fahrer der vorbeifahrenden Autos nicht in Diskussionen zu verwickeln und sich so weit wie möglich vom Straßenrand entfernt zu halten. Dann sammelten sie ihre herumflatternden Stapel von Flugblättern wieder ein, hoben die Transparente auf und marschierten weiter Richtung Stadt.
II
Aus Liebe zum Frieden, für eine Zivilisation im Namen ahimsas (Gewaltlosigkeit), für ein Ende aller nuklearen Bedrohung, aus einem Gefühl von Schuld heraus, zur Ehre Gottes und aus Liebe zu ihm, aus Freude an Sonne und Sinnlichkeit und aus Verehrung für Manes, den Perser, hatte sich im Frühjahr 1962 ein Häuflein Männer und Frauen — die meisten aus der Lower East Side — auf einen Tausend-Meilen-Marsch von Tennessee über Virginia nach Washington, Columbia gemacht. Sie nannten ihr Projekt, das übrigens vom Nationalen Komitee für Gewaltlose Zivilisation mitfinanziert wurde, den Memphis-Washington-Marsch für den Frieden.
Der Organisator der ganzen Sache war ein hochintelligenter Gandhi-Anhänger namens Thomas Bartley, der in der ersten Hälfte des Napalm-Jahrzehnts schon eine ganze Reihe von Friedensmärschen auf die Beine gestellt hatte, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa und in der Sowjetunion. Er besaß ein unglaubliches Charisma, hatte ein Buch mit dem Titel Nationale Verteidigung durch gewaltlosen Widerstand geschrieben und in Indien selbst ein paar Jahre die Gandhi-Bewegung studiert. Bartley nahm aber nicht persönlich am Memphis-Marsch teil, sondern blieb in New York und koordinierte das Projekt von diesem Hauptstützpunkt aus.
Bart war Experte, wenn es darum ging, Geld aufzutreiben. Entweder lockte er es den Leuten schon am Telefon aus der Tasche oder er setzte Bittbriefe auf und schickte sie an Bürger, von denen er wusste, dass sie entweder Kohle hatten oder aber das allgemeine Wettrüsten und die Atomwaffentests mit Misstrauen beobachteten. Im Frühjahr 1962, als die Regierung der Vereinigten Staaten mehrere Atombomben über ein paar Inseln im Pazifischen Ozean hochgehen ließ, war das ein ziemlich heißes Eisen.
Andererseits wurden die Friedensmärsche finanziert von religiös angehauchten, wohltätigen Stiftern, wie reichen Milchfarmern aus der Quäkergemeinde oder Vertretern der Fellowship of Reconciliation. Nicht zu vergessen die spontane Freigebigkeit von diversen reichen Pinkeln, die in der Klemme saßen, und anonyme Schecks von schuldbewussten Liberalen.
III
»Ach ja, da ist noch was, was keinesfalls in unserem Verbandskasten fehlen darf: ein Hemostat!« erinnerte Bartley plötzlich.
Die ganze Runde blickte sich fragend an. »Ein Hemostat?«, fragte einer stirnrunzelnd.
Einer seiner Freunde beugte sich rüber und flüsterte ihm ins Ohr: »Das ist so was Ähnliches wie eine Juwelierpinzette. Nelson hat zum Beispiel eins und benutzt es als Jointhalter. Es ist zum Blutstillen da, für den Fall, dass der Klan uns die Halsschlagadern anknabbert ...«
Eine bedrohliche Atmosphäre kennzeichnete die Planungsdiskussionen für den Friedensmarsch, die hauptsächlich in den Büros des Nationalen Komitees für Gewaltlose Zivilisation stattfanden. Man hatte läuten gehört, dass in bestimmten Distrikten, etwa in den Berglandschaften des mittleren Tennessee, stiernackige Farmer herumliefen, die sich damit brüsteten, dass sie noch keinem Schwarzen begegnet wären, der freiwillig eine Nacht in ihrer Stadt verbracht hätte. Und jeder erinnerte sich nur allzugut an die Fernsehaufzeichnung von dem brennenden Greyhound-Bus. Trotzdem schien der Zeitpunkt günstig für ein derartiges Projekt zu sein und außerdem lockte natürlich die Gefahr und war für manche sogar der eigentliche Kick an der Sache. Ein Friedensmarsch, den Weiße und Schwarze Arm in Arm absolvierten, mitten durch den tiefen Süden, der alle Mitbürger aufforderte, mit ihren Steuergeldern nicht länger Kriegseinrichtungen zu finanzieren, ihre Jobs bei militärischen Stützpunkten aufzugeben und jegliche Form von Gewalt abzulehnen — ein solches Vorhaben war der Schlüssel zum Paradies, so meinte jedenfalls die Redaktion vom Magazin The Shriek of Revolution, deren Mitglieder sich geschlossen zum großen Ahimsa-Marsch anmeldeten.
Bei diesen organisatorischen Versammlungen kristallisierte sich auch heraus, dass der Marsch sich um eine Kerntruppe von zehn bis zwanzig Mitgliedern aufbauen würde. Sympathisanten waren eingeladen, sich für ein paar Tage anzuschließen — ein ganz natürliches Phänomen, das sich von selbst ergeben würde, wenn die Märschler in eine Collegestadt kamen und lokale Dissidenten oder Bürgerrechtskämpfer ansteckten.
In diesen harmlosen Zeiten gab es noch keine gewalttätigen Provokateure, Rempler, Krakeeler oder eingeschleuste FBI-Agenten, die Stunk gemacht hätten. Diese Probleme tauchten erst Jahre später auf, als Begleiterscheinungen des Vietnamkrieges sozusagen. Trotzdem führten sie eine Art Ahimsa-Sicherheits-Check durch, bei dem alle potenziellen Teilnehmer des Marsches eine Kurzbiografie abliefern mussten, einschließlich einer Begründung, warum sie bei der ganzen Sache mitmachen wollten.
Nach einer scharfen Debatte beschlossen die Organisatoren, dass es zwar während des ganzen Marsches offiziell keine Rassentrennung geben sollte, dass aber der Kerntruppe trotzdem keine Paare angehören durften, die nicht die gleiche Hautfarbe hatten. Man einigte sich dabei auf eine Art Kompromiss: Paare, die »rechtmäßig verheiratet waren«, durften wenigstens ein paar Tage lang als Sympathisanten mitmarschieren.
Die Anzahl der Teilnehmer war so gering, dass Wahlen sich von selbst erübrigten, stattdessen wurde geredet, geredet und geredet, so lange, bis man sich geeinigt hatte, und wenn am nächsten Tag einer ankam und noch etwas einzuwenden hatte, fing die ganze Diskussion noch mal von vorne an. Für den Fall, dass die Teilnehmer in eine Sackgasse gerieten oder andere Schwierigkeiten auftauchten, gab es ein abgestuftes Entscheidungssystem. Wenn also die sogenannte Kerntruppe nicht vollzählig für eine bestimmte Entscheidung stimmte, übernahm ein kleineres Führungskomitee mit voller Entscheidungsgewalt das Kommando. Wenn das Führungskommando ebenfalls keine Einigung zustande brachte, traten zwei Marschorganisatoren in Aktion. Und für ganz dringende Notfälle wurde ein unabhängiger Projektdirektor eingesetzt. Dieser Memphis-Washington-Direktor war William Strom, ein hervorragender schwarzer Aktivist, Dichter und Romanist, der der Friedensbewegung nach einer jahrelangen Laufbahn als Organisator von Freiheitsdemonstrationen und Wählerregistrierungsprojekten sowie einer Vielzahl feinsinniger, etwas flatterhafter Vorlesungen zur symbolistischen Dichtung an einem College der Quäker beigetreten war.
Viele Vorbereitungen für den Marsch konnten erst in letzter Minute getroffen werden. Kopien der ACLU-Begleitbriefe und Broschüren, die über die Absichten und die Reiseroute der Friedenskämpfer aufklärten, wurden an die Polizeichefs aller Städte verschickt, die sie passieren würden. Zeitungen, Fernsehen und Radiostationen erhielten Pressemitteilungen. Die Pfarrer der unterschiedlichsten Bekenntnisse entlang der geplanten Route wurden mit umfangreichen Literaturpaketen versorgt. Es war von enormer Bedeutung, dass die Pfarrer mitmachten. Im Grunde hätte es während der ganzen Sechziger Jahre überhaupt keine Friedensbewegung geben können, wenn da nicht immer wieder ein leerer Kirchenflügel gewesen wäre, in dem die Marschteilnehmer ein paar Stunden schlafen konnten, oder eine Gemeindeküche, die sie mit einer kräftigen Mahlzeit versorgte.
Zwei Wochen vor Beginn des Projekts f...