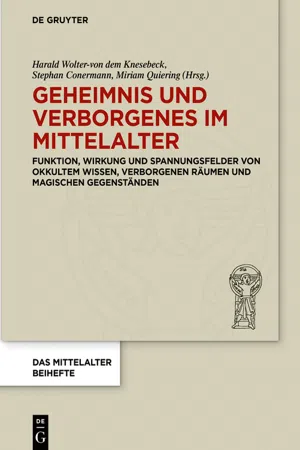
Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter
Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen
- 712 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter
Funktion, Wirkung und Spannungsfelder von okkultem Wissen, verborgenen Räumen und magischen Gegenständen
Über dieses Buch
Das Geheimnis begegnet uns als gesellschafts- und kulturkonstituierendes Konzept in diversen Lebensbereichen. Wissen, Gegenstände oder Räume, die geheim gehalten oder verborgen werden, können dadurch wichtiges über sich selbst oder die am Geheimnis beteiligten Akteure verraten.
So verlaufen die Grenzen zwischen geheim und öffentlich, zwischen Eingeweihten und Ausgeschlossenen, nicht selten entlang der Grenzen politischer, sozialer, religiöser oder auch wissenschaftlicher Ordnungssysteme.
Dieser Band untersucht an Hand vielfältiger Fallbeispiele aus den Geschichts-, Literatur- und Kulturwissenschaften, der Philosophie und Theologie die Funktionen und Wirkkraft von Geheimnissen im Mittelalter sowie die normativen Vorstellungen und Spannungsfelder, die sie umgeben.
Auf der einen Seite grenzen sich Gruppen (z.B. Eliten) durch den ihnen vorbehaltenen Zugang zu geheimen Wissen von innen heraus ab; auf der anderen Seite bringt die Kennzeichnung eines Gegenstandes als geheim bestimmte Vorstellungen über diesen mit sich. So erhalten die göttliche Weisheit, die heimliche Liebe oder auch medizinische Geheimrezepte ihren charakteristischen Stellenwert erst durch ihre Verborgenheit.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Geheimnis und Verborgenheit als narratives Mittel in der Literatur
Verborgenes im Altenglischen
Abstract
1 Einleitung
2 Exkurs: Luthers „Geheimnis“
Ich kan heutigs tages kein deutsch finden auff das wort mysterion / vnd were gleich gut / das wir blieben bey dem selbigen kriechischen wort / wie wir bey vielen mehr sind blieben / Es heist ja so viel / als secretum / ein solch ding / das aus den augen gethan vnd verborgen ist / das niemand sihet / vnd gehet gemeiniglich die wort an / als wenn etwas gesagt wird / das man nicht verstehet / spricht man / das ist verdackt / da ist etwas hynden / das hat ein mysterion / da ist etwas verborgens. Eben das selbige verborgen heist eygentlich / mysterium / ich heisse es ein geheymnis.10
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Zur Einleitung: Das Geheimnis als gesellschafts- und kulturkonstituierendes Konzept
- Mystik und Kirche: Vom göttlichen Geheimnis, okkulten Wissen und mystifizierten Orten
- Bedeutung und Funktion sakraler Räume und Gegenstände
- Kodikologische Beiträge: Von Buchschlössern und paratextuellen Zwischenräumen
- Geheimnis und Verborgenheit als narratives Mittel in der Literatur
- Wissen ist Macht: Geheimhaltung als strukturelles Merkmal von Bildungs- und Herrschereliten
- Ortsregister
- Personenregister