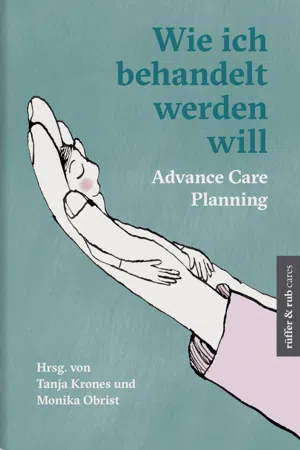Vorwort
Stefan Spycher
Einführung in Advance Care Planning
Monika Obrist
Auch unser Tipi ist ein guter Ort zum Sterben
Eine ACP-Beratung aus Sicht eines gesunden Menschen
Christina Buchser
Partizipative Entscheidungsfindung (Shared Decision-Making)
Isabelle Karzig-Roduner
Die Patientenverfügung «plus»
Isabelle Karzig-Roduner, Theodore Otto-Achenbach
»Man muss es im Voraus besprechen«
Gespräch mit dem Intensivmediziner Dr. med. Peter Steiger
Gabriela Meissner
Illustrationen
Lilian Caprez
»Unser Grundsatz ist: keine Beeinflussung der Klientinnen und Klienten«
Gespräch mit Rolf Huck, Geschäftsführer der Krebsliga Kanton Zürich, und Monika Obrist, Geschäftsleiterin palliative zh+sh, über ihre Erfahrungen in der ACP-Beratung
Anna Gerber
Noch einmal nach Morcote reisen oder nicht mehr aufwachen
Wie Pflegefachfrau Liselotte Vogt mit Patientin Ruth Schweizer für den Notfall plant
Sabine Arnold
Notfallplanung in der Palliative Care
Vorausplanung für Krisen- und Notfallsituationen bei unheilbar kranken Menschen
Andreas Weber
Vertreterentscheidungen – Advance Care Planning für urteilsunfähige Menschen
Theodore Otto-Achenbach
Geschichte der gesundheitlichen Vorausplanung (Advance Care Planning)
Barbara Loupatatzis, Tanja Krones
Anhang
Glossar
Anmerkungen
Bildnachweis
Biografien
Vorwort
Der Bundesrat hat sich in seiner gesundheitspolitischen Strategie »Gesundheit2030« zum Ziel gesetzt, die Gesundheitskompetenz zu stärken, damit Bürgerinnen und Bürger »gut informiert, verantwortungs- und risikobewusst Entscheidungen treffen, die ihre Gesundheit sowie die Gesundheit ihrer Angehörigen bestimmen. Dabei werden sie von kompetenten Gesundheitsfachpersonen unterstützt.«1
Dieser Anspruch bringt einen Freiheitsgewinn und fördert die Selbstbestimmung im Leben und auch im Sterben. Aber die Anforderung, sich diesen Fragen zum Leben und zum Sterben zu stellen und sie zu entscheiden, zieht auch eine Verantwortung nach sich, die in Überforderung münden kann. Umso wichtiger ist es, dass die betroffenen Personen und ihre Angehörigen dabei von qualifizierten Fachpersonen unterstützt werden. Advance Care Planning im Sinne eines strukturierten und fachlich begleiteten Gesprächsprozesses trägt dazu bei, die Menschen zu befähigen, sich vorausschauend mit ihren Wünschen im Hinblick auf verschiedene Situationen der Urteilsunfähigkeit auseinanderzusetzen, und stärkt ihre Kompetenz, um über ihre Behandlung und Betreuung zu entscheiden.
Die meisten Menschen sterben nicht plötzlich, sondern nach einer mehr oder weniger langen Krankheitsphase. Während dieser Zeit werden vielfach medizinische Entscheidungen gefällt, die den weiteren Verlauf und den Zeitpunkt des Todes beeinflussen. Dies belegt eine Studie, die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms »Lebensende« durchgeführt wurde. Sie hat ermittelt, dass rund 70 Prozent der Todesfälle nicht plötzlich und unerwartet eintreten. Sie zeigt zudem, dass in über 80 Prozent dieser Todesfälle vorgängig mindestens eine medizinische »End-of-Life Decision« getroffen wurde.2
Das Sterben ist damit einem Paradigmenwechsel unterworfen. Der Synthesebericht zum Forschungsprogramm »Lebensende« hält fest: »Der Tod hat nicht länger den Charakter eines Schicksalsschlags, sondern wird immer mehr zu einer Folge individueller Entscheide: Wie, wann und wo will ich sterben?«3 Es scheint klar, dass die betroffene Person selber diese Entscheidungen fällt. Im Falle einer Urteilsunfähigkeit entscheiden die Angehörigen beziehungsweise die vertretungsberechtigte Person. Entscheidungsgrundlage bilden dabei die in einer Patientenverfügung festgehaltenen Weisungen oder, wenn solche Weisungen fehlen, der mutmaßliche Willen und die Interessen der urteilsunfähigen Person. Ob die Patientin, der Patient selber entscheidet oder eine vertretungsberechtigte Person: Beides bedingt, dass die betroffene Person sich darüber Gedanken gemacht hat, was für sie im Hinblick auf die verbleibende Lebenszeit wichtig ist und dass sie über ihre Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf die Behandlung und Betreuung nachgedacht hat. Hilfreich ist zudem, wenn sie mit den Angehörigen darüber gesprochen hat und/oder ihre Wünsche in einer Patientenverfügung verständlich und eindeutig festgehalten hat. Zudem müssen diese Festhaltungen auffindbar sein.
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die gesundheitliche Vorausplanung ein Bedürfnis der Bevölkerung ist. Gemäß einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die 2017 im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit BAG durchgeführt wurde, haben mehr als 80 Prozent der Befragten angegeben, dass sie über das Lebensende nachdenken. Über zwei Drittel haben sich bereits konkret Gedanken dazu gemacht, welche Art der Behandlung und Betreuung sie am Lebensende in Anspruch nehmen möchten. Rund die Hälfte der Befragten findet, dass man sich frühzeitig mit diesen Themen auseinandersetzen sollte, wenn man noch gesund ist. Allerdings haben nur acht Prozent der Befragten mit Gesundheitsfachpersonen über ihre Behandlungswünsche gesprochen. 16 Prozent der Befragten haben eine Patientenverfügung hinterlegt.4 Mit zunehmendem Alter steigt das Bedürfnis, sich mit Fragen zu Behandlungswünschen am Lebensende auseinanderzusetzen.
Es lässt sich also festhalten, dass die gesundheitliche Vorausplanung wichtig und notwendig ist – und zudem einem Bedürfnis vieler Menschen entspricht. Das BAG hat deshalb bereits 2016 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Grundlagen und Empfehlungen für die konkrete Umsetzung der gesundheitlichen Vorausplanung in der Schweiz erarbeitet hat (Rahmenkonzept).5
Es besteht aber weiterhin Handlungsbedarf, um die gesundheitliche Vorausplanung als festen Bestandteil in unserem Gesundheitssystem zu verankern. In seinem Bericht zum Postulat 18.3384 »Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende« hält der Bundesrat fest, dass die vorausschauende Auseinandersetzung mit dem Lebensende im Sinne des Advance Care Planning eine zentrale Voraussetzung ist, um ein selbstbestimmtes Lebensende und ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Deshalb sollen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die vorausschauende Auseinandersetzung mit dem Lebensende zu fördern. Im Vordergrund steht, dass die Werte von Patientinnen und Patienten sowie ihre Bedürfnisse in Bezug auf die Gesundheitsversorgung öfter und früher im Krankheitsprozess ermittelt werden.
Das vorliegende Buch leistet einen wichtigen Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen. Die verschiedenen Kapitel beleuchten die Grundlagen des Advance Care Planning und zeigen anhand von konkreten Beispielen auf, wie die gesundheitliche Vorausplanung in der Praxis umgesetzt werden kann.
Dr. Stefan Spycher
Vizedirektor, Bundesamt für Gesundheit BAG
Einführung in
Advance Care
Planning
Von Monika Obrist
Wenn Sie schwer krank sind, sollen Sie die Möglichkeit haben, Ihre Behandlung mitzubestimmen. Ihre Werte, Wünsche und Bedürfnisse sollen bei den behandelnden Fachpersonen Gehör finden und in die Behandlung einfließen. Dieses Recht haben Sie. Die vorausschauende Behandlungsplanung, englisch »Advance Care Planning« (ACP) genannt, ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre Erwartungen, welche Sie an Ihre Behandlung haben, eindeutig und verständlich formulieren können. Dazu gehört, dass Sie in einem persönlichen Gespräch über die jeweiligen Chancen und Risiken einer Behandlung gut informiert und aufgeklärt sind. Unter dieser Voraussetzung können Sie schließlich gemeinsam mit einer Beratungsperson eine differenzierte Patientenverfügung erstellen. Neben dem Behandlungsteam, das nun diesen gemeinsam ausformulierten Leitplanken folgen kann, ist diese Patientenverfügung auch den Angehörigen bekannt. Diese können so Ihren mutmaßlichen Willen vertreten, falls Sie in einen Zustand von Urteilsunfähigkeit geraten. Der folgende Beitrag gibt eine Übersicht.
In Ihrem Sinn behandelt – Selbstbestimmungsrecht bei medizinischen Behandlungen
Das sogenannte »Neue Erwachsenenschutzrecht«, das seit Anfang 2013 in Kraft ist, enthält eine Reihe Bestimmungen zum Vorsorgeauftrag, zur Patientenverfügung und zur Vertretungsberechtigung. Mit dem Recht auf Selbstbestimmung geht eine große Verantwortung sich selbst gegenüber einher. Das Recht auf Selbstbestimmung entstammt dem ethischen Prinzip der Autonomie. Mehr zum Begriff »Autonomie« finden Sie im Beitrag »Partizipative Entscheidungsfindung« von Isabelle Karzig-Roduner. Im medizinischen Kontext bedeutet das, die eigene Behandlung aktiv mitzugestalten. Damit wird Ihnen die Entscheidungshoheit eingeräumt, in eine medizinische Behandlung einzuwilligen oder eine solche zu verweigern (Art. 28 ZGB). Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Urteilsfähigkeit. Das Zivilgesetzbuch bezeichnet jede Person als urteilsfähig, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäß zu handeln (Art. 16 ZGB).
Gehen wir nun davon aus, dass Sie urteilsfähig sind und eine ärztliche Behandlung benötigen. Ihre Ärztin oder ihr Arzt muss Ihnen die notwendigen Entscheidungsgrundlagen geben und Sie über mögliche Behandlungsoptionen und Prognosen informieren, damit Sie eine Entscheidung treffen können. Lesen Sie mehr dazu im Beitrag »Partizipative Entscheidungsfindung« von Isabelle Karzig-Roduner, wie sich ein solcher Gesprächsprozess optimalerweise gestaltet.
Brauchen Sie überhaupt eine Patientenverfügung?
Im normalen täglichen Leben als urteilsfähige Person brauchen Sie keine Patientenverfügung. Sie entscheiden, ob Sie im Fall von körperlichen Beschwerden zum Arzt gehen wollen und welche Behandlung die richtige ist für Sie. Sie holen sich möglicherweise selbst die nötigen Entscheidungsgrundlagen ein oder lassen sich von einer Fachperson beraten. Am Ende entscheiden Sie sich für oder gegen eine Behandlungsmöglichkeit und tragen auch die Verantwortung für Ihre Entscheidung. Als urteilsfähige Person sind Sie also jederzeit in der Lage, selbst zu entscheiden. Bereits getroffene Entscheidungen können Sie zudem jederzeit revidieren. Daran ändert sich nichts, auch dann nicht, wenn Sie eine Patientenverfügung erstellt haben.
Wofür braucht es eine Patientenverfügung?
Eine Patientenverfügung kommt dann zum Tragen, wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht urteilsfähig sind und Ihren Willen nicht kundtun können. In Situationen der Urteilsunfähigkeit, wenn Entscheidungen über Ihre medizinische Behandlung getroffen werden müssen und Sie sich dazu nicht äußern können, soll eine Patientenverfügung klare und eindeutige Aussagen über Ihren Willen geben. Sie kann auch die Namen von Personen enthalten, die in Ihrem Sinn entscheiden sollen, die vertretungsberechtigt sind.
Verschiedene Situationen der Urteilsunfähigkeit
Nachfolgend eine kurze Übersicht über die Situationen einer Urteilsunfähigkeit. Mehr dazu finden Sie im Beitrag »Patientenverfügung ‹plus›« von Isabelle Karzig-Roduner und Theodore Otto-Achenbach.
Plötzliche Urteilsunfähigkeit
Wenn Sie einen Unfall oder eine akute Krankheit erleiden und das Bewusstsein verlieren, sind Sie in dieser akuten Situation urteilsunfähig. Dann brauchen Sie sofort Hilfe durch Personen, die in Ihrem Sinne handeln.
Länger andauernde Urteilsunfähigkeit
Es kann sein, dass Sie aufgrund verschiedener Ursachen für längere Zeit urteilsunfähig sind, z.B. wenn Sie wegen einer Lungenentzündung auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Sie können sich in dieser Situation nicht zur Behandlung äußern. Wenn die behandelnden Spezialisten Ihre Ziele und Grenzen kennen, können Sie Ihre Therapie danach ausrichten.
Bleibende Urteilsunfähigkeit
Von einer bleibenden Urteilsunfähigkeit sprechen wir, wenn die behandelnden Ärztinnen oder Ärzte mit Sicherheit aussagen können, dass Sie in einem Zustand sind, in dem die Urteilsunfähigkeit irreversibel, d.h. ohne Chance auf Besserung ist. Verschiedene Ursachen können dazu führen. Sie werden in diesem Zustand in aller Regel dauerhaft auf Pflege und Unterstützung angewiesen sein.
Vorhersehbare Urteilsunfähigkeit
Wenn Sie für eine O...