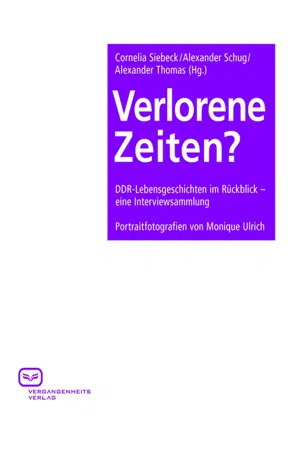![]()
Herbert Mißlitz
„Der Westen ist nicht reformierbar, da sind wir uns alle einig …“ - Herbert Mißlitz, geboren 1960
„Ich bereue nichts!“ sagt Herbert Mißlitz zu Beginn unseres ersten Gesprächs, in dem es um das geplante Interview geht. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht einmal, was es zu bereuen geben könnte, denn meine Informationen über ihn sind spärlich: Er wurde mir als ,DDR-Linker‘ empfohlen, der seinen Überzeugungen nach wie vor treu geblieben sei. Was ein ,Linker‘ in der DDR ist? Darüber habe ich im Gespräch mit Herbert Mißlitz einiges gelernt: entschieden antikapitalistisch und insofern nicht am goldenen Westen‘ orientiert. Gleichzeitig aber auch ein Gegner der realsozialistischen Politbürokratie, die er selten ohne die Attribute ,spießig‘ oder verknöchert‘ erwähnt. Kurz: einer, der den Sozialismus will – aber nicht so, wie er in der DDR war.
Vom rebellierenden Jugendlichen entwickelte sich Herbert Mißlitz zum Politaktivisten, der gemeinsam mit Gleichgesinnten darüber diskutierte, die DDR im Sinne eines rätekommunistischen Modells zu ,reformieren‘. Immer wieder wurde er vorgeladen oder inhaftiert: wegen Wehrdienstverweigerung, ,Zusammenrottung‘ oder Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit‘. Natürlich gab es auch eine Stasi-Akte, aber Herberts Eindruck ist bis heute, dass die Autoritäten ihm und seinen Freunden gegenüber einigermaßen ratlos waren – konnte man sie doch kaum als westliche Klassenfeinde‘ diffamieren. Auch ich habe während unserer Gespräche nicht selten gedacht, dass es das SED-Regime in diesem Falle mit jungen Leuten zu tun hatte, die das Versprechen ernst nahmen: „Dass das eine große Gemeinschaft ist, an der wir teilhaben sollten, die wir mit entwickeln sollten,“ wie Mißlitz sich aus dem Schulunterricht erinnert.
Von der Maueröffnung und der darauf folgenden Dynamik bis hin zur Vereinigung wurden Herbert Mißlitz und seine Freunde mehr oder weniger überrollt – aus ihrer damaligen Perspektive handelte es sich um eine ,Kolonisierung‘ der DDR. Heute hat er für das damalige Geschehen keinen Begriff mehr, der ihm passend erscheint. Überhaupt hadert Mißlitz mit den Worten. Er will sich nicht Opposition‘ nennen, auch nicht Gegner‘, er zögert, von Repressionen‘ zu sprechen – zu sehr scheinen diese Begriffe durch einstige ,Bürgerrechtler‘ okkupiert, von denen er sich heute entschieden abgrenzt. Denn: „Ich begreife mich nicht als Opfer!“, auch das einer der der ersten Sätze, die ich von Herbert gehört habe. Höchstens als Opfer eines von ihm so genannten ,Erinnerungskartells‘, das ein Bild von der DDR kreiert, dass er für völlig verzerrt hält und in dem er und seinesgleichen gar nicht mehr vorkommen. Aber abgesehen davon ist er ein überzeugter Kämpfer gegen die Realität geblieben.
„Also es herrschte schon so eine gewisse Geborgenheit.“
Wann sind Sie geboren, und wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin 1960 geboren worden, am 21. Juni, genau am Sommeranfang, und in Berlin-Grünau aufgewachsen, also nah am Wasser. Das hat meine Kindheit geprägt – ich war viel im Wasser, auf dem Wasser, im Wald, unterm Wald, Stichwort Höhlenbau. In Grünau war das soziale Netz ziemlich eng gestrickt, man kannte jeden, da war dann auch so eine Meute von Kids zusammen. Also, es herrschte schon so eine gewisse Geborgenheit. Das hat mich ziemlich geprägt.
Wofür standen Ihre Eltern, und was haben sie gemacht?
Ich bin in einem kommunistischen Elternhaus aufgewachsen, West-Fernsehen gab’s da nicht. Mein Vater hat damals den Journalistenverband aufgebaut. Meine Mutter ist erst durch ihn zur Kommunistin geworden. Tante Traude, ihre alte Schulfreundin, erzählt heute noch, wie meine Mutter plötzlich eine Hundertfünfzigprozentige wurde – alles wegen so einem Kerl! Später haben meine Eltern sich dann scheiden lassen. Unter Honecker war meine Mutter Sekretärin bei der FDJ, später hat sie im Ministerium für Außenhandel gearbeitet. Danach war sie bei der NVA, in der militärpolitischen Hochschule.
Ein kommunistisches Elternhaus – was hieß das, außer des Verbots von West-Fernsehen?
Das war ja nicht nur mein Elternhaus. Wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, da wohnten nur Leute, die sich für den Aufbau dieses Staates und dessen Entwicklung eingesetzt haben. Die fühlten sich verpflichtet, das auch den Kids mitzugeben. Wenn wir damals Cowboy und Indianer gespielt haben, waren wir also immer Indianer, also die Guten. Mein Nachbar, der große Faschismusforscher Kurt Gossweiler 1 , für uns ,Onkel Kurt‘, hat es mir aber auch nicht übel genommen, wenn ich später laut die Rolling Stones im Radio gehört habe.
Wie haben Sie sich als Kind den Kommunismus vorgestellt?
Als Kind war einfach klar: Wir leben im Sozialismus, und der Sozialismus ist gut, er sorgt für uns. In der Schule hatten wir nun keinen so ideologisch überformten Unterricht – jedenfalls habe ich das nicht so wahrgenommen. Sicherlich, die Geschichten, die wir gelesen haben, die Filme, die wir gesehen haben, die Arbeitsgemeinschaften, in denen wir waren, die waren natürlich didaktisch so aufgebaut, dass der Sozialismus gut ist. Dass das eine große Gemeinschaft ist, an der wir teilhaben sollten, die wir mit entwickeln sollten.
„Das war so, wie ich mir die Welt gewünscht habe.“
Sie haben einmal gesagt, dass Sie über Ihre Jugend am liebsten einen Roman schreiben würden, und Sie glauben, dass der Jahrgang ’60 in der DDR etwas Besonderes gewesen sei.
Naja, das war eher scherzhaft gemeint. Die Idee, das mal aufzuschreiben, kam daher, dass es mittlerweile viele Romane über die DDR gibt, mit denen ich nicht so glücklich bin. Da wird meinem Eindruck nach einer doch sehr parteiischen Erinnerungsideologie der heutigen Zeit entsprochen. Für meine Biografie war wichtig, dass der Beginn meiner Pubertät mit der kulturpolitischen Öffnung zusammenfiel, eben diese Zeit um 1973, mit den Weltfestspielen der Jugend. Bis 1976, Biermann-Ausweisung und so weiter. Damals ist viel gelaufen, diese ganzen Veranstaltungen, wo sich die Langhaarigen trafen und dieser Woodstock-Gedanke auch immer so mitschwang. Und Prag 1968 war damals noch sehr frisch.
Als 1973 die X. Weltfestspiele der Jugend in Ostberlin stattfanden, waren Sie 13. Ich nehme an, das war eines der ersten größeren Events in Ihrem Leben?
Ja. War es auch. Richtig groß! Wir waren mit unserem Blasorchester mit von der Partie. Das meiste spielte sich rund um den Fernsehturm am Alexanderplatz ab. Da war Tag und Nacht Leben. Das war so, wie ich mir die Welt gewünscht habe. Es gab so eine Offenheit, alle waren glücklich. Hin und wieder waren welche unglücklich verliebt und traurig, also das gab es auch.
Sogar im Sozialismus gab es keine Garantie für Glück?
Ja, sogar im Sozialismus gab es enttäuschte Lieben (lacht). Insgesamt herrschte eine sehr lockere Atmosphäre. Für mich als 13-jährigen war das noch nicht so von Bedeutung, aber die FDJ verteilte damals massenhaft Präservative. Es war klar, da wird nicht nur gefeiert, da wird jede Gelegenheit genutzt. Jugend halt – Jugend forscht‘ (lacht). Und viele hatten damals den Eindruck: Jetzt passiert was Neues. Jetzt geht’s voran, das ist der Durchbruch des Sozialismus …
Wie hat man diese kulturelle Öffnung damals sonst noch gespürt?
Es gab in dieser Zeit erste Literaturzirkel, in denen eifrig über Lyrik und Prosa diskutiert wurde – ein gutes Ausdrucksmittel, wenn du ein System nicht richtig kritisieren kannst, weil du es an bestimmten Punkten gar nicht ganz durchschaust oder weil du mit Repressionen rechnen musst, wenn du offen redest. Wichtig waren auch die ersten Diskussionen innerhalb der FDJ, und natürlich die Partys der Blues-Szene, auf denen ich dann auch reichlich unterwegs war.
Wie haben Sie damals eigentlich erfahren, dass irgendwo ein Konzert oder eine andere Veranstaltung stattfand? Das war ja eher weniger offiziell…
Das ging so rum: Dann und dann ist das Konzert in dem und dem Dorf, auf diesem alten Pferdegestüt spielt die verbotene Band so und so. Wir sind aber schon auch ins Haus der Jungen Talente gegangen, hier in Berlin. Der Jazz-Keller! Den fanden wir gut, auch wenn das von der FDJ organisiert wurde. Oder auch der Jazzkeller in der Puschkinallee in Treptow. Das waren für uns die Adressen. Jedenfalls waren wir viel unterwegs.
Wahrscheinlich floss da auch einiges an Alkohol.
Ja. Es gab zum Beispiel Rotweinpartys, da hat man über Hermann Hesse diskutiert – ,Der Steppenwolf‘, ,Glasperlenspiel‘ und so. Bukowski kam dann ins Spiel, Salingers ,Der Fänger im Roggen‘ oder Plenzdorfs ,Die neuen Leiden des jungen W‘. 2 Es gab aber auch Partys, da wurde einfach nur die Sau rausgelassen und harter Alk getrunken – meistens ,Pfeffi‘, Pfefferminzlikör.
Wie lief es damals bei Ihnen zu Hause?
Meine Mutter ist ausgezogen, da war ich 14. Die hat einen Typen namens Karl-Heinz kennengelernt, der war ziemlich militaristisch drauf: NVA-Stabsfeldwebel, „Du darfst nicht gegen den Strom schwimmen“ – eben so altdeutsch. Wir sind nur aneinander geraten, bis der Punkt kam, dass wir uns geprügelt haben. Er war besoffen und mein Bruder und ich haben ihn einfach rausgeschmissen. Das Jugendamt hat sich eingeschaltet, und dann sind die eben nach Karlshorst in ein Häuschen gezogen. Mein Bruder und ich blieben in Grünau. Einmal die Woche mussten wir uns bei einer Vertreterin von der Jugendhilfe melden und sagen, was wir so vorhaben. Ansonsten – zwei pubertierende Jungs allein in einer Dreizimmerwohnung, da kannst du dir vorstellen, was dabei rausgekommen ist: Partys. Die Wohnung wurde mit der Zeit ein Anlaufpunkt für Tramper aus ganz Osteuropa. Das war eine richtige kleine Zentrale, wenn Sie so wollen.
Gab es da nicht auch mal Ärger mit den Nachbarn oder der Polizei?
Es hat wohl anonyme Briefe an die NVA gegeben, wo meine Mutter gearbeitet hat. Onkel Kurt hat das nicht weiter gestört, unter uns wohnte Tante Stark, die hat das erst recht nicht gestört. Aber mit der Polizei gab es natürlich schon immer mal Ärger. Einmal, so mit 16 oder 17, wollten wir mitten in der Nacht schwimmen gehen. Schon in der Wohnung haben wir die Klamotten ausgezogen und sind dann splitternackt über die Straße zum Wasser rüber: 20 oder 25 Leute, alle rein ins Wasser, natürlich mit einem riesigen Spektakel. Als wir rauskommen, stand da ein Bulle – völlig verlegen, vor 25 nackten Gestalten, und meinte: „Hauptwachtmeister Leppelholz, Ihre Personaldokumente bitte!“ Wir haben nur gelacht. Ich hab’ noch haufenweise solche Geschichten, wo die einfach nicht wussten, was sie machen sollten.
„Was heißt ,politisch‘?“
Welche beruflichen Pläne hatten Sie?
Eigentlich wollte ich Musik studieren, ich wollte damals zum Sinfonieorchester. Für die Erweiterte Oberschule musste man aber sehr gut sein, nicht jeder konnte Abitur machen. In der 8. Klasse hatte ich wegen mangelnder Leistungen den Absprung zur EOS verpasst. Deshalb hatte ich mich verpflichtet, nach der 10. Klasse zehn Jahre zur Armee zu gehen, als Militärmusiker. Danach hätte ich direkt an der Musikhochschule studieren können. Dann wollte ich aber nicht mehr zur Armee, mittlerweile war klar: Armee ist einfach Scheiße. Aber ich hatte unterschrieben, und in unserer Naivität haben wir überlegt, dass ich mit Absicht durch die Abschlussprüfung in der 10. Klasse fallen muss. Dann wäre der NVA-Plan gescheitert, ich könnte eine Ausbildung machen und glücklich werden. Nichts leichter, als diese Prüfung nicht zu bestehen. Bis mein Klassenlehrer bemerkt hat, dass da was nicht stimmt. Der meinte dann, ich hätte zwar unterschrieben, sei aber nicht volljährig, deswegen habe das überhaupt keine Bedeutung. Ich hab’ die Prüfung dann grade noch geschafft – mit Unterstützung meines Lehrers. Anschließend habe ich eine Ausbildung zum Stuckateur gemacht, und das bereue ich bis heute nicht.
Nach dem Ende Ihrer Ausbildung zum Stuckateur haben Sie auch erst einmal in diesem Beruf gearbeitet.
Ja, da habe ich erstmal mit der Brigade auf den Baustellen der Republik richtig satt Kohle verdient. Natürlich Schwarzarbeit ohne Ende. Schwarzarbeit, das hieß 150 Mark pro Tag – das war sehr viel Geld in der DDR – plus Essen, Trinken und Unterkunft. Und Stuckateure waren gefragt, bei Häuslebauern und Parteifunktionären. Ich habe zum Beispiel die Villa Harry Tisch 3 gemacht, auch Schwarzarbeit, da sind wir allerdings 14 Tage extra von der Baustelle abgezogen worden. Ansonsten haben wir das so organisiert, dass ein Teil unserer Brigade immer Schwarzarbeit gemacht hat und die anderen deren Arbeit einfach mitmachten. Am Monatsende wurde der Lohn dann auf alle verteilt. Und oft sind wir auch noch am Wochenende losgezogen.
Mussten Sie nicht irgendwann zur Armee?
Noch nicht. Trotzdem, mir war bewusst, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Als ich dann mit 19 oder 20 meine erste Einberufungsüberprüfung bekam, hatte ich dann schon entschieden, nicht hinzugehen – auch nicht zu den Bausoldaten.
Wie wurde Ihnen klar, dass Sie verweigern werden? Und vor allem: Was sagte die Armee dazu?
Es gab ja damals schon diesen Berliner Appell: Militärfreies Deutschland und so weiter, das fanden wir gut. Dann natürlich ,Schwerter zu Pflugscharen‘. 4 Meine erste schriftliche Begründung für die Totalverweigerung war dementsprechend pazifistisch, nach dem Motto ,Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin‘. Dann haben die mich in Ruhe gelassen. Ich hatte alle halbe Jahre wieder eine Einberufungsprüfung, habe wieder einen Text geschrieben und bin nicht eingezogen worden.
Würden Sie sich rückblickend als politischen Menschen in dieser Zeit sehen?
Was heißt ,politisch‘? Wenn wir Party machen wollten und dann die Bullen angeritten kamen, war das für uns...