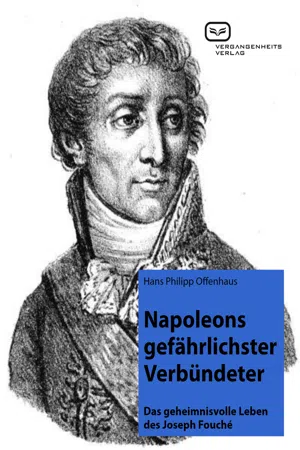![]()
1. Einleitung
Napoleon prägte eine ganze Generation, vielleicht sogar ein ganzes Jahrhundert, doch war er wirklich das allein stehende Genie? Gab es nicht auch andere Menschen in seinem Umfeld, die zwar von seinem Glanz oberflächlich überstrahlt wurden, tatsächlich aber bald ebenso mächtig und genial waren. Der geheime zweite Mann im französischen Kaiserreich2 war der oft vergessene Polizeiminister Joseph Fouché. Er agierte im Schatten und wollte nie ins Licht der Öffentlichkeit vorrücken. Ihm reichte es zu wissen, welche Macht er in Händen hielt. Offizielle, pompöse, gar triumphale Machtbekundungen waren ihm zuwider.
So schaffte er es, all die Wirren der Französischen Revolution, des Kaiserreichs und der wiedererstarkten Bourbonen-Monarchie zu überstehen. Tatsächlich überlebte er diese aufregenden Zeiten nicht nur sondern ging am Ende auch als Millionär daraus hervor.
Wie aus einem kränklichen Kaufmannssohn, der ein kärgliches Leben als Mathematiklehrer in der Provinz fristete, erst ein Senator der jungen französischen Republik, dann ein Minister des Kaiserreichs und schließlich ein unvorstellbar reicher Herzog werden konnte und welche ungeheure Macht dieses Chamäleon der Politik in seinen Händen zu bündeln vermochte, zeichnet diese Biografie nach.
2 Am 2. Dezember 1804 krönte sich Napoleon selbst zum Kaiser der Franzosen und begründete so, das bis zu seiner Abdankung am 12. April 1814 bestehende erste französische Kaiserreich.
![]()
2. Ein kränklicher Lehrer aus der Provinz wird zum Vollblutpolitiker
Schon in jungen Jahren stellte sich Joseph Fouché für seine Eltern als Enttäuschung heraus. Als ältester noch lebender Sohn einer Familie von Kaufleuten und Seefahrern, ansässig in der Gegend um die Hafenstadt Nantes, sollte er, wie zu jener Zeit allgemein üblich, das elterliche Geschäft übernehmen. Doch dieser große, dünne und ausnehmend hässliche Junge war für keinerlei körperliche Arbeit geschaffen. Ganz besonders das Seefahrerhandwerk lag ihm überhaupt nicht. Kaum auf See litt er schon unter der Seekrankheit, was weite Handelsreisen ausschloss. Einem bürgerlichen Sohn standen in der Spätphase des Ancien Régime3 aber nur wenige Türen offen, wenn er nicht in die väterlichen Fußstapfen treten konnte oder wollte. Eine militärische Laufbahn schloss sich nicht nur aufgrund seiner körperlichen Konstitution sondern auch aufgrund der praktisch nicht vorhandenen Aufstiegsmöglichkeiten für Nichtadelige aus.
So blieb ihm nur die Kirche. Hier konnte man über Standesgrenzen hinweg Karriere machen, vorausgesetzt man war dazu bereit, sich ganz und gar der Mutterkirche zu verschreiben. Ein so intelligenter und vor allem arbeitsamer junger Mann wie Joseph Fouché hätte es weit bringen könne. Doch er konnte sich nicht dazu durchringen, den letzten Schritt zu gehen, das Gelübde abzulegen und sich weihen zu lassen. Grund dafür war aber keinesfalls eine ausgeprägte Libido, die ihn vor einem abstinenten Leben hätte zurück schrecken lassen. Er lebte auch ohne Weihe über zehn Jahre lang in mönchischer Askese zwischen engen Klostermauern und brachte seinen Schülern die Geheimnisse von Mathematik und Physik näher. Der Grund für seine Weigerung, den letzten Schritt zu gehen, lag tief in seinem inneren Naturell verborgen. Fouché konnte und wollte sich einfach niemals festlegen. Sein Leben lang ließ er sich immer auch andere Wege offen. Immer hatte er einen Fuß in der Tür seiner momentanen Gegner, um zu gegebener Zeit die Seiten zu wechseln.
Die langen, teils einsamen Jahre hinter Klostermauern, waren für Fouché aber keine verlorene Zeit, in der er weltfremd vor sich hin studierte. Vielmehr lernte er hier alles, was er für sein späteres Leben als Politiker brauchte. Im Kloster war er auf sich selbst zurückgeworfen und lernte, seine eigene Gesellschaft wertzuschätzen. Er brauchte niemanden um sich, wenn er nur Arbeit hatte, und arbeiten konnte er schnell, zielstrebig und effektiv. Viel wichtiger als seine Arbeitsethik war aber, dass er die anderen Menschen zu lesen lernte, während es ihm gleichzeitig gelang, die eigenen Gefühle vollkommen vor der Außenwelt zu verbergen. In den acht Jahren zwischen 1782 und 1790 wechselte er ganze fünf Mal die Lehrstätte und damit den Wohnort und auch das streng hierarchisch gegliederte soziale Umfeld. Vom Kolleg in Niort ging es nach Saumur, Vendôme, Juilly, Arras und schließlich zurück in die Heimat nach Nantes. Nach keinem dieser Wechsel hatte Fouché ein Problem damit, sich schnell wieder einzufügen. Vielmehr verstand er es, sich immer wieder beliebt zu machen. Besonders seine Lehrtätigkeit in Arras war für sein weiteres Leben von großer Bedeutung. Hier traf er einige der wichtigsten Protagonisten der kommenden Revolution, als diese noch nicht Todesurteile im Akkord sondern Liebesgedichte schrieben.
Seit den 1770er Jahren nahm die Zahl der geselligen Zirkel, in denen nicht nur den Künsten gehuldigt sondern auch die neuen Ideen der Zeit besprochen wurden, immer mehr zu. In einem dieser Zirkel mit dem Namen Rosati war der in den exakten Wissenschaften sehr bewanderte junge Priesterlehrer ein gern gesehener Gast. Er wusste immer wieder allerhand über die neuesten Entdeckungen in der Physik zu berichten und in dieser Zeit tat sich so einiges: So ließen die Gebrüder Montgolfier im Sommer 1783 in ihrer Heimatstadt Annonay den ersten Heißluftballon in Europa steigen. Damals hielten sie noch nicht die heiße Luft, sondern den Rauch für die nach oben treibende Kraft. Nur wenige Monate später am 19. September 1783 fand dann auch schon die erste Ballonfahrt mit Passagieren statt. Vor den Augen König Ludwigs XVI. und seiner österreichischen Gemahlin Marie Antoinette stieg eine sogenannte Montgolfière vom Rasen vor ihrem Schloss in Versailles in den Himmel auf. Als Besatzung saßen ein Hammel, ein Hahn und eine Ente in der Goldel. Mit ihrer rund zwölfminütigen Fahrt bewiesen die drei unfreiwilligen Luftfahrtpioniere zum ersten Mal, dass Luftreisen möglich waren.
In der im Nordosten Frankreichs an der Grenze zu den Niederlanden gelegenen Garnisonsstadt Arras mischten sich in den gesellschaftlichen Zirkeln Bürgerliche, Militärs und Adlige. Im Zirkel Rosati freundete sich Fouché schnell mit dem häufig unter Geldnöten leidenden Advokaten Maximilian de Robespierre an. Damals trug Robespierre gerne schwülstige Gedichte im Kreise seiner Freunde vor und legte noch großen Wert auf seinen Adelstitel. Die Beziehung zur Familie Robespierre war zu dieser Zeit so eng, dass Fouché beinahe Maximilians Schwester Charlotte heiratete, was aufgrund seiner Weigerung ein Priestergelübde abzulegen auch kein Problem gewesen wäre. Warum die Ehe schließlich doch nicht zustande kam, ist bis heute nicht klar aber zu einem sofortigen Abbruch der Freundschaft führte dies nicht. Dazu sollte es erst während der Revolution kommen. Zu behaupten, dass damals schon der Keim für die später bis aufs Blut ausgefochtene Feindschaft der beiden Männer gelegt wurde, wäre reine Spekulation. Jedenfalls lieh Fouché seinem Beinahe-Schwager auch danach noch das nötige Geld, als dieser Anfang 1789 als Abgeordneter zu den Generalständen nach Versailles berufen wurde. Diese vom König zuletzt 1614 einberufene Versammlung der drei Stände: des Adels, der Geistlichkeit und des als Dritter Stand bezeichneten Restes der Bevölkerung, sollte über wichtige Fragen des in Finanznöte geratenen Staates beraten. Nur mit Hilfe Fouchés konnte sich der damals noch stolze Adlige de Robespierre die Reise und die Kosten für einen neuen Anzug überhaupt leisten. Der Lehrer Fouché hatte das Kleingeld, weil er spartanisch lebte und schon damals einen inneren Widerstand gegen Luxus und Prunk in sich hatte, der mit seinem späteren Reichtum nicht nachließ, sonder statt dessen noch wuchs.
Mit diesem Darlehen wurde er zum ersten Mal zum Steigbügelhalter eines anderen. Eine Rolle die sich in seinem Leben noch wiederholen sollte.
Zu den illustren Gästen im Rosati-Zirkel gehörten neben dem bürgerlichen Fouché und dem adligen de Robespierre auch der Hauptmann im Geniekorps Lazare Nicolas Marguerite Carnot. Ein Pionier der Luftschifffahrt, der ein frühes Standardwerk zum Thema verfasste und wie die anderen beiden mit Beginn der Revolution schnell politisch aktiv wurde. Am 16. Januar 1793 sollte er, wie Fouché im Nationalkonvent4 gegen Robespierre stimmen und den Tod des Königs fordern. Im darauf folgenden Jahr stand er ebenfalls auf Fouchés Seite und half aktiv an der gewaltsamen Beseitigung Robespierres mit. Im weiteren Verlauf ähnelte seine Karriere dann der Fouchés. Er wurde genau wie dieser nach Napoleon Staatsstreich Minister, zog sich dann aber aus der Politik zurück und bekleidete erst während Napoleons Herrschaft der Hundert Tage wieder ein Ministeramt. Anders als Fouc...