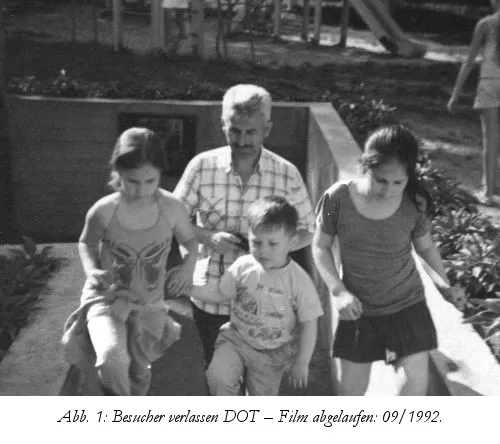![]()
Kriegsbericht – Teil 1
Der Kriegsbericht von Karl Krüger umfasst nur zweieinhalb Schreibmaschinenseiten. Er beginnt mit der Auflistung: „Meine mir noch bekannten Feldpostnummern“. Danach folgen Namen und Adressen von fünf Kriegskameraden und die „Adressen von Quartieren während des Krieges“, wie am Rand handschriftlich vermerkt ist. Es sind also nicht nur die Namen und Adressen der Kameraden, sondern auch die der Familien und Einzelpersonen, bei denen er während des Krieges untergekommen war. Danach folgen, Satz an Satz, Datum an Datum, kurz und knapp, die Stationen des Gefreiten, dann später Obergefreiten, Karl Krüger. Auf der Mitte der dritten Seite endet der Bericht mit den Sätzen: „Wir wurden dann auf einen Brückenkopf eingesetzt über eine Kettenbrücke kamen wir auf diesen Brückenkopf. Nach etwa 14 Tagen begann dann der weitere Vormarsch.“ Das letzte genannte Datum ist der 10.05.1942. An diesem Tag kam die 71. Infanterie-Division in Charkow, in der Ukraine an, schreibt Karl und vermerkt lapidar: „Die 71. Division kam bei der Kesselschlacht um Scharkow nicht mehr zum Einsatz.“ Übertitelt ist der Kriegsbericht jedoch mit der Zeitangabe „Vom 27.08.1939– 29.07.1945“. Warum endet hier der Bericht nach nur zweieinhalb Seiten im Mai 1942?
Im grauen Ordner, in dem dieser Kriegsbericht zu finden ist, ist auch ein einzelnes Kalenderblatt eingeheftet: Es stammt aus einem Wochenkalender der Firma Gieseke in Hannover, die bis heute mit Friseurbedarf handelt, und umfasst den Zeitraum zwischen den beiden Sonntagen 26. Januar und 1. Februar. Leider fehlt die Jahresangabe, die sich aber nach einigen Recherchen ermitteln lässt: Zwischen 1930 und 1993 fiel der 26. Januar genau zehnmal auf einen Sonntag. Schaut man sich nun das abgerissene Blatt noch einmal genauer an und bezieht die nicht beschriebene Rückseite in die Berechnung mit ein, so ist für den 28. Januar und den 4. Februar der Stand des Mondes eingetragen, zunehmender Mond und Vollmond. Legt man nun beides übereinander, so kann das Jahr eindeutig bestimmt werden: Das Kalenderblatt ist von 1958.
Hat er es noch im gleichen Jahr beschrieben oder war es ein alter Kalender, der erst später, in Ermangelung einer Alternative oder in einem Anflug von protestantischer Sparsamkeit, für den Kriegsbericht herhalten musste? Unwahrscheinlich, dass er ihn noch im gleichen Jahr, als der Kalender noch gültig war, nutzte. Vielleicht ein oder zwei Jahre später, das erscheint mir realistischer. Also 1959 oder 1960? Diese Datierung wirft dann aber neue Rätsel auf, denn wie hat er sich an all die exakten Daten und Adressen des Kriegsberichtes erinnern können, es waren ja mindestens dreizehn Jahre seit Kriegsende vergangen (wenn wir vom frühestmöglichen Jahr 1958 ausgehen). Irgendwo musste er das alles vorher schon einmal aufgeschrieben haben. Auf losen Zetteln? In einem Kriegstagebuch? Es findet sich in seinen Sachen leider kein Anhaltspunkt, der hier weiterführen würde. Hat er die ursprünglichen Aufzeichnungen nach dem Übertragen in den Kalender vernichtet? Wenn ja, warum? Hat er bei der Auswahl dessen, was er übertragen hat, aussortiert, gefiltert? Hatten die ursprünglichen Aufzeichnungen auch die Zeit von Mai 1942 bis zum Kriegsende 1945, so wie der getippte Bericht ja übertitelt ist, umfasst?
In einen solchen Spiralkalender, ein Werbegeschenk der Hannoveraner Firma, hatte Karl seinen Kriegsbericht (oder war das schon die zweite Version?) handschriftlich eingetragen, den eigentlichen Kalender einfach überschreibend. Das einzige schon erwähnte, noch erhaltene Blatt beginnt mit dem durchgestrichenen letzten Satz des getippten Berichtes: „[D]ann begann der weitere Vormarsch.“ Danach folgt: „In russischer Gefangenschaft ... Gottswalden (oder Gottswaldern) ... bei Luckenwalde.“ Das Wort „Gottswalden“ ist mit einem krakeligen Strich umkreist, der Stadtname „Luckenwalde“ mit ebensolcher Strichführung unterstrichen. Die nächsten sechs Tagesfelder enthalten keine Schrift; den ersten Februar ziert eine weitere Ortsangabe: „Jüterboch (oder Jüterbock)“ – gemeint ist wohl das bei Luckenwalde liegende Jüterbog. Den Rand hat Karl (in Gedanken versunken?) mit gleichmäßigen Strichen markiert. Jeder kurze Strich ein weiteres Ereignis, das dem unvollendeten Kriegsbericht später hinzugefügt werden sollte. Oder markieren diese Striche die Begebenheiten, die Karl bewusst ausgespart hat?
Das Tagesfeld vom 30. Januar ist mit zehn senkrechten kurzen Strichen, wie bei einer Addition, einer Aufzählung versehen. Zehn krakelig nebeneinander gesetzte Striche. Auf das Durchstreichen der ersten vier mit dem fünften hat er verzichtet, also doch keine Zählreihe? Das Wochenkalenderblatt weist ein paar weiter unzusammenhängend scheinende, scheinbar wahllos hingekritzelte Striche auf. Es scheint ziemlich offensichtlich, dass Karl irgendwann später die handschriftlichen Kalenderseiten abtippte und dabei das schon Erledigte durchstrich. Der getippte Kriegsbericht ist also – höchst wahrscheinlich – erst sehr viel später entstanden. Ich erinnere mich selbst noch an den Kalender als Ganzes. Ich erinnere mich, wie Karl ihn mir zeigte, aus ihm vorlas, erklärte. Vielleicht war es ja sogar mein eigenes Interesse, dass ihn – es muss wohl irgendwann Mitte der 1980er-Jahre gewesen sein – dazu bewegte, das Ganze nochmal in Reinschrift zu bringen. Vielleicht konnte er sich zu diesem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr an das erinnern, was er bei der ersten handschriftlichen Niederschrift ausgelassen hatte. Wenn, dann sicherlich nur noch bruchstückhaft. Und wollte er das überhaupt, sich erinnern an diese letzten drei Kriegsjahre: Mai 1942 bis Mai 1945?
1958. In diesem Jahr, im September, war Karl Krüger vierundvierzig Jahre alt geworden. Ein guter Zeitpunkt für eine Rückschau, ein Resümieren, ein Nachdenken über Erlebtes? Verarbeitung, Verklärung, Vergessen. Fragen gehen mir durch den Kopf: Warum schreibt man einen Kriegsbericht? (Und dann noch einen, der mehr an ein Itinerar erinnert, Narratives fast völlig auslässt.) Für die Nachwelt? Weil einem die Traumata des Krieges täglich aufs Neue begegnen? Für seine(n) Enkel? Und wieder: Warum lässt man dann das ‚Spannendste‘, den Vormarsch auf Stalingrad, den totalen Krieg, den Untergang aus? Weil es zu traumatisch wäre, darüber zu schreiben? Weil es unmöglich ist, den Stift anzusetzen und das Unsagbare zu sagen? Warum? Was ist da passiert?
Ich versuche, in den Menschen Karl Krüger hineinzuschauen, mich in ihn hineinzugraben. Je tiefer ich vordringe, desto mehr Rätsel gibt er mir auf.
„Ab August 1942 setzte die 71. Infanterie-Division über den Don, nahmen Karpowka und Rossoschka, bis sie schließlich Stalingrad erreichte. Hier wurde die Division im Januar/ Februar 1943 vernichtet.“ So das Ende eines Kampfberichtes aus dem Internet.
Und dabei fing doch alles so gut an. Verfolgt man die Wegstrecke der ersten drei Jahre, liest sich der Bericht – und ich nehme hier die mündlichen Berichte meines Großvaters an mich als seinen Enkel hinzu – eher wie die Abenteuerreise eines 23-Jährigen: Eingezogen im August 1938, zugeteilt einer Nachschubeinheit, von da nach Kaiserslautern, dann Pirmasens zur Bewachung eines Munitionslagers am Westwall. Weiter, Ende des Jahres, nach Ruschberg bei Marnheim in Rheinland-Pfalz, Niederkirchen, Grumbach und dann Kompaniefriseur (!) in Niederkirchen bei Deidesheim, eine wunderbare Weingegend nebenbei. Vom 18.12.1939 bis 01.01.1940 Heimaturlaub. Weihnachten zu Hause – und das in Kriegszeiten. Dann beginnt der Westfeldzug. Karl schreibt: „Über die Luxenburger Grenze am 12.05.1940 morgens um 6 Uhr Über die Belgische Grenze am 14.05.1940.“ Mir ist beim Lesen und wiederholten Lesen der Zeilen, als könnte ich die Euphorie des jungen Soldaten spüren, als könnte diese euphorische Stimme hier zu mir, in das Jahr 2014, in all ihrer Intensität vordringen und sagen: „Endlich passiert etwas! Endlich geht es los! Auf dem Vormarsch in Frankreich!!!!!“ – fünf Ausrufezeichen. Diese fünf, mit aller Wucht tief in das Papier geschlagenen Ausrufezeichen stehen so da, obwohl mindestens zehn Jahre nach Ende des Krieges getippt. Was es für einen 1914 geborenen jungen Deutschen bedeutete, in Frankreich einzumarschieren, können wir uns heute kaum noch vorstellen. Als Kind seiner Zeit, geprägt von der überall vorherrschenden Propaganda, muss er sich als Teil einer historischen Großtat gefühlt haben. Endlich überwindet Deutschland die „Schmach von Versailles“, zahlt es dem Erbfeind heim. Er muss begriffen haben, dass er Teil eines großen historischen Ereignisses war. Der einfache Soldat, Karl Krüger aus Bierbergen, dessen Vater nichts weiter als ein Arbeiter war, machte Geschichte oder war zumindest dabei, wenn sie gemacht wurde. Ist ihm wirklich dieser Stolz als kalter prickelnder Schauer den Rücken heruntergelaufen? Auch noch als er den Kalender abtippte? Oder hatte sich seine Wahrnehmung und Bewertung dessen, woran er beteiligt gewesen war, gewandelt? Ich glaube, er war da hin- und hergerissen. Hin- und hergerissen zwischen der Euphorie seiner Jugend und der Belehrtheit des Älteren, des Nachkriegsdeutschen.
Die Stationen des Vormarsches in Frankreich sind durch je zwei Schrägstriche „//“ voneinander abgesetzt. Das wirkt fast modern, expressionistisch, auf jeden Fall setzt sich so die Geschwindigkeit der fünf Ausrufezeichen ungebremst fort: Mouson // Stenay // Verdun // Saint Mihiel // Nancy. Stakkatohaft // Trommelfeuer: Assoziationen. Hier läuft es mir kalt den Rücken herunter. Bei seinen Unterlagen findet sich auch ein etwa DIN A6 großer vergilbter Pappzettel, versehen mit der handschriftlichen Notiz: „Vormarschweg in Frankreich 71. Division“. Zu sehen ist eine Karte der Region zwischen Luxemburg, Verdun und Nancy mit der verzeichneten Marschroute, links daneben ein Text in der zeittypischen Fraktur, überschrieben mit „Soldaten!“, unterschrieben mit „Es lebe der Führer!“, vom Kommandeur der Division Karl Weißenberger. Auch hier spürt man noch einmal die Euphorie: „Ihr habt das Panzerwerk 505 erstürmt und die Höhe 311 erobert. Damit habt ihr als erste deutsche Truppe die eigentliche Maginotlinie durchbrochen.“ Die Division wurde später „Die Glückliche“ genannt, ein Kleeblatt ihr Symbol – das Glück verließ sie dann spätestens in Stalingrad. Zumindest wenn man 90 Tote, 446 Verletzte und 17 Vermisste aus den eigenen Reihen bei der Erstürmung des besagten Panzerwerkes noch unter ‚glücklich‘ verbuchen mag.
Im Folgenden berichtet Karl immer wieder von seinen Quartieren. „Berichtet“ ist zu viel gesagt, er zählt sie auf. Mir, als Nachgeborenem, war völlig unbekannt, dass Soldaten, die ja sozusagen in offiziellem Auftrag unterwegs waren, so oft privat untergebracht waren: „einqwartiert“, wie es Karl schreibt. Einquartiert mit Familienanschluss, so suggerieren es jedenfalls die Aufzeichnungen: „ich wohnte bei einer Familie Stoffel [...] in Mamer auch in Luxenburg vom 08. bis 10.10 1940 auch in privat Qwartieren untergebracht.“ Später hielt er sich im sächsischen Laußnitz auf, dann die letzte verzeichnete private Unterbringung bei einer Familie Bergmann. Die Beziehung zu den Bergmanns scheint eine intensivere gewesen zu sein. Im Nachlass finden sich zahlreiche Briefe an und von den Bergmanns – und dies bis in die späten 1960er-Jahre hinein.
Nach den Bergmanns in Sachsen begann für Karl Krüger der lange Marsch gen Osten. Erst mit dem Zug, dann zu Fuß, ab und an auf Lastwägen quer durch das südliche Polen in Richtung der heutigen Grenze zur Ukraine. Ich gebe die im Bericht aufgelisteten Städtenamen ein und berechne dank Google Maps die Länge der Reiseroute – einige der Straßen hat es wohl damals nicht gegeben, einige Städte der Route musste ich auslassen, weil ich sie einfach nicht gefunden habe –, runde 1.700 Kilometer sind es aber dennoch von Pulsnitz, dem letzten Ort auf deutschem Boden, bis Kiew. Die Reise ging über Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów – ich stutze und sehe, wie nah die Stadt Rzeszów an Lublin liegt, die Mutter meiner Tochter ist dort groß geworden, ich selbst war mehrmals dort. Von dort geht es, in der Nähe von Lubaczów, weiter über die Grenze in die damalige Sowjetunion. Am 18.07.1941 wurde Schytomyr erreicht. Nicht nur mein Großvater erreichte am 18. Juli die 300.000-Einwohner-Stadt, 120 Kilometer westlich von Kiew, am gleichen Tag schlug auch der Stab der berüchtigten Einsatzgruppe C sein Quartier in Schytomyr auf. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes waren ideologisch geschulte Spezialkräfte, die direkt für die Ermordung von Juden, Kommunisten, Roma und Sinti, psychisch Kranken und anderen unerwünschten Personengruppen eingesetzt wurden. Die Vorgehensweise dieser Truppen muss so grauenhaft gewesen sein, dass sich der Generalstabsoffizier des eingesetzten 51. Armeekorps, Robert Bernardis, der Operation Walküre anschloss. Für die Teilnahme am Hitlerattentat wurde er im August 1944 in Plötzensee hingerichtet. Es ist überliefert, dass direkt hinter den vorrückenden Panzern der Wehrmacht drei Lastwagen der Einsatzgruppe in die Stadt einrückten. Kurz darauf wurden alle Juden von Schytomyr ermordet. Kann man am 18. Juli als Wehrmachtssoldat in Schytomyr einmarschiert sein und nichts davon mitbekommen haben? Kann man ein Leben führen, einen Friseursalon eröffnen, zwei Töchter großziehen, ein guter Großvater sein, ohne je darüber gesprochen zu haben? Oder hat er darüber gesprochen? Mit seiner Frau Toni? Unwahrscheinlich. Mir jedenfalls wollte er nichts, besser ‚fast‘ nichts, darüber erzählen.
„Stellungskrieg vor Kiew 07.08 bis 24.08.1941“ (Kriegsbericht, Karl Krüger, S. 2)
![]()
Stadt der Helden
Ich sitze im sogenannten Zentral-Park in Gyumri, der westlichsten Stadt Armeniens, direkt an der geschlossenen Grenze zur Türkei und schreibe in mein rotes Notizbuch. Es ist schon fast zwei Wochen her, dass ich in der Ukraine war. Ich hatte dort, in einem sowjetisch anmutenden Plattenbauhotel, mit meiner Kollegin Elena ein Training zum Thema Geschichtsaufarbeitung und Oral History gegeben und danach den anschließenden freien Samstag genutzt, um in eigener Sache Nachforschungen anzustellen …
Alexej trifft uns um 8:30 Uhr morgens vor dem zwölfstöckigen Plattenbau in dem Elena wohnt. Eigentlich sollte uns Pawel treffen. Beide, Alexej und Pawel, kenne ich schon von unserem Training. Sie sind Hobby-Historiker und beschäftigen sich mit der Geschichte der Belagerung Kiews im Zweiten Weltkrieg. Leider tun sie dies auf reichlich unkritische Art und Weise: Bei der Exkursion, die wir gemeinsam mit ihnen und den Teilnehmern des Trainings gemacht hatten, hinterließen sie einen reichlich militaristischen Eindruck. Wir besichtigten mit ihnen den Verteidigungswall, den die Sowjets in den zwanziger Jahren um Kiew gelegt haben, damals noch um eine mögliche Invasion der Polen abzuwehren. Erstmals genutzt wurde diese aus hunderten kleinen Vier-Mann-Bunkern bestehende Anlage aber im Jahr 1941 gegen die Deutschen. Die einzelnen Bunker nennt man auf Russisch „DOT“, was eine Abkürzung für Долговременная Огневая Точка ist und auf Deutsch in etwa „Langzeit-Feuer-Position“ heißen könnte. Wir besuchen auch das Grab eines unbekannten sowjetischen Soldaten, den Pawel und seine Freunde am Rande der Haupteinfallstraße gefunden hatten.
Aus dem einfachen Grab ist mittlerweile ein farbenfrohes Mahnmal geworden: Als man den Toten ausgrub, kamen die auf der anderen Straßenseite in kleinen Datschen lebenden Anwohner herüber, interessierten sich und ein Dialog zwischen ihnen und Pawels Gruppe entstand. Einer von ihnen mauerte einen steinernen Ring um das Grab, ein anderer setzte einen Stein; man beschriftete ihn, pflanzte Blumen und schattenspendende Bäume und begann, sich um das Grab und die Geschichte des dort bestatteten Soldaten zu kümmern.
Der Boden in den westlichen Vororten von Kiew trägt noch immer die Überreste unzähliger noch unentdeckter und nicht identifizierter Toter deutscher und sowjetischer Herkunft. Bei ihren Recherchen zum DOT-System gräbt Pawels Gruppe fast jeden Monat einen von ihnen aus: Ist es ein Deutscher, so verständigen sie die Kriegsgräberfürsorge, die den Gefallenen dann auf einen der großen deutschen Friedhöfe rund um Kiew umbettet. Manchmal kommen die Verwandten des Toten, um dem siebzig Jahre zu späten Begräbnis beizuwohnen, immer öfter kommt aber niemand. Nach dem Grab des unbekannten Soldaten besuchen wir eine Reihe weiterer DOTs, kleine halb in die Erde versenkte Schießstände.
Durch vier dünne Schlitze wurde auf die nahenden deutschen Faschisten aus wassergekühlten Maschinengewehren geschossen. Ein fünfter Mann bediente das Teleskop in der Mitte des ca. 20 Quadratmeter großen Betonwürfels. Zielen konnte man durch die engen Schlitze nicht. Der Teleskopmann, vielleicht auch eine Frau (!), ordnete nur an, welches der vier MGs zu schießen hatte. Erobert wurden die DOTs über ihre einzige Schwachstelle: das Teleskoprohr. Die Deutschen schlichen sich an, gelangten unter erheblichen Verlusten irgendwie auf das Dach des Bunkers, sprengten den Stahldeckel des versenkbaren Teleskops ab und warfen ein oder zwei Granaten in die Öffnung. Des ‚Augenlichtes‘ so beraubt wurde das DOT dann gestürmt und von den Eroberern übernommen. Vor einem dieser Bunker hat die Gruppe Schautafeln aus bedruckter LKW-Plane aufgestellt. Auf ihnen wird in russischer und ukrainischer Sprache die militärtechnische Seite der Anlage erklärt. Darüber hinaus zeigt eine der Tafeln Bilder von deutschen Soldaten, die Pawel oder jemand aus seiner Gruppe aus dem Internet heruntergeladen hat. Auf einem dieser Bilder sieht man deutsche Wehrmachtsangehörige der 71. Infanterie-Division: Sie haben sich vor dem DOT, vor dem auch unsere Gruppe gerade steht, für die Kamera aufgestellt. Der Bunker auf dem Foto ist an mehreren Seiten durch Granateinschläge schwer beschädigt, die Tür ist herausgerissen und eine entrückt daliegende Leiche eines Soldaten der Roten Armee liegt etwa 5 Meter vor dem Eingang zum Bunker. Die drei deutschen Soldaten lächeln in die Kamera.
Heute befindet sich dieser Bunker innerhalb einer in der Chrustschow’schen Zeit gebauten Vorstadtsiedlung: Etwa zehn planmäßig angeordnete, mittlerweile halb verfallene zweistöckige Mehrfamilienhäuser rahmen den Bunker ein, unmittelbar neben ihm ein Kinderspielplatz mit Rutsche und Schaukel. Auf einer Bank sitzen die Alten der Siedlung und schauen dem Treiben im und um das DOT zu. Am Ende der Führung, die Pawel mit viel militärhistorischem Wissen anreichert, spielt ein Alter, der wohl zu Pawels Gruppe gehört, selbstgeschriebene und sowjetische Lieder auf dem Schifferklavier.
Spätestens jetzt habe ich gemischte Gefühle, was den Charakter der Exkursion betrifft. Ich stelle mir die Frage, was eigentlich die Ziele und Überzeugungen dieser Hobby-Historiker sind: Historische Überreste wie diese DOTs, nostalgische Gesänge, technische Daten über die Schussfähigkeit der Maschinengewehre usw. usf. Aber was erwarte ich eigentlich von einer solchen Gruppe hier in Kiew, einer Stadt, die sich an ihrem Eingang selbst „Stadt der Helden“ nennt? Und waren es nicht auch Helden, diese Männer und Frauen in der Roten Armee, die Europa vom Faschismus befreiten?
Es ist mitnichten so, dass die Gruppe irgendetwas Negatives über die deutschen Soldaten sagt: Ihre Gräueltaten, Babi Jar oder das Massaker in Schytomyr, um nur zwei von Deutschen vor Kiew begangene Großverbrechen zu nennen, werden gar nicht erwähnt. Niemand wirft mir – als Vertreter der deutschen Seite, als der ich hier, ob ich es will oder nicht, zweifelsohne angesehen werde – irgendetwas vor. Ganz im Gegenteil: Die Männer rund um Pawel bewundern die Soldaten des Weltkriegs. Diese Bewunderung gilt nicht nur den eigenen, sondern auch den deutschen Soldaten, und dies, obwohl Wehrmachtsangehörige und Sondereinheiten auf brutalste Art und Weise mehrere 100.000 Zivilisten abschlachteten. Der Kern dieser Bewunderung hat, so glaube ich zumindest, etwas mit dem Männlichkeitsbild dieser Ukrainer zu tun: Was waren das damals als Mann noch für gute Zeiten, als ein Mann noch ein Mann sein konnte – es Dinge gab, für die es sich zu töten und zu sterben lohnte. Die Jetztzeit mit all ihren verwischten Grenzen und Unklarheiten überfordert sie; sie sehnen sich zurück nach einer – in ihren Augen – einfacheren Zeit.
Wir fahren weiter zum letzten DOT unserer Seminarexkursion: In einem Waldstück, etwa ein Kilometer entfernt von der großen Magistrale, liegt ein weiterer Bunker mit einem langen unterirdischen Gang unter einem künstlich angelegten Hügel. Randalierer haben das Hinweisschild auf DOT Nr. 179 in den Graben geschmissen. Ich mache ein Foto vom selbstgemachten Schild, ein angenagelter pfeilförmiger Wegweiser ist mit „DOT 179“ beschriftet, der andere, in die entgegengesetzte Richtung zeigend, mit „Zur Frontlinie“. Wir gehen auf eine Lichtung zu, und ich erkenne schon vom Weiten, dass sich mehrere Personen in ungewöhnlicher Kleidung vor dem Bunkereingang aufhalten. Mein Verdacht erhärtet sich, als ich näherkomme: Dort stehen ein sowjetischer und ein deutscher Soldat in Originaluniform mit zeittypischer Bewaffnung. Sie empfangen uns mit einem Lachen und laden zu einem Gruppenfoto ein. Ich soll unbedingt den Wehrmachtssoldaten mit Handschlag für ein Erinnerungsfoto begrüßen; ich entscheide mich dies nur mit dem Sowjetverkleideten zu tun. „Ich gebe Faschisten nicht die Hand“, bemerke ich – eine Äußerung, die unkommentiert bleibt.
Dann muss der unterirdische Gang durchlaufen werden. Pawel erklärt uns, dass sie dieses Programm regelmäßig mit Schulklassen durchführen. Um zu zeigen, wie unerträglich laut es für die Bunkerbesatzung im Krieg war, schießen sie mit Platzpatronen im Bunker-Inneren herum. Vor dem Schießen gibt es noch die Empfehlung, doch den Mund geöffnet zu halten, dann sei die Druckwelle weniger gefährlich. Ich erkläre, dass ich schon einen Tinnitus hätte – was nichts als die absolute Wahrheit ist – und dankend auf die Rundtour verzichte. Schnell wird mir aber klar, dass dies ein unmögliches Verhalten ist. Also folge ich der Gruppe, die Finger in die Ohren gesteckt, leicht geduckt, in das Innere des dunklen Tunnel-Labyrinths. Irgendwann schießt der als Rotarmist Verkleidete: Die Druckwelle lässt mein Hemd flattern, aus der Gruppe sind Schreie zu hören. „Was für ein Quatsch!“, denke ich, als ich wieder frische Waldluft atme.
Ich möchte das Kriegsspielgelände nun wirklich zügig verlassen, verweise auf die reichlich fortgeschrittene Uhrzeit und dass wir morgen ja alle früh raus müsst...