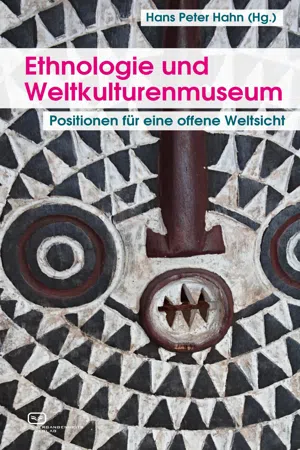![]()
Museum als ethnologische Methode?1 Zeitgeschuldete Betrachtungen
Thomas Laely
Nachdem Rolle und Bedeutung von ethnologischen Museen in den letzten Jahren immer wieder von Museumsseite diskutiert wurden, ist es ebenso aufschlussreich, einmal umgekehrt von der akademisch-ethnologischen Seite her an die Frage der jüngeren Entwicklungen der Beziehungen zwischen der Ethnologie als universitärer Fachdisziplin und Museen zu ihrem Gebiet heranzugehen, um zu prüfen, wie ethnologisches Wissen und inwieweit aktuelle ethnologische Themen die Arbeit der Museen bestimmen. Diese Frage ist von besonderer Relevanz für jemanden, der wie der Autor dieser Zeilen selbst an einem Universitätsmuseum arbeitet, einer in den letzten Jahrzehnten zurückgedrängten und erst in jüngster Zeit wieder vermehrt in das öffentliche Blickfeld gerückten Form von Museum. Auf der Grundlage eines kurzen Abrisses der Geschichte der Beziehungen zwischen Fachdisziplin und ethnologischem Museum soll der Versuch unternommen werden, zu prüfen, wieweit in den letzten zwanzig Jahren neuere museologische Ansätze auf diese Beziehungen eingewirkt haben. Wie sind neue inhaltliche Ausrichtungen zu verstehen? Und was steht hinter den in dieser Zeitspanne zumal im deutschsprachigen Raum verbreiteten Neubenennungen ethnologischer Museen?
Der in den letzten Jahren zunehmende Druck, aber auch eigene Anspruch auf Aktualisierung der Museen hat mehr Positives denn Negatives bewirkt. Ohne die Tendenzen zu verstärkter Ökonomisierung, Eigenmittelerwirtschaftung, Event- und Erlebnishaltung und Kommerzialisierung kleinreden zu wollen, bewirkten die erhobenen Forderungen und Ansprüche auf Öffnung der Museen gegenüber breiteren Gruppen der Öffentlichkeit und (teils tatsächlich) neuen Interessen- und Anspruchsgruppen, dass die ethnologischen Museen sich verstärkt zu hinterfragen begannen, ein Aufbruch, der durch die „Neue Museologie“2 gestützt, wenn nicht angetrieben wurde. Wieweit dazu allerdings auch eine Öffnung und Aufnahmebereitschaft in Richtung Forschung und Wissenschaft, nicht zuletzt bei den nicht (mehr) universitären Museen gehört, bleibt in Zeiten einer stärker wirtschaftlich verpflichteten Museumswelt fraglich. Wie weit ist es damit, und welche Formen und Ergebnisse sind davon erkennbar?
In den letzten Jahren wurde in der ethnologischen Museumswelt vermehrt beklagt, dass ihre Museen mit dem Kolonialerbe gleichgesetzt und Forderungen nach dessen Aufarbeitung gleichsam automatisch an die ethnologischen Museen delegiert werden. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass damit die Gefahr verbunden ist, das Problem damit wenn nicht entsorgt, so doch artig versorgt zu haben. Es zeigt sich aber, dass damit weitere Gefahren verbunden sind. So sieht etwa Claus Deimel in einer ausführlichen, kritischen Rezension der von Februar bis Mai 2016 in dem bis wenige Jahre zuvor von ihm geleiteten GRASSI Völkerkundemuseum Leipzig gezeigten, seitens Angehöriger der Hochschule für Grafik und Buchkunst kuratierten Ausstellung „fremd“, die eine künstlerische Dekonstruktion und Neuinterpretation von Teilen der Dauerausstellung zum Ziel hatte, nicht nur eine Denunziation der früheren kuratorischen Arbeit, sondern eine radikale Infragestellung der Kompetenz der Ethnologie allgemein (2016a:273). Er sieht eine „Rhetorik des Verdachts gegenüber der Ethnologie und dem Völkerkundemuseum“ um sich greifen, was breitere kulturelle und kulturpolitische Folgen haben könnte – was „als Kampfansage an die Ethnologie beginnt“, könnte tendenziell zu einer „ikonoklastischen Revolution“ führen und sich gegen Museumseinrichtungen allgemein richten (ebd., 2016a:264ff).
Seit den 1920er-Jahren und trotz wieder vermehrtem Interesse in der Ethnologie an Kunst und materieller Kultur entfernte sich die akademisch-ethnologische Fachdisziplin von ihrer ursprünglichen Grundlage, dem Museum als Forschungsressource. Wenn es auch diskutabel ist, inwieweit die Museen tatsächlich „the institutional homeland of anthropology“3 darstellten, so waren sie zumal in Europa für die Ethnologie eine wichtige Ausgangsbasis. Die Museen bleiben bis heute eine der wichtigsten Schnittstellen der Ethnologie bzw. anthropology gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit. Das anhaltende öffentliche Interesse an den Museen ist allerdings nicht als Gegenbewegung zur Abkehr der akademischen Ethnologie, sondern vielmehr als Teil des allgemein erhöhten Zuspruchs gegenüber Museen zu verstehen. Wenn der australische Ethnologe und Leiter eines (universitären) Museums, Nicholas Thomas, argumentiert, dass ethnologische Museen eine bedeutend größere Anzahl Interessierte als zum Beispiel ethnologische Fachbücher oder Filme finden (2010:6), so gilt das allerdings nur für einige der großen Museumsflaggschiffe. Das Interesse an ihnen hat nicht nur mit der Ethnologie zu tun oder der Völkerkunde, ist man hier geneigt festzustellen, sondern schreibt sich in eine breitere, oft beschriebene Tendenz ein: Museen haben eine neue Vitalität gefunden.4
Wie nun verändert diese Trendwende, in der die ethnologischen Museen weniger in der akademischen Ethnologie und verstärkt auf dem Gebiet des öffentlichen Engagements bis in den Tourismus und Innenstadt-Regenerierung5 eingebettet sind, die Arbeit und das Selbstverständnis der Kuratierenden der ethnologischen Sammlungen? Welches Wissen lässt sich über die Arbeit mit den Sammlungen generieren, aufgrund welchen Wissens werden sie interpretiert? Von welchen Methoden wird dabei ausgegangen? Und wie können und sollen die ethnologischen Sammlungen heute ausgestellt werden?6
Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Fachdisziplin und Ethnologischem Museum
Ende des 19. Jahrhunderts begannen die europäischen Museen, gezielter zu sammeln und vermehrt eigene wissenschaftliche Expeditionen zu finanzieren und auszusenden. Zur Geschichte und Herkunft der Sammlungen der europäischen ethnographischen Museen ist wichtig zu sehen, dass diese oft auf vormals fürstliche oder kirchliche „Kabinette” und „Wunderkammern“ zurückgingen oder aus Sammlungen von Privatgelehrten, früheren wissenschaftlichen Gesellschaften oder von internationalen (Welt-)Ausstellungen übernommen worden waren.
Wenn die „Kunstkammern“ zwischen „Jahrzehnten teilweise zufälligen Sammelns“ (Barraud Wiener/Jezler 1994:773) und enzyklopädischem Sammlungsanspruch schwankten, so ist gleichzeitig Folgendes zu beachten: „Galten Kunstkammern […] als Ausdruck skuriler Sammelleidenschaft […], so haben neuere Forschungen das Bild korrigiert. Sie haben nicht nur gezeigt, welch hoher Konzeptionsgrad Kunstkammern als Abbilder des Kosmos eigen sein konnte und welch wichtige Rolle ihnen als Herrschaftsinstrumente zukam; deutlich gemacht wurde auch, wie wichtig die Kunstkammer im Prozeß der Naturaneignung und der Ausdifferenzierung der Wissenschaften gewesen ist“ (ebd. 1994:763).7
Die Sammelexpeditionen erlaubten einen kontrollierten und besser dokumentierten Erwerb und Aufbau wissenschaftlicherer Sammlungen. Noch 1931-1933 kam es im Auftrag des Pariser Musée du Trocadéro zur vielzitierten Dakar-Djibouti Expedition, während der 3500 Objekte zusammengetragen wurden; diese wie auch die ebenso bekannten sechs Sammlungsreisen Leo Frobenius’ für verschiedene deutsche Museen zwischen 1904 und 1914 setzten den ‚besammelten‘, nicht selten auch: beraubten Gesellschaften arg zu, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Nach einer groben Schätzung Sturtevants (1969:640) befanden sich Mitte der 1960er-Jahre weltweit 4,5 Millionen ethnographische Objekte in den Museen. Hinter diesem breit ausgreifenden Sammeln stand u. a. die sogenannte salvage anthropology/ethnography, welche die materielle Kultur vermeintlich „pristiner“ Gesellschaften vor dem Untergang retten wollte.
Dabei lassen sich zwischen Deutschland und Großbritannien auf der einen Seite und Nordamerika auf der anderen unterschiedliche Forschungs- und Sammlungstraditionen sowie Sichten auf die Universalgeschichte erkennen. Unter Franz Boas’ Einfluss kam es zu einer Verschiebung von evolutionistischen Schemen, morphologischen Interessen und Kulturkreis-Ansätzen hin zu kulturrelativistischen und funktionalistischen Sichtweisen – vom Interesse an der Form hin zu dem an Funktion und Bedeutung. Mit der bald über die USA hinausgehenden Zurückweisung des evolutionistischen Paradigmas nahm das Interesse an ethnographischen Sammlungen stark ab und wurden die Museen marginalisiert. In Frankreich verlief die Entwicklung anders und waren die Museen noch länger im Zentrum neuer wissenschaftlicher Ansätze und Entwicklungen.8
Shelton hat wie andere darauf hingewiesen, dass es vor allem der Aufstieg der funktionalistischen Ethnologie Radcliffe-Brown’scher Prägung seit den 1920er-Jahren war, in deren Gefolge die materielle Kultur zu einem primär beschreibenden Anhang ohne interpretativ-analytischen Wert relegiert wurde. Den Museen wurden Studien zur materiellen Kultur überlassen, die meist kaum mehr als Beschreibungen technischer Prozesse waren, losgelöst von interpretativer, kritischer Forschung. Auf der anderen Seite war es gerade dieses Desinteresse des akademischen Faches an den Museen, was diese in die Lage versetzte, bis in die 1950er-, ja 60er-Jahre hinein evolutionistisch geprägte Ausstellungen zu zeigen und ihre überkommenen Ausstellungsauslagen kaum verändert stehen zu lassen (2012:72).
Erst in den 1960er-Jahren begannen die ersten Museen, ihre evolutionistischen Vitrinen neu nach einer breiten „funktionalistischen“ Sichtweise zu arrangieren. Wobei dieses Mal die materielle Kultur nur von sekundärer Bedeutung war und zur Illustration funktionalistischer Thesen diente (Masken zur sozialen Kontrolle, die integrative Funktion von Gabentausch, etc.). Zu dieser Zeit allerdings war der Funktionalismus in Wissenschaftskreisen bereits überholt. Shelton (ebd.) meint, dass sich der intellektuelle Niedergang der Museumsethnographie nirgends stärker zeigte als in den überlangen Zeiten, bis neue akademische Narrative in der Ausstellungspraxis aufgenommen wurden.
Sammeln im Feld wurde bis in die 1980er-Jahre vernachlässigt, da es immer noch im Zusammenhang mit einer salvage ethnography verstanden wurde (vgl. Sturtevant 1969:632f). Erst in den ausgehenden 1980er-Jahren wurde Sammeln vor Ort mit dem neuen Interesse an eben nicht nur verschwindender oder unter der Globalisierung homogenisierter, sondern hybridisierter Materialkultur wieder als Museumsaufgabe aufgewertet – so trug der Afrikanist Malcolm McLeod innerhalb weniger Jahre für das British Museum über 20.000 neue Stücke zusammen. Auf der Website des British Museum liest man unter „History and Development of the Department of Africa, Oceania and Americas“ dazu Folgendes:
„After the appointment of Malcolm McLeod (keeper, 1974–1990), the focus of collecting became more defined. Emphasis was placed on trying to fill gaps in the collection, wherever possible, through fieldwork. This was intended to properly record changing contemporary indigenous societies and to form the basis of future exhibitions and collaborations with originating communities.“9
In den USA waren die Museen ab etwa 1920 bis in die 1970er-Jahre durch einen intellektuellen Aderlass geprägt – Anstellungen an Museen verloren an Prestige und die meisten Forschungsgelegenheiten verlagerten sich zu den Universitäten. Forschung wurde stark vernachlässigt, so dass Sturtevant Ende der 1960er-Jahre schreiben konnte, dass bis 90 Prozent der Sammlungen an US-Museen unerforscht waren (1969:632, vgl. Shelton 2012:72). Vergleichen wir dazu die Situation, die ich während meines Studiums Ende der 1970er-Jahre in Zürich antraf: Während das ethnologische Institut einen Aufbruch und neue Forschungsfelder bot, galt gleichzeitig das Völkerkundemuseum der Universität als wenig neuerungsfreudig – es blieb zwar in das Institut eingebunden, die Beziehungen aber waren von beiden Seiten her angespannt, die durch das Museum als Teil des Ethnologischen Seminars gebotenen Möglichkeiten wurden nur partiell aufgenommen.
Und dann kam es in den 1990er-Jahren zu einem Wiederaufleben der Material Culture Studies und der Anthropological Museology. Gerade in Nordeuropa und Großbritannien erlebten die ethnographischen Museen in den 1970er- bis 1990er-Jahren einen Neuaufbruch – vermehrt wurden ‚kontextualisierte Ausstellungen‘ erstellt, die mit elaborierten Szenographien den physischen Kontext der gezeigten Sammlungsobjekte rekonstruierten – dazu wurden auch Handwerker ins Museum geholt, die indigene Herstellungsprozesse demonstrierten. Gleichzeitig wurde der Einbezug der Herkunftsgemeinschaften gesucht, möglich gemacht durch neue Feldforschungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Ethnologen. Ganz grundsätzlich wurden Ausstellungsweisen und -anlagen sowie die konventionelle Unterscheidung zwischen zeitgenössischer und ‚traditioneller‘ Kunst oder Ethnographika hinterfragt.10
Öffnung unter neuen Ansätzen?
Infolge neuer museologischer Ansätze und allgemeiner Erneuerungsbereitschaft der Museen („Neue Museologie“) begann in den 1990er-Jahren die universitäre Ethnologie dem Museum neue Aufmerksamkeit zu schenken. Gleichzeitig reagierten die ethnographischen Museen auf die zunehmende Kritik mit verschiedenen Haltungen und Strategien. Die einen nahmen sich stärker der Geschichte ihrer Sammlungen und der Sammler an, während andere sich einer impliziten oder expliziten Ästhetisierung ihrer Ausstellungsweise zuwandten, die sich Kunstausstellungsauslagen annäherte.11 Einige wie das Tropenmuseum in Amsterdam wiederum verzichteten selbst auf ästhetische Effekte. Dazwischen gab es Museen, die eine ästhetische Präsentation wählten, dabei aber ihre Auslagen weiterhin nach ethnologischen Kategorien gliederten.12
Die heftigen und inzwischen weitgehend überkommenen Debatten über die Verdienste ästhetischer Ansätze für ethnographische Ausstellungen sind hier nicht das Thema – es gibt dazu eine nur noch schwer überblickbare Literatur.13 Das Musée du Quai Branly fand dafür eine halbwegs überzeugende Lösung, indem der ästhetisierende Ansatz des Kunstsammlers und -händlers Jacques Kerchache durch den Beizug des Ethnologen Maurice Godelier gemildert wurde, der eine erneuerte Verpflichtung gegenüber ethnographischer und historischer Kontextualisierung durchsetzte – die geographische und komparative Auslegung der Sammlungen in den neuen Galerien verbindet sich mit einem ästhetischen Ansatz, der als nötig erachtet wurde, um die Universalität künstlerischen Schaffens zu bezeugen.14 Statt nach „Kunst“ oder „Kontext“ zu fragen, wären vielmehr die Ansätze der einzelnen, mit Erfolg wechselnden Ausstellungen am Quai Branly zu analysieren.
Einen weiteren Typus der Neueinrichtung und Präsentation der Sammlungen stellen die neu aufgekommenen „Welt(kulturen)museen“ zwischen Rotterdam, Frankfurt, Stockholm/Göteborg und Wien dar. Vor allem das schwedische Beispiel, aus der Fusion dreier getrennter Museen bereits 1999 entstanden, war nicht nur Überlegungen der ökonomischen Effizienz geschuldet, sondern gleichzeitig eigentliche Ausgeburt der seit den 1990er-Jahren breit Fuß fassenden Postulate der „Neuen Museologie“ – mehr auf die Besucher*innen und deren mögliche Partizipation ausgerichtet, die lokalen Gemeinden und Gemeinschaften einbeziehend, die, ermächtigt via digitale Vernetzungen, zur Teilnahme eingeladen werden sollten, interaktiv und interdisziplinär arbeitend. Für die Beziehungen zwischen Fachdisziplin, Akademie und Museum besonders relevant: Das „Neue Museum“ begann, auch aktuelle Themen, wie die Präsenz von Flüchtlings-Diasporas, Ernährung und Kulinaristik, Gesundheit und AIDS aufzunehmen – womit das Museum gleichsam wieder anschlussfähig wurde gegenüber zeitgenössischen Themen, deren sich die universitäre Ethnologie angenommen hatte. Ebenfalls unter Aufnahme eines Postulates der „Neuen Museologie“ gingen die neu ausgerichteten ethnographischen Museen stärkere internationale Verpflichtungen ein, nicht nur – naheliegend – auf Ebene der Europäischen Union (wofür spezielle Finanzmittel zur Verfügung gestellt wurden),...