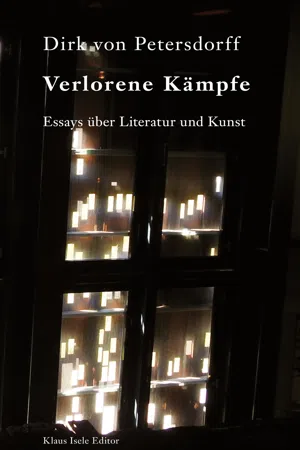
- 188 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Dirk von Petersdorffs Essays setzen sich heiter und angriffslustig, witzig und provozierend mit der Literatur der Moderne, vor allem der Lyrik dieses Jahrhunderts auseinander. Er hat ein Buch geschrieben, bei dem mit Gegenwind gerechnet werden muss, denn nach wie vor findet das Denken über Kunst im Bannkreis der ästhetischen Moderne statt. Die Wirkung der leitenden Ideen allerdings hat nachgelassen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann man von einer erschöpften Moderne sprechen. Dieser Zustand einer erschöpften Moderne hemmt die Entstehung von Neuem und verhindert Antworten auf die Welt, also auf die Gegenwart - und das ist es doch, was wir eigentlich von der Literatur und Kunst verlangen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Verlorene Kämpfe von Dirk von Petersdorff im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Sprachwissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Wie modern ist die ästhetische Moderne?
Gottfried Benns Wege
I.
Wer nach der Entstehung der ästhetischen Moderne fragt, braucht Distanz zu ihren Behauptungen. Die Moderne will ein Anfang sein, reine Gegenwart, creatio ex nihilo. Sie hat keine Vergangenheit und keine Entwicklung, sie ist da: »Man muss absolut modern sein!« So hat sie ihre viten und Legenden geschrieben, und im Fall Gottfried Benn heißt das: Am Anfang ist der Schock, der Anfang ist schwarz, der Anfang ist das Leichenhaus der Stadt Berlin:
Der Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte, sah so angeknabbert aus.
Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löcherig.
Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell fand man ein Nest von jungen Ratten.
Aber als die »Morgue« erscheint, ist Benn 26 Jahre alt und groß geworden in einer ganz anderen Welt, in einem »Dorf mit 700 Einwohnern in der norddeutschen Ebene, großes Pfarrhaus, großer Garten, drei Stunden östlich der Oder«. Zwischen diesen Welten lebt Gottfried Benn, und sein Werk entsteht aus der Spannung zwischen den starren Augen des Expressionisten: »Hier diese Reihe sind zerfressene Schöße« – und dem Fließen der Erinnerung: »Es ist ein Garten, den ich manchmal sehe.« Die Moderne kommt aus der Vormoderne, und am Anfang ist Sellin, Ort der Kindheit.
Wenn der Begriff »Moderne« nicht nur für einige Kategorien stehen soll, dann braucht man Lebensgeschichten, um ihn zu füllen. Über die Kindheit und Jugend Gottfried Benns muss man nicht spekulieren, denn er hat das Wichtigste aufgeschrieben. Natürlich ist das eine Erzählung, eine Konstruktion, wenn man will, aber etwas anderes haben auch die Psychologen nicht. Und Benns eigene Geschichte hat, wie wahr sie auch sein mag, sein Denken und Handeln bestimmt. Sie ist hartnäckig und von Dauer. 1934 entsteht die erste Autobiographie, damals mit dem Ziel, die »Erbmasse« zu rechtfertigen. Nach dem Krieg, unter historisch neuen Bedingungen, wird sie erweitert und trägt nun den bekannten Titel »Doppelleben«. Der Autobiographie entsprechende Bekenntnisse zur Herkunft finden sich auch in den Essays, unter Titeln wie »Das deutsche Pfarrhaus« oder »Fanatismus zur Transzendenz«. Und schließlich ist das Gedichtwerk durchzogen von Bildern aus dem Land östlich der Oder, bis zum »Epilog« aus dem Jahr 1949, wo der Alte noch einmal an den Jungen denkt, »der sich am See in Schilf und Wogen ließ«.
Benns Autobiographie besteht über weite Strecken aus Theorie; sie wirkt zusammengesetzt, ist wenig geformt. Die folgende Passage, die auf die Nennung Sellins folgt, fällt wegen ihrer bildlichen und klanglichen Gestalt sofort auf: »Das ist auch heute noch meine Heimat, obgleich ich niemanden mehr dort kenne, Kindheitserde, unendlich geliebtes Land. Dort wuchs ich mit den Dorfjungen auf, sprach platt, lief bis zum November barfuß, lernte in der Dorfschule, wurde mit den Arbeiterjungen zusammen eingesegnet, fuhr auf den Erntewagen in die Felder, auf die Wiesen zum Heuen, hütete die Kühe, pflückte auf den Bäumen die Kirschen und Nüsse, klopfte Flöten aus Weidenruten im Frühjahr, nahm Nester aus.« Und etwas weiter, wo er zu seinem Elternhaus kommt, heißt es: »Eine riesige Linde stand vorm Haus, steht noch heute da, eine kleine Birke wuchs auf dem Haustor, wächst noch heute dort, ein uralter gemauerter Backofen lag abseits im Garten.« Das ist mehr als Nostalgie. Denn diese Kindheit im ausgehenden 19. Jahrhundert, Benn ist 1886 geboren, findet noch in einer Welt statt, die von Wechsel und Wiederkehr der Natur bestimmt ist. Im parataktischen Satzbau, in den Parallelismen und der Rhythmisierung hat sich die zyklische Ordnung niedergeschlagen. Der Raum der Kindheit liegt vor den Verzeitlichungserfahrungen der Moderne, die Dauer und Wiederkehr zerstören wird. »Unendlich« blüht der Flieder, die Linde, deutscher Geborgenheitsbaum, »steht noch heute dort«. Die Bindung an die Natur, in der man »barfuß« läuft, hat eine weitere und sehr konkrete Bedeutung. Denn Gottfried Benn erlebte in seinem Elternhaus noch eine Schwundform des so genannten »ganzen Hauses«, das sich selbst versorgt, einen Abglanz wirtschaftlicher Autarkie darstellt. Sein Vater hatte noch eine kleine Pfründe erhalten, Pferde und ein Stück Acker. Zwar ist das »ganze Haus« immer nur zur Hälfte Realität, zur anderen Idee gewesen; aber solche Ideen haben Macht. Ein anderer Pastorensohn, Friedrich Hölderlin, hat diese Lebensform utopisch überhöht.
Benns Beschreibungen sind an historische und geographische Kontexte gebunden. Sellin gehört zu jenem Teil des Deutschen Reiches, der von dem Modernisierungsschub im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nur in Ausläufern berührt wurde. Die Moderne ist ja kein Faktum, das mit einem Schlag vorhanden ist. Sie setzt sich seit dem 18. Jahrhundert in Schüben durch. Ebenso findet sie regional mit erheblichen Unterschieden statt, und so konnte eine Kindheit im späten 19. Jahrhundert sich noch in einem weitgehend vormodernen Raum abspielen. Von der industriellen Revolution wurde Benns Landstrich wie die meisten ostelbischen Gebiete kaum erfasst, auch die Urbanisierung machte sich nur schwach bemerkbar. So blieb die Bevölkerungszahl vergleichsweise stabil, die soziale Mobilität war gering. Zwar hatte sich seit den Preußischen Reformen, seit der Revolution von 1848/49, seit den neuen Verfassungen von 1867 und 1872 die rechtliche Ordnung gewandelt, war auch hier der Ständestaat auf dem Weg zur Bürgerlichen Gesellschaft; doch blieb die Gutsbesitzerwelt hierarchisch gegliedert. Dafür sorgten die wirtschaftlichen Verhältnisse, faktisch waren die meisten Lohnarbeiter Abhängige. Dafür sorgten auch weiter vorhandene adlige Sonderrechte und paternalistische Mentalitäten, denn an die Zeit, als die Gutsbesitzer die Polizei- und Justizgewalt auf den Höfen innehatten, konnte man sich noch gut erinnern. Zwar mussten sich die Junker im Großen damit abfinden, das wirtschaftliche Primat an die Industrie zu verlieren, zwar mussten sie in einer Markt- und Konkurrenzgesellschaft agieren und lebten in einem Staat, der sich einer parlamentarisch-grundrechtlichen Ordnung mit individueller Freiheit und formaler Gleichheit immerhin annäherte – aber dem stand das Bewusstsein gegenüber, sowohl im politischen Herrschaftssystem (Bismarck) als auch in der Armee, Bürokratie und Diplomatie weiterhin die Spitzenpositionen einzunehmen, vom Staat durch die Agrargesetzgebung begünstigt zu werden, auf unverkäuflichem Boden zu sitzen, jedenfalls teilweise; und ansonsten waren Berlin und das restliche Reich weit weg. In den eigenen Vorstellungen jedenfalls bildete man die Elite Preußens und damit des Deutschen Reiches.
Gottfried Benn war Pastorensohn; über dem Haustor hing ein Kreuz; er wurde mit Gebet, Andacht, den Liedern des Gesangbuches groß. Die Moderne kommt aus der Vormoderne, aber sie hat ihre Herkunft transformiert und vergessen, und deshalb muss man daran erinnern: Gottfried Benn trug seinem Vater die Bibel zur Kanzel. Der Sohn des Pastors hatte in der Dorfordnung eine besondere Stellung. Denn er war nicht nur mit den Jungen der Landarbeiter vertraut, »sprach platt«, sondern hatte ebenso selbstverständlich Umgang mit den Söhnen des ostelbischen Adels. Stolz heißt es im Rückblick: »Diese alten preußischen Familien, nach denen in Berlin die Straßen und Alleen heißen, ganze Viertel, die berühmten friderizianischen und dann die bismarckischen Namen, hier besaßen sie ihre Güter, und mein Vater hatte einen ungewöhnlichen seelsorgerischen Einfluss gerade in ihren Kreisen.« Gemeinsam mit Heinrich von Finckenstein, dem Sohn des Patronatsherren der Pfarrei, Nachwuchs eines großen Adelsgeschlechts, wurde Benn erzogen. Später besuchten sie zusammen das Gymnasium in Frankfurt an der Oder, den Hauslehrer wie das Stipendium stellten die Finckensteins. Gottfried Benn lebt wie sein Vater mit Widersprüchen: Materiell geht es eher ärmlich zu, aber dagegen steht die gesellschaftliche und ideelle Bedeutung des Pastors in der alten Welt Osteibiens.
In manchen Analysen liest man, dass Gottfried Benn in unglücklicher Ambivalenz gelebt habe; auch von sozialer Desintegration ist die Rede. Nun verrät der unverhohlene Stolz in den oben zitierten Sätzen in der Tat ein Streben nach Höherem, das Benn nie mehr losließ und noch die späten Briefe des erfolgreichen Lyrikers zu einer etwas anstrengenden Lektüre werden lässt. Aber stärker und folgenreicher als solche Unsicherheiten ist das Selbstbewusstsein des Pastorensohns, das er gerade aus dieser Sonderstellung bezieht. Benn stellt sich in eine Tradition, »mit der Feststellung«, wieder in der Autobiographie, »dass ich 1886 in dem Dorf Mansfeld (Westprignitz) im Pfarrhaus als Sohn des damaligen Pfarrers geboren bin, in den gleichen Zimmern, in denen 1857 mein Vater, Gustav Benn, ebenfalls als Sohn eines Pfarrers dort geboren war«. Und zeitlich noch weiter ausgreifend, erklärt er das protestantische Pfarrhaus zu dem Erbmilieu, das »in den vergangenen drei Jahrhunderten Deutschland weitaus die meisten seiner großen Söhne geschenkt hat«. Spricht so die Desintegration? Das sind Bekenntnisse!
Aber wozu eigentlich? Wer auf der Kanzel steht, hat den Anspruch, Kirchenbänke und Hierarchien zu umfassen, leistet Weltdeutung und Sinnstiftung. Auf der Kanzel ist man freischwebend, befindet sich oben und außen und kann deshalb vereinen, ist Integrationsexperte. Benn hat daran geglaubt. Ebenso hat er den mit seiner Herkunft verbundenen erkenntnistheoretischen Anspruch aufgenommen, auch in dieser Hinsicht kommt er aus einer Welt vor der Moderne. In der frühen expressionistischen Prosa »Heinrich Mann. Ein Untergang« heißt es: »Früher in meinem Dorf wurde jedes Ding nur mit Gott oder dem Tod verknüpft und nie mit einer Irdischkeit. Da standen die Dinge fest auf ihrem Platze und reichten bis in das Herz der Erde.« Gott oder Tod – das sind höchste, nicht von Menschen gesetzte Prinzipien, aus denen sich die Empirie ableitet, auf die man sie beziehen kann. Dadurch entsteht ein geschlossener Symbolzusammenhang. Was auf der Oberfläche getrennt ist, hat Bezug auf das »Herz der Erde« und gehört dadurch zusammen. Die Welt ist, und das sagten ja auch die Naturbilder, gleich bleibend, stabil, deutbar, noch unberührt vom Taumel des modernen Relativismus.
Solche Bekenntnisse gelten allerdings, und das ist für den Fortgang wichtig, nicht so sehr den Inhalten des christlichen Glaubens, sondern seiner Funktion. Diese Umwandlung der Religion, aus der Benns Dichtungsverständnis hervorgeht, wurde ihm durch den Vater erleichtert, der das Christentum schon umdefiniert, zunächst pietistisch nach Innen gezogen, dann als Gesellschaftslehre verstanden hatte. Gegenüber dem Vater gibt es überhaupt nur eine abwehrende Äußerung, das oft genannte Gedicht »Pastorensohn«. Dieser Text ist allerdings einem konkreten Anlass geschuldet: dem Sterben der Mutter; der Weigerung des Vaters, ihr das Leiden zu erleichtern; der folgenden Wiedervermählung des alten Benn. Hier wird der Vater zwar verurteilt, aber mit den Formen und dem Vokabular der religiösen Tradition. Und diese Wendung bleibt Episode. In einem Brief an den Freund Oelze aus dem Jahr 1939 denkt Benn an die Besuche des Vaters in seiner Berliner Wohnung zurück, erzählt, wie »unmöglich« der Vater in einer Stadtwohnung war, dass er laut »wie in der Kirche« sprach und ein Dienstmädchen, das er einst konfirmierte und nun wiedertrifft, wie eine »Gräfin« behandelt. Eine »überwältigende unfassliche Reinheit« ging von ihm aus, heißt es da, »unerreichbar für eine zerrissene städtische Natur«. Für den Sohn bleibt die Sehnsucht nach Reinheit, sie nahm im Lauf des Lebens verschiedene Gestalt an.
II.
Als Benn den Garten östlich der Oder verlassen muss, die Kindheit in der Vormoderne zu Ende geht, schlägt ihn die »Seuche der Erkenntnis«. So formuliert es, in biblisch-medizinischer Sprache, die expressionistische Bildungsgeschichte »Heinrich Mann. Ein Untergang«. Dort ist beschrieben, was die Wissenschaft »Modernisierungsverlust« nennt: »Es geht nirgends etwas vor; es geschieht alles nur in meinem Gehirn. Da fingen die Dinge an zu schwanken, wurden verächtlich und kaum des Ansehens wert. Und selbst die großen Dinge: wer ist Gott? und wer ist Tod? Kleinigkeiten. Wappentiere. Worte aus meiner Mutter Mund. Nun gab es nichts mehr, das mich trug. Nun war über allen Tiefen nur mein Odem. Nun war das Du tot. Nun war alles tot: Erlösung, Opfer und Erlöschen.« Was ist geschehen? Der Besuch eines humanistischen Gymnasiums in Frankfurt an der Oder in den Jahren 1896 bis 1903 bedeutet noch keinen Bruch. Das Gleiche gilt für das Studium der Theologie und Philosophie in Marburg, das sich daran anschließt. Zwar könnte Benn in Marburg auf den Neukantianismus getroffen sein, dessen (gegenüber Kant noch verschärfte) Bindung jeder »Realitäts«-Beschreibung an das Subjekt sich mit dem beschriebenen Sündenfall verbinden ließe. Wenn »über allen Tiefen« der Atem des Subjekts weht, dann wird – in Umkehrung der biblischen Genesis – der Mensch zum Weltenschöpfer, und die vormals geglaubten metaphysischen Prinzipien sind »Wappentiere«, also Vergangenheit, »Worte aus meiner Mutter Mund«, also Tröstung für Unmündige. Aber diese Erfahrungen eines erkenntnistheoretischen Relativismus stellen nichts umstürzend Neues dar; wer hatte denn keine Kant-Krise? Auch hat Benn seine Zeit in Marburg kaum erwähnt – ganz im Gegensatz zum zweifellos entscheidenden, biographisch und literarisch beglaubigten Bruch, den er in Berlin erlebt, wo er 1905 das Studium der Medizin an der Kaiser-Wilhelm-Akademie für militärärztliches Bildungswesen aufnimmt. Die Moderne – das ist für Benn, im Gegensatz zu anderen Autoren seiner Generation, zuerst das System der modernen Wissenschaft, erst später die Stadt, nur am Rand der Krieg, zuerst der Positivismus, »die ganze Summe der induktiven Epoche, ihre Methoden, Gesinnungen«, wie er rückblickend schreibt. Medizin, das ist um 1900 eine Wissenschaft, die durch eine starke Expansion der Gegenstände, durch Spezialisierung und Technisierung gekennzeichnet ist. Spätestens in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man sich von der Naturphilosophie gelöst, fragt nicht nach dem menschlichen Wesen, sondern geht kausalanalytisch vor, zerlegt den Körper in physikalisch-chemische Funktionen. In dieser Welt sucht Gottfried Benn seinen Platz.
Der Dichter hat sich immer auf die Tugend der Nüchternheit berufen, die seine Studienjahre und von dort aus sein späteres Werk geprägt habe. Also muss man mit den Fakten beginnen. 1910 legt Benn das medizinische Examen ab, 1912 wird er promoviert, jeweils nach Plan, die Noten sind mittelprächtig. Von 1910 bis 1917 schreibt er Fachaufsätze, die zunächst philosophisch-feuilletonistisch angelegt sind, dann zunehmend den Bedürfnissen einer differenzierten, auf Experimente und Daten angewiesenen Wissenschaft gehorchen. Sie werden in Fachzeitschriften, darunter in sehr angesehenen, veröffentlicht. Eine Arbeit wird mit einem »Königlichen Preis der Medizinischen Fakultät« honoriert. Wer in achtzehn Monaten vier Aufsätze veröffentlicht, hat in der Wissenschaft etwas vor. Dieser Lebensplanung läuft aber eine Reihe von Misserfolgen und Krisen entgegen, die mit der ersten Anstellung an der Berliner Charite beginnt. Ein Krankheitszustand stellt sich ein, der es ihm körperlich unmöglich macht, sich auf neu eingelieferte Patienten zu konzentrieren: »Mein Mund trocknete aus, meine Lider entzündeten sich, ich wäre zu Gewaltakten geschritten, wenn mich nicht vorher schon mein Chef zu sich gerufen, über vollkommen unzureichende Führung der Krankengeschichten zur Rede gestellt und entlassen hätte.« Als er wenig später seinen Dienst als Sanitätsoffizier abzuleisten hat, wird er nach kurzer Zeit feld- und garnisonsdienstunfähig geschrieben, angeblich wegen einer einseitigen Senkniere, was mit guten Gründen bezweifelt worden ist. Und so geht es weiter. Bis zum Kriegsausbruch wechselt Benn wiederholt die Arbeitsplätze, ist unter anderem – für eine Amerikafahrt – als Schiffsarzt der Hapag beschäftigt, soll anschließend den Chef einer Lungenheilstätte vertreten, der aber nach einer Woche aus dem Urlaub zurückgerufen werden muss. Den Krieg verbringt Benn in der Brüsseler Etappe, aus ungeklärten Gründen wird er 1917 aus der Armee entlassen, ist kurzzeitig an der Berliner Hautklinik tätig und lässt sich dann in der Belle-Alliance-Straße als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten nieder. Damit kommt er beruflich zur Ruhe, in einer eher spärlichen Existenz.
Mit den Krisen dieser Jahre setzt sich Benn, wie es nahe liegt, zunächst auf medizinischer Ebene auseinander: »Ich vertiefte mich in die Schilderungen des Zustandes, der als Depersonalisation oder als Entfremdung der Wahrnehmungswelt bezeichnet wird.« Aber auch die frühe expressionistische Prosa ist Diagnose und hat eine therapeutische Funktion, aus der sie kein Geheimnis macht: »Ich will mir jetzt möglichst vieles aufschreiben, damit nicht alles so herunterfließt.« Obwohl in diesen Texten kaum erzählt wird, öffnen sich an vielen Stellen Durchblicke auf die Situation Benns, auf die Gefährdung elementarer Bewusstseinsstrukturen. Die Form zeugt davon, im Zerbrechen der syntaktischen Ordnung, in der Substantivhäufung, den Neologismen oder dem permanenten Bruch von Kontextregeln: »Ich schluchze über die Dörfer.« Dort, wo die Erzählungen von Rönne und Diesterweg semantisch nachvollziehbar sind, findet man die Bewusstseinskrise auch direkt benannt; als Versagen der jede Erkenntnis begründenden Subjekt-Objekt-Relation: »Er sei keinem Ding mehr gegenüber«, wird Rönne zitiert. Als Bedrohung zentraler Wahrnehmungskategorien, so des Raums: »Aber über allem schwebte ein leises zweifelndes Als ob: als ob Ihr wirklich wäret Raum und Sterne.« Mühsam müssen die Zeit, die Kausalität und die Abstraktion beschworen werden: »Man muß nur an alles, was man sieht, etwas anzuknüpfen vermögen, es mit früheren Erfahrungen in Einklang bringen und es unter allgemeine Gesichtspunkte stellen.« Diese Krankheit der Erkenntnis ist verbunden mit der Berufserfahrung des Arztes Rönne, der Leben auf einen physiologischen Mechanismus reduziert sieht. Was wäre dieser Mensch, fragt er einmal, »wenn die Geburtszange hier ein bißchen tiefer in die Schläfe gedrückt hätte?«. Damit verkommen individuelle Besonderheiten, geraten zu einer Frage der »Ablesbarkeit«. Diese Sätze kann man biographisch verstehen, auf den Lebensweg zurückbeziehen: Nachdem die in der Vormoderne begründete Identität – das Ich »aus Heimaten, aus Schlaf voll Traum, aus Abendheimkehr, aus Gesängen von Vater zu Sohn« – sich mit den neuen Erfahrungen nicht vereinbaren ließ, nicht haltbar war, gerät Benn in eine Phase ohne wirkliches Selbstverständnis. Sein Ich »geschieht«, findet statt. Dieses Ich, eine »Konkurrenz zwischen Associationen«, ist kaum lebensfähig.
Bedrohungen dieser Art können mit Fluchtphantasien kompensiert werden, mit Erinnerungen an die Kindheit. Einmal taucht eine schützende »Hecke« auf. Die Bedrohung kann aber auch umschlagen – in die Aggression dessen, der außen steht, dessen Energie sich gegen jene Welt richtet, in der er nicht leben kann. Das ist der Hass, der im Expressionismus und der deutschen Zivilisationskritik wirkt: »Ah, wie tief wittere ich den Gasgestank dieser Lydritgranate«, heißt es in einer Kriegserzählung, »zermatscht, verschmiert muss eine Menschheit werden, die in Maschinen denkt.« Nicht nur im Hinblick auf Benn lohnt es sich, solche Phantasien genau zu lesen.
»Ithaka« heißt eine Szene aus dieser Zeit, eine Art Handlungsanleitung zum Erwürgen positivistischer Professoren, deren Uraufführung wohl nicht zufällig im Jahr 1967 stattfand. Es geht um den Streit zwischen einem Professor der Medizin auf der einen Seite, einigen Studenten und einem Assistenten, die seine Form der Wissenschaft ablehnen, auf der anderen Seite. Der Professor steht für eine instrumentelle, zweckorientierte Vernunft, für die Vervielfältigung modernen Wissens, für eine Spezialisierung, die nach intellektueller Integration der Wissensbestände nicht mehr fragt; von irgendeinem »Sinn« ganz zu schweigen. Entsprechende Forderungen der Studenten erledigt er mit einem spöttischen Verweis auf Thomas von Aquin. Der Assistent Rönne dagegen leidet am »Ignorabimus« einer Wissenschaft, die sich von Philosophie und Theologie getrennt hat, er beklagt den Bruch vormoderner »Zusammenhänge«, sieht sich auf das Subjekt und dessen Weltkonstruktion zurückgeworfen: »Worte und das Gehirn. Immer und immer nichts als dies furchtbare, dies ewige Gehirn. An dies Kreuz geschlagen.« Diese Unhintergehbarkeit des Subjekts wird noch prekärer, wenn man den Menschen, wie die Studenten es der modernen Wissenschaft vorwerfen, mechanistisch deutet, triebgeleitet: Vor hundert Jahren schlug es »wie eine Seuche über die Welt«, der Mensch wurde, und hier spricht deutlich der Pastorensohn, »das große fressende herrschsüchtige Tier«. Dagegen werden Mythen aufgerufen, Visionen, die das quälende Bewusstsein zurücknehmen sollen, ein Zustand ohne Stirn wird beschworen, eine Welt, in der man »gelebt« wird. Hier erhält das Titelwort »Ithaka« seine Bedeutung: »Nun singt die Heimat über das Meer.« Auch der Text gerät zum Gesang, in dessen dionysischer Steigerung der Professor gurgelnd gewürgt und »mit der Stirn hin und her« geschlagen wird. »Mord! Mord!«, heißt es, o...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 200 Jahre deutsche Kunstreligion!
- Der neue und der alte Mensch bei Wieland, Henscheid, Enzensberger
- Woher hat Adorno den Zaubertrank?
- Wie modern ist die ästhetische Moderne?
- Kurzer Gang durch die Neue Nationalgalerie
- Was die Achtundsechziger mit dem »Tod der Literatur« eigentlich gemeint haben
- Kann man denn Trauben lesen von den Dornen?
- Reim und Kleid
- Veröffentlichungshinweise
- Über den Autor
- Impressum