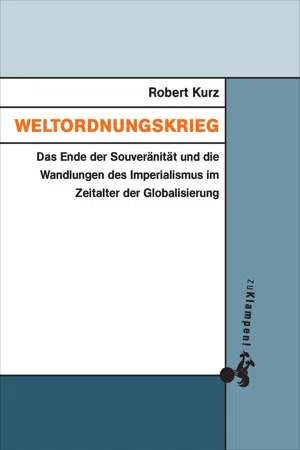
eBook - ePub
Weltordnungskrieg
Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Weltordnungskrieg
Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung
Über dieses Buch
Mit der Globalisierung ging die Hoffnung einher, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen imperialer Mächte durch einen friedlichen Wettstreit konkurrierender Marktteilnehmer ersetzt würden. Robert Kurz entlarvt diese Hoffnung als Täuschung. Globalisierung ist für ihn Imperialismus mit anderen Mitteln, ein Imperialismus, der sich längst in einen Weltordnungskrieg verwandelt hat.
Fast zwanzig Jahre nach seinem ersten Erscheinen hat »Weltordnungskrieg« nichts von seiner Aktualität verloren. Die Zerfallsprozesse, die sogenannten militärischen Interventionen, Stellvertreterkriege sowie ihre Folgen, wie Hungerkatastrophen, Flüchtlingsströme und Umweltzerstörungen nehmen immer weiter zu.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Weltordnungskrieg von Robert Kurz, Roswitha Scholz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Philosophy History & Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
DER ANACHRONISTISCHE ZUG
Gerade weil die legitimatorische Basis so schwach ist und nur durch eine Art Hysterisierung des Medienbewusstseins aufrechterhalten werden kann, mischt sich in die demokratische Weltordnungsideologie des globalisierten Kapitals jenes seltsam anachronistische Denken, das die neue Weltsituation in die alten Kategorien zu bannen sucht. Die Weltfriedensbomber reden dauernd von der weltdemokratischen Zukunft, aber sie blicken dabei notorisch zurück in die Vergangenheit, als könnten sie dort etwas finden, das ihnen hilft, die gegenwärtige Welt voller diffuser „Unfriedlichkeit“ und „Unsicherheit“ zu begreifen.
Der Gespensterkampf des globalisierten Kapitalismus mit seinen eigenen Ausgeburten und Nebenwirkungen lässt die Protagonisten ahnen, dass all ihrem Gerede über „demokratische Weltinnenpolitik“ usw. zum Trotz die kapitalistische Produktionsweise mit einer friedlich vereinigten Menschheit völlig unvereinbar ist, da ja für die globale Mehrheit das gemeinsame Moment ihres Daseins als marktwirtschaftliche Weltbürger durch nichts anderes als den verzweifelten Überlebenskampf in der planetarischen Krisenkonkurrenz gebildet wird, also ein rein negatives ist.
Deshalb ist es für diese große Mehrheit auch unmöglich, eine positive „weltbürgerliche“ Identität zu entwickeln. Soweit die Anti-Zivilisation des Geldes nicht schon in gärende Zersetzungsprozesse übergegangen ist, bleibt die kapitalistische Identität der Menschen zunächst an den Nationalstaat und dann an dessen Zersetzungsprodukte gebunden, weil die negative Universalität der Subjektform stets ihres eigenen Gegenteils in Form irgendeiner partikularen (nationalen, ethnischen, rassistischen, religiösen etc.) Identifikation bedarf, um die Konkurrenz und deren „Fortsetzung mit anderen Mitteln“ durch Mechanismen der Inklusion und Exklusion besetzen und vollstrecken zu können.
Es gibt daher so etwas wie ein zähes Beharrungsvermögen des Bewusstseins, das sich in den westlichen Zentren an die nationalstaatlichen Regularien klammert, obwohl sich das Bezugssystem der Souveränität auch hier aufzulösen beginnt. Die Trägheit des Denkens, das sich weigert, die Obsoletherit seiner eigenen kapitalistischen Denk- und Handlungsform zur Kenntnis zu nehmen, kann gar nicht anders, als die Zukunft in das Raster der Vergangenheit bannen zu wollen.
Dem trägt die offizielle Ideologie insofern Rechnung, als sie die reale Globalisierung begrifflich einzufangen sucht, indem sie gegen deren negative Potenz die in Wahrheit an den Nationalstaat gebundene politische Regulation nostalgisch „auf Weltebene“ beschwört und gleichzeitig die alte nationale „Interessen“-Identität kontrafaktisch für die Globalisierungskonkurrenz mobilisieren möchte, etwa in den diversen „Standort“-Kampagnen. Dabei werden die institutionellen und ideologischen Trägersubjekte zu jenem zerreißenden Spagat zwischen Patriotismus und Globalismus gezwungen, der sie nicht nur die „Weltoffenheit der Anständigen“ propagieren und gleichzeitig gar nicht besonders klammheimliche Zugeständnisse an die rassistisch-nationalistischen Banden machen lässt, sondern sie generell ökonomisch wie politisch dazu treibt, die beiden historisch auseinanderfallenden Bezugsebenen gleichermaßen besetzen zu wollen.
Dabei werden verschiedene, sich überlagernde anachronistische Interpretationsmuster ausgebildet, die den Prozess von krisenkapitalistischer Globalisierung, demokratischer Anomisierung und Weltordnungskriegen krampfhaft auf die vergangene Weltkriegsepoche zurückprojizieren. Der Vater des Gedankens ist dabei der stets von neuem aufkeimende illusionäre Wunsch, es möge aus der unbegreiflichen „Unruhe“ und „Unordnung“ der Realität und der Begriffe ähnlich wie nach 1945 eine neue Epoche des Wachstums, der Prosperität, des befriedeten Rechtsstaats und der demokratischen Normalität hervorgehen, für die dann auch wieder der alte Begriffsapparat gültig wäre, obwohl es dafür keinerlei Entwicklungsbedingungen, keinerlei reale Akkumulationsfähigkeit des globalen Kapitals und keinerlei kohärenten Bezugsrahmen mehr gibt. Die Ignoranz flüchtet sich in die Nostalgie.
Diese notorische Flucht in die Vergangenheit stellt sich in einem je nach ideologischer Referenz unterschiedlichen Bezug dar, wobei sich die Legitimationsmuster diffus mischen: Das luftige Reich der nostalgischen Ideologiebildungen verlangt weitaus weniger Eindeutigkeit und Kohärenz als die einstmalige legitimatorische Interpretation einer realen weltgesellschaftlichen Konstellation. Für die gegenwärtige Welt der Krisen-, Zerfalls- und Auflösungsprozesse der Moderne ist eben in deren eigenen Begriffen kein kohärenter Begründungszusammenhang mehr herzustellen. So darf nun in der nostalgischen Projektion auf eine irreal gewordene Welt der Vergangenheit alles durcheinander gehen, da sowieso kein adäquater Realitätsbezug mehr möglich ist - es sei denn durch die Formulierung einer radikalen Kritik des modernen warenproduzierenden Systems selber, die jedoch verweigert wird, weil sie völlig undenkbar scheint.
Vulgärmaterialismus und Irrationalität des Systems
In der Welt der Krisenkonkurrenz bildet die Anrufung des harten „Interesses“ ein Feld der nostalgischen Projektion. Diese Option macht das eher zynische und vulgäre Moment im vermeintlichen „Realismus“ des an die Warenform gebundenen Bewusstseins aus. Aber natürlich ist der Interessenmaterialismus aus der Aufstiegs- und Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus nicht mehr in derselben naiven Weise zu mobilisieren, da die inneren Widersprüche der Interessenkategorie unter den Krisenbedingungen der dritten industriellen Revolution unübersehbar ans Licht treten. In demselben Maße, wie die verborgene Metaphysik der Moderne an der Oberfläche allen Handelns bemerkbar wird und die metaphysische Leere, die „Geltung ohne Bedeutung“, das „leere Prinzip“ unmittelbar im Bezug auf die Gegenstände des Interesses erscheinen, macht sich in irritierender Weise auch die grundsätzliche Irrationalität der Interessenform bemerkbar, wie sie der fetischistischen allgemeinen Willensform entspricht.
An dieser Stelle wird es notwendig, noch einmal auf diese dem modernen warenproduzierenden System inhärente Irrationalität, auf die - populär gesprochen - „Verrücktheit“ seiner Kriterien, auf den Selbstzweckcharakter des Verwertungsprozesses und dessen Verhältnis zu den Äußerungen des subjektiven Interesses (des individuellen wie des nationalen) einzugehen.
Es gehört schon lange zu den Pflichtübungen des vermeintlich „realistischen“ Denkens rechter wie linker Provenienz, bei gesellschaftlichen und weltpolitischen Konfliktlagen die Frage nach dem „cui bono?“ zu stellen, also nach den handlungsleitenden Interessen. Diese Fragestellung ist zwar durchaus in einem analytischen Sinne legitim, aber dabei muss klar sein, auf welche Ebene sie sich bezieht. Denn die Kategorie des Interesses ist bereits auf dem Boden der kapitalistischen Ontologie angesiedelt, also innerhalb der Hülle der übergeordneten Fetischform der Moderne. In einer von dieser Zwangshülle und damit von blinden Systemgesetzlichkeiten befreiten Gesellschaft könnten sich die Menschen gar nicht in der verselbständigten Form von „Interessen“ (vor jedem Inhalt) gegenübertreten, die nicht von ihnen selbst definiert, sondern ihren Willensäußerungen „objektiv“ vorausgesetzt ist.
Die kapitalistische Rationalität der sogenannten Interessen, auch der sekundären „politischen“ und juristischen, bezieht sich immer nur auf die Logik des Verwertungsprozesses und seiner objektivierten, von der Konkurrenz diktierten Abläufe. Es geht ausschließlich um ein „vernünftiges“, von „rationalen Interessen geleitetes“ Handeln innerhalb dieses Systemzusammenhangs, der jedoch seinerseits in hohem Grade irrational ist: Die Kapitalverwertung stellt nun einmal einen von allen menschlichen Bedürfnissen entkoppelten abstrakten Selbstzweck dar, der letzten Endes selbstzerstörerisches Handeln nahe legt.
Es kommt also ganz darauf an, die beiden Ebenen von systemimmanenter Zweckrationalität einerseits und destruktiver Irrationalität des Systemcharakters als solchen andererseits zu unterscheiden, um sie bei einer Realanalyse in ihrer jeweiligen wechselseitigen Beziehung untersuchen zu können. Die Zweckrationalität der Interessen ist brüchig, sie geht nie auf, weil sie von der Irrationalität des Systemcharakters nicht unbeeinflusst bleiben kann.
So bildet das „Interesse“ zwar einen gewissen analytischen Leitfaden, um die Motive und Zielsetzungen des Handelns von ökonomischen und politischen Subjekten begreifen zu können; aber eine eindimensionale Herleitung aus der Ontologie vorausgesetzter kapitalistischer Interessenlagen geht immer in die Irre, weil sie das „Irresein“ des Kapitalverhältnisses selbst (die höhere Dimension) nicht mitberücksichtigt. Statt die Bündelung widersprüchlicher Interessenlagen und deren irrationalen Charakter zu durchdringen, muss sich so die Analyse dazu versteigen, einen eindimensionalen, gewissermaßen quadratisch-praktisch-guten Kausalzusammenhang von einem isolierten „materiellen Interesse“, daraus resultierenden eindeutigen Motiven und in sich widerspruchsfreien Handlungen zu konstruieren.
Diese Vorgehensweise ist genau das, was man als Vulgärmaterialismus bezeichnen kann. Und es gibt keinen Zweifel, dass mit zwar unterschiedlicher Betonung sowohl die mehr oder weniger offene und zynische, noch nicht moralisch verkleidete bürgerliche (rechtskonservative oder liberale) Macht- und Interessenideologie als auch der traditionelle Arbeiterbewegungs-Marxismus dieser vulgärmaterialistischen Methode deswegen in so hohem Grade huldigen mussten, weil sie eben selber nur jeweils auf eine bestimmte systemimmanente Interessenposition bezogen waren, ohne das gemeinsame, klassenübergreifende Bezugssystem kritisch in den Blick zu bekommen. Dieser positivistische Vulgärmaterialismus konnte und kann immer nur in den Kategorien kapitalistischer Ontologie denken, befangen in der Zweckrationalität des modernen warenproduzierenden Systems, dessen übergeordnete Irrationalität (und daher übrigens auch der Marxsche Fetischbegriff) ihm als ein Buch mit sieben Siegeln erscheinen muss.
Für die gestandenen Bekenner eines derartigen krachledernen Materialismus ist es sonnenklar, dass den diversen und widersprüchlichen Erscheinungen der neuen Weltordnungskriege einzig und allein harte „ökonomische Interessen“ zugrunde liegen, die dann wie eh und je von nationalimperialen Mächten in politisches und militärisches Konkurrenzhandeln übersetzt werden. Welcher Natur dieses Interesse jeweils sein soll, darüber darf dann fabuliert werden.
Schon für die Weltkriegsepoche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Theorie eines linearen Kausalnexus von zweckrationalen Interessen „des Kapitals“ und deren Umsetzung in der politisch-militärischen Geschichte durch die jeweiligen nationalimperialistischen Staaten viel zu kurz gegriffen. Zum einen war selbst in einer Zeit, in der die Rolle des Nationalstaats als „ideellem Gesamtkapitalist“ der nationalökonomisch zentrierten Kapitalien noch nicht derart zur Disposition stand wie heute, keineswegs die bruchlose Zusammenfassung von betriebswirtschaftlichen zweckrationalen Interessen der (auch im Binnenraum der Nationalökonomie konkurrierenden) Kapitalien zu einem einzigen nationalen Gesamtinteresse möglich. Stets konnte es sich nur um eine widersprüchliche Bündelung divergierender Interessen handeln, die der Resultante der politisch-militärischen Verlaufsform einen ebenfalls widersprüchlichen Charakter aufprägte. „Gerechnet“ im kruden Sinne der unmittelbaren ökonomischen Empirie hat sich der nationalimperiale Expansionismus kaum jemals, und selbst auf der direkt betriebswirtschaftlichen Ebene nur für relativ wenige Unternehmen.
Zum andern und vor allem aber wurde auch damals schon die immanente Zweckrationalität vom Irrationalismus der Zweck- und Interessenform selber überlagert und in zugespitzten Situationen geradezu übermannt. Es ist ja dem Kapitalverhältnis als solchem inhärent, dass keineswegs bloß die dürre Zweckrationalität (etwa das zweifellos vorhandene Bedürfnis nach Rohstoffen) „materiellen“ Charakter annimmt, sondern auch die übergeordnete Irrationalität. Der Zugriff auf bestimmte Materien (Öl, Metalle usw.) folgt keineswegs einem direkt materiellen Bedürfnis, sondern dieses ist ja selber schon bestimmt und gefiltert durch die ganz und gar nicht materielle Fetischform der „Verwertung des Werts“, die einen völlig verrückten Umgang sowohl mit den eigenen physischen Bedürfnissen als auch mit der außermenschlichen Weltmaterie erzwingt.
Und die Verrücktheit dieses Verhältnisses setzt in der Folge aus sich heraus weitere „materielle“ und gleichzeitig unmittelbar irrationale Interessen, etwa die nach einer Außen Verlagerung innergesellschaftlicher Widersprüche oder, wenn das nicht mehr möglich ist wie unter den heutigen Bedingungen einer krisenhaften Globalisierung, nach einer paradoxen Abschottung gegenüber dem zum Weltverhältnis gewordenen inneren Widerspruch. Und schließlich „materialisiert“ sich auch die Ideologie, die projektive und phantasmatische Verarbeitung dieses Widerspruchs, und wird selber wieder zur materiellen Gewalt, die sogar über die ökonomisch definierten binnenrationalen Interessen hinwegwalzen kann (man denke nur an den Holocaust der Nazis).
Der Vulgärmaterialismus verheddert sich zwar auf Schritt und Tritt in solchen Zusammenhängen, aber er kann sie in seinem Kategoriensystem nicht unterbringen und muss deshalb seine positivistische Fehlleistung stets von neuem reproduzieren. Das gilt letztlich auch für Theoretiker wie Lenin, der zwar die Phänomenologie der nationalimperialen Kapitalinteressen analytisch in der damaligen Situation zutreffend erfasste, aber verkürzt um die irrationale Dimension, weil befangen im arbeiterbewegungs-marxistischen Positivismus des warenproduzierenden Systems.
Schon der Erste Weltkrieg (letztlich überhaupt jeder Krieg der Modernisierungsgeschichte) ging nicht in einem linearen Zusammenhang von „rationalen“ Territorial- und Rohstoffinteressen einerseits und politisch-militärischem Kalkül andererseits auf, sondern bestand viel eher in einer über jedes Kalkül hinausschießenden Explosion der gesellschaftlichen Widersprüche und ihrer phantasmatischen ideologischen Verarbeitung, die letztlich auch die bürgerliche Zweckrationalität in die Luft sprengte. Und selbst daran konnten sich dann wieder sekundäre „materielle Interessen“ in derselben Form entzünden, vom Rüstungsgewinnler bis zum kleinen Schieber.
Umso mehr gilt dieser untrennbare innere Zusammenhang von zweckrationaler „Materialität“ der Interessen und Verrücktheit der gesellschaftlichen Form und ihrer Bewegung für die heutige Situation, in der die Weltkrise der dritten industriellen Revolution auch ökonomisch die absolute innere Schranke des Systems manifest macht und damit die destruktive Energie der kapitalistischen Irrationalität erneut und in veränderter, selber globalisierter Gestalt freisetzt.
Der bürgerlich-arbeiterbewegungsmarxistische Vulgärmaterialismus verschiedenster Provenienz verfällt dabei in eine doppelte Fehlleistung. Erstens blendet er in gewohnter Manier den übergeordneten Fetischcharakter der ganzen Veranstaltung aus zugunsten der verkürzt wahrgenommenen „Interessenspur“; eine Wahrnehmung, die an sich schon immer falsch war, jedoch in der Aufstiegsgeschichte des Systems zumindest über weite Strecken noch einen gewissen Leitfaden innerhalb gegebener Handlungsspielräume eröffnen konnte, ungefähr wie die alte nautische Navigation auf der Basis eines ptolemäischen Weltbildes. Heute dagegen ist damit nicht einmal mehr ein verkürztes Verständnis der Tatsachen möglich, also überhaupt keine Orientierung mehr.
Zweitens aber verfehlt diese Wahrnehmung heute sogar das rein immanente Bezugsfeld der Globalisierung, weil sie grundsätzlich nur von einem Standpunkt aus möglich wird, der in der alten, untergegangenen Welt nationalimperialer Ausdehnungsmächte angesiedelt ist. Das Ausblenden der systemischen Irrationalität einerseits und das Sitzenbleiben auf der vergangenen Weltkonstellation einer multipolaren Konkurrenz nationaler Imperien andererseits bilden die beiden Seiten derselben Medaille von anachronistischer Deutung.
Das heißt natürlich nicht, dass objektive Interessenlagen, subjektive Interessen-Definitionen und entsprechende Kalküle, Vorgehensweisen und Strategien keine Rolle mehr spielen würden, ganz im Gegenteil. Besonders deutlich gilt das für den gesamtimperialen Öl-Imperialismus. Aber die Interessen erscheinen jetzt eben unmittelbar in ihrer irrationalen Form, und davon wird auch ihre praktische Durchsetzung weitaus deutlicher als in der Vergangenheit bestimmt.
Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass die zusammenfassende nationalstaatliche Form des imperialen Zugriffs obsolet geworden ist und der „ideelle Gesamtimperialismus“ beständig zwischen nationaler Partikularität (US-Dominanz) und einer prekären Inkarnation des negativen Universalismus (NATO, Menschenrechts-Legitimation etc.) schwankt. Auch die wechselseitige Durchdringung von vulgären gesamtimperialen Ölinteressen einerseits und Motiven d...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Krise des Weltsystems und die neue Begriffslosigkeit
- Die Metamorphosen des Imperialismus
- Die Realen Gespenster der Weltkrise
- Die Postmoderne Weltpolizei
- Der Nahe Osten und das Antisemitische Syndrom
- Die Imperiale Apartheid
- Die Gemeinsamkeit Der Demokraten
- Das Imperium und Seinetheoretiker
- Das Ende Der Souveränität
- Der Globale Ausnahmezustand
- Der Anachronistische ZUG
- Vom Weltordnungskrieg Zum Atomaren Amoklauf?
- Nachwort zur Neuauflage von Herbert Böttcher
- Literatur
- Über den Autor