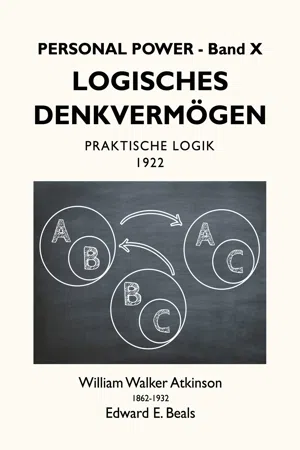![]()
IX DAS GESETZ DER LOGISCHEN DEDUKTION
Sie sind nun eingeladen, dieses wichtige Gesetz des logischen Denkens, bekannt als das Gesetz der Logischen Deduktion, zu betrachten. Dieses Gesetz repräsentiert die universelle Erfahrung des menschlichen Denkens, rational angewandt und gelenkt. Das Gesetz der logischen Deduktion kommt im siebten der sieben Axiome des logischen Denkens zum Ausdruck, das wie folgt lautet:
VII. DAS AXIOM DER LOGISCHEN DEDUKTION: "Was für die Klasse als Ganzes gilt, muss auch für jedes und alle Individuen gelten, die diese Klasse bilden.
Das in diesem Axiom verkörperte Prinzip, Gesetz und Wahrheit wird in allen logischen Überlegungen verwendet. Es wird als selbstevidente Wahrheit betrachtet, die zu Recht als selbstverständlich vorausgesetzt wird; es wird in jedem logischen Denken angenommen und in jedem wahren Schlussfolgern impliziert. Das Gesetz der logischen Deduktion aus den frühesten Zeiten wurde erkannt und beim logischen Schlussfolgern angewandt. Tatsächlich vertraten die Logiker bis zum Aufstieg zum Induktiven Denken die Ansicht, dass die Deduktion die einzig gültige Form der logischen Schlussfolgerung sei. Gegenwärtig ist man sich darüber im Klaren, dass diese beiden grossen Formen des logischen Denkens nicht voneinander getrennt werden können, da das Material für die gesamte Deduktion bereits durch die Induktion bereitgestellt werden muss und da die Induktion durch die nachfolgende Deduktion verifiziert werden muss.
Einige glühende Verfechter der induktiven Schlussfolgerung gehen sogar so weit zu behaupten, dass die Deduktion in Wirklichkeit nicht mehr oder weniger als eine Methode zur praktischen Anwendung der Ergebnisse der Induktion ist; und dass die Schlussfolgerungen, zu denen die Deduktion gelangt, zuvor implizit in den Urteilen, die über die einzelnen Objekte gefällt wurden, wenn sie in ihre jeweiligen logischen Klassen aufgenommen wurden, geltend gemacht wurden. Wir werden uns hier jedoch nicht auf eine solche technische Diskussion einlassen, zumal wir glauben, dass hier, wie in den meisten Fällen, die Wahrheit im Mittelweg – zwischen den beiden Extremen – zu finden ist.
Deduktion ist der logische Prozess, bei dem wir durch Schlussfolgerung aus zwei bereits bekannten allgemeinen Wahrheiten eine unbekannte besondere Wahrheit ableiten. Wie ein hervorragender Logiker gesagt hat, ist es, "aus anderem Wissen etwas Wissen zu gewinnen". Auch wurde es dargelegt als: "Herausfinden, was wahr ist, wenn bestimmte andere Dinge wahr sind". Beispiele für Deduktionen folgen: "Alle Menschen sind sterblich; Sokrates ist ein Mensch; deshalb ist Sokrates sterblich." "Alle Pferde sind Tiere; diese Kreatur ist ein Pferd; daher ist diese Kreatur ein Tier", "Alle Magnete ziehen Stahl an; dieses Stück Stahl ist ein Magnet; daher wird dieses Stück Stahl anderen Stahl anziehen". "Alle Pilze sind gut zu essen; dieser Pilz ist ein Pilz; daher ist dieser Pilz gut zu essen. "Kein Fisch ist ein warmblütiges Säugetier; der Wal ist ein warmblütiges Säugetier; deshalb ist der Wal kein Fisch. "Alles A ist B; dieses Ding ist ein A; deshalb ist dieses Ding B."
In den oben genannten Beispielen finden Sie, dass es zwei bereits bekannte Tatsachen gibt – zwei Vorschläge, zwei Urteile: Diese werden "Prämissen" genannt. Es gibt auch eine dritte Tatsache, eine neu entdeckte Tatsache – ein drittes Urteil; dies wird die "Schlussfolgerung" oder "Deduziertes Urteil" genannt. Eine Prämisse ist: "Eine Proposition, die im Voraus vermutet oder bewiesen wurde, aus zwei davon wird eine Schlussfolgerung durch deduktive Inferenz gezogen. Die allgemeinste der beiden Prämissen wird als Hauptprämisse bezeichnet; die weniger allgemeine Prämisse wird als Nebenprämisse bezeichnet. In der klassischen Illustration ist zum Beispiel die Hauptprämisse: "Alle Menschen sind sterblich; die Nebenprämisse lautet "Sokrates ist ein Mensch"; die Schlussfolgerung lautet "Sokrates ist sterblich".
Der Syllogismus. Für den durchschnittlichen Studenten ist eines der furchteinflössendsten Dinge, die sich in der Formalen Logik offenbaren, das, was den unbekannten Namen "Syllogismus" trägt. Der Name selbst scheint erschreckende Möglichkeiten in Form von Formalien und akademischer Haarspalterei anzudeuten; und eine oberflächliche Untersuchung der Unterscheidung zwischen den vielfältigen Formen des Syllogismus soll dieses Gefühl der Besorgnis noch verstärken. Aber eigentlich ist das einzige schwierige Merkmal des Syllogismus (zumindest in seinen einfacheren Formen) sein Name. Tatsächlich verwenden Sie den Syllogismus jeden Tag in Ihrem gewöhnlichen Denken, und Sie haben ihn immer verwendet, auch wenn Sie sich dessen vielleicht nicht bewusst sind.
Ein Syllogismus ist einfach: "Die reguläre logische Form jedes logischen Arguments oder Prozesses des Deduktiven Denkens". Jedes der oben zur Veranschaulichung des Prinzips der Deduktion angeführten Beispiele ist ein Syllogismus. Das klassische Beispiel ist: "Alle Menschen sind sterblich; Sokrates ist ein Mensch; deshalb ist Sokrates sterblich." Jeder Syllogismus besteht aus drei Elementen, nämlich der Hauptprämisse, der Nebenprämisse und der Schlussfolgerung. Die Hauptprämisse enthält den universellsten Begriff (im obigen Beispiel ist dies "sterblich"). Die Nebenprämisse enthält den speziellsten Begriff (im obigen Beispiel ist dies "Sokrates"). Die Schlussfolgerung enthält den besonderen Begriff als Gegenstand und den universellsten Begriff als Prädikat (im obigen Beispiel ist dies "Sokrates ist sterblich"). Es gibt auch einen "mittleren Begriff", der in der Schlussfolgerung nicht vorkommt, der aber in der Kleinen Prämisse und in der Grossen Prämisse vorkommt (im obigen Beispiel ist der "mittlere Begriff" "Mensch" oder "Menschen").
Die Hauptprämisse eines Syllogismus ist zuvor durch Induktion erreicht worden. Die Nebenprämisse ist je nach dem das Ergebnis einer vorhergehenden Induktion oder Deduktion. Die Schlussfolgerung ist das Urteil, das durch den gegenwärtigen Prozess der Deduktion erzielt wird. Die drei Elemente des Syllogismus werden als "Propositionen" bezeichnet. Eine Proposition ist: "Ein Urteil zwischen zwei Konzepten, formal in Worten ausgedrückt".
Sie mögen denken, dass die Idee des Syllogismus rein technisch und künstlich ist und nichts mit "einfachem, praktischem Alltagsdenken" zu tun hat; aber wenn dem so ist, dann irren Sie sich. Sie wenden den Syllogismus ständig an, wenn Sie in Form von Überlegungen, Argumenten oder Entscheidungen denken; obwohl Sie ihn mehr oder weniger unbewusst anwenden. Wenn Sie eine Wespe auf sich zukommen sehen, scheinen Sie sich nur zu sagen: "Ich muss mich vor dieser Wespe in Acht nehmen"; aber Ihr Verstand denkt wirklich (wenn auch grösstenteils mehr oder weniger unbewusst): "Alle Wespen stechen; dieses Insekt ist eine Wespe; deshalb sticht dieses Insekt. Wäre Ihr früher erworbenes Wissen über Ihre Hauptprämisse, d.h. "Alle Wespen stechen", und über Ihre Nebenprämisse, d.h. "Dieses Insekt ist eine Wespe", nicht vorhanden, könnten Sie nicht zu Ihrer (mehr oder weniger unbewussten) Schlussfolgerung kommen, d.h. "Dieses Insekt sticht", die wiederum Ihr Verlangen und Ihren Willen weckt, "nach dieser Wespe Ausschau zu halten".
Sie folgen dem gleichen allgemeinen Kurs, wenn Sie sich von dem Ort entfernen, an dem Sie die Warnung der Klapperschlangen hören. Sie folgen ihm, wenn Sie sich schnell aus der Gegenwart des Stinktiers zurückziehen – obwohl Sie nicht innehalten, um Ihren Gedanken in seine Elemente zu analysieren oder ihn in Worte zu übersetzen. Sie folgen ihm, wenn Sie sanft den Stock mit der seltsam aussehenden Substanz niederlegen, wenn jemand Ihnen zuruft: "Vorsicht, das ist Dynamit." Sie verwenden es, wenn Sie "wissen", dass ein bestimmter Bettler keine Steuern zahlt; obwohl Ihr Verstand nur unbewusst die Denkphasen "Er ist ein Bettler; Bettler zahlen keine Steuern; deshalb zahlt er keine Steuern" durchläuft. Kurz gesagt, Sie setzen ihn (wenn auch mehr oder weniger unbewusst) in jedem Denkprozess der Deduktion ein, durch den eine Entscheidung oder ein Urteil gefällt wird. Wenn Sie sich die Mühe machen, jeden Gedanken zu analysieren, der zu einem "Deduktiven Urteil" führt, werden Sie feststellen, dass jeder Schritt oder jede Stufe des Syllogismus angewandt wurde.
Aber hier ist ein wichtiger Punkt: Im gewöhnlichen Denken und im deduktiven Denken gibt es eine "Verunglimpfung", Unterdrückung oder Auslassung des bewussten Denkens von einem oder mehreren der drei entsprechenden Sätze, die den Syllogismus bilden. Die fehlende Proposition existiert jedoch immer noch im Denken des Denkers – in seinen unterbewussten oder unbewussten Denkfeldern. Sie werden immer "als selbstverständlich angenommen" oder angedeutet, auch wenn man sich ihrer Anwesenheit nicht bewusst ist. Wenn Sie selbst das informellste Argument oder die einfachste deduktive Schlussfolgerung analysieren, werden Sie feststellen, dass die fehlenden Elemente immer "im Mind" vorhanden sind. Logiker wenden auf die Ergebnisse dieses "Verunglimpfens" oder "Auslassens" dieses Prozesses den Begriff "Enthymem" (d.h. "im Mind") an. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, sich diesen Namen zu merken: Sie können ihn sich einfach als "Kurzsyllogismus" vorstellen – denn genau das ist er auch.
Die "Abgekürzten"-Syllogismen unterscheiden sich in der jeweiligen Form sehr stark, lassen sich aber auf drei allgemeine Klassen reduzieren. Hier folgen Beispiele für jede der drei Klassen. Unter Weglassung der Hauptprämisse: "Wir sind ein freies Volk; deshalb sind wir glücklich. Hier ist die Hauptprämisse, d.h. "Alle freien Menschen sind glücklich", unausgesprochen, obwohl sie "im Mind" existiert. Mit der weggelassenen Nebenprämisse: "Poeten sind fantasievoll: deshalb war Byron phantasievoll. Hier ist die Nebenprämisse, d.h. "Byron war ein Poet", unausgedrückt, obwohl sie "im Mind" existiert. Mit weggelassener Schlussfolgerung: "Alle Angeber sind Feiglinge; Bombastes ist ein Angeber". Hier ist die Schlussfolgerung, d.h. "deshalb ist Bombastes ein Feigling", unausgesprochen, obwohl sie "im Mind" existiert und wahrscheinlich auch dazu gedacht ist, dem Hörer oder Leser in den Sinn gerufen zu werden.
Letztere Form wird in Debatten oder öffentlichen Reden oft sehr effektiv eingesetzt. Das charakteristische Achselzucken des Franzosen ist in Wirklichkeit eine syllogistische "Abkürzung", in der die Schlussfolgerung nicht in Worten ausgedrückt wird, sondern "im Mind" existiert und durch die Geste suggeriert wird. Auch wenn Sie sagen: "Ich erlaube Ihnen, Ihre eigene Schlussfolgerung zu ziehen", setzen Sie diese Form der "Abkürzung" ein – oft recht wirkungsvoll.
Sie werden es als ausgezeichnete mentale Übung und Praxis empfinden, einen "abgekürzten" Syllogismus in seiner ursprünglichen und vollständigen Form wiederherzustellen. Stanley Williams sagt: "Es ist eine der besten Übungen des Minds, die man anwenden kann – eine Übung, die sogar der Geometrie und anderen Zweigen der Mathematik überlegen ist, weil wir es darin mit der praktischen, alltäglichen Folgerung unserer Vernunft zu tun haben. Eine solche Übung wird Sie in die Lage versetzen, grundlegende Irrtümer in der Argumentation oder den Argumenten anderer Personen leicht zu erkennen. Als anschauliches Beispiel für diese Form der Praxis bieten wir folgendes an: "Dieses Ding wird im Wasser versinken, denn es ist ein Stein." In syllogistischer Form wiederhergestellt ist es: "Alle Steine versinken im Wasser; dieses Ding ist ein Stein; deshalb wird dieses Ding im Wasser versinken."
Die Lehrbücher der Formalen Logik werden Ihnen eine erschreckende Liste der zahlreichen Formen von Sätzen und Syllogismen liefern. Diese Liste entmutigt häufig den Praktiker und treibt ihn von einer weiteren Untersuchung des Themas ab. Da aber alle diese Formen auf die wenigen einfachen Formen reduziert werden können, auf die wir in diesem Kapitel dieses Buches Bezug nehmen, und da die technischen Unterscheidungen für denjenigen, der sich lediglich mit "den Arbeitsprinzipien" der Praktischen Logik vertraut machen möchte, von sehr geringem praktischem Wert sind, werden wir sie hier nicht weiter erwähnen. Darüber hinaus enthalten die Lehrbücher der Formalen Logik eine Reihe hochtechnischer Regeln, die die logischen Formen des Syllogismus regeln; auch diese werden wir weglassen. Mit Hilfe des gesunden Menschenverstandes und der Kenntnis der Grundprinzipien der Praktischen Logik kann man leicht auf diese haarspalterischen Unterscheidungen verzichten.
Es gibt jedoch einige Grundregeln, nach denen die Deduktive Schlussfolgerung vorgehen muss, um gültig zu sein, und die, wenn sie verletzt wird, zu Täuschung oder falscher Argumentation führen – dies wird zur Sophistik, wenn man sie absichtlich einsetzt, um andere oder sich selbst zu täuschen. Wir bitten Sie nun, diese Grundregeln zu beachten; sie lauten wie folgt:
- Die Begriffe müssen unmissverständlich und nicht mehrdeutig sein.
- Die Prämissen müssen tatsächliche Fakten repräsentieren.
- Einzelne Begriffe dürfen nicht als Universalbegriffe verwendet werden.
- Die Schlussfolgerung darf nichts enthalten, was nicht mit den Prämissen zu tun hat.
Sie sind nun eingeladen, die folgenden detaillierteren Aussagen zu jeder der oben genannten allgemeinen Regeln des Deduktiven Denkens zusammen mit Beispielen zur Veranschaulichung jeder Regel sorgfältig zu prüfen.
I. Die Begriffe müssen unmissverständlich und nicht mehrdeutig sein, d.h. sie müssen klar und deutlich sein und dürfen nicht in mehr als einer Bedeutung oder einem Sinn verwendet werden. Dies deshalb, weil ein und derselbe Begriff, der im selben Argument in mehr als einer seiner Bedeutungen verwendet wird, praktisch zu zwei oder mehr Begriffen wird; in einem solchen Fall kann eine Prämisse den in einer Bedeutung verwendeten Begriff enthalten, während in der anderen Prämisse derselbe Begriff in einer anderen Bedeutung verwendet werden kann, was zu falscher Argumentation und absurden Schlussfolgerungen führen würde. Dies war ein beliebtes Mittel der alten Sophisten; es wird häufig (in mehr oder weniger verwickelter und versteckter Form) von vielen sophistischen Sprechern und Schriftstellern unserer Zeit und unseres Landes verwendet. Hier ist eine klassische Illustration: "Ein Mann sagt: 'Ich lüge'; wenn er lügt, sagt er die Wahrheit; wenn er die Wahrheit sagt, lügt er".
Es folgen weitere Beispiele für Irrtümer, die sich aus einem Verstoss gegen diese Regel ergeben: "Federn sind Leicht (light); Licht (light) steht im Gegensatz zu Dunkelheit; daher stehen Federn im Gegensatz zu Dunkelheit. "Kein mutiges Ding flieht (flies); alle Adler fliegen (fly); deshalb sind Adler nicht mutig." "Alle Künstler entwerfen (design); alle intriganten (designing) Personen sind nicht vertrauenswürdig; deshalb sind alle Künstler nicht vertrauenswürdig." “Vice ran in the family; the police ‘ran in’ the family; therefore, the police were vicious.” (nicht sinnvoll übersetzbar) "Keine Katze hat zwei Schwänze; jede Katze hat einen Schwanz mehr als keine Katze; daher hat jede Katze drei (d.h., einen mehr als zwei) Schwänze." Eine Form dieses Irrtums besteht darin, den mentalen oder verbalen Akzent oder die Betonung auf einen falschen Begriff zu legen, wie zum Beispiel "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden GEGEN deinen Nächsten; alles, was nicht GEGEN deinen Nächsten ist, ist FÜR ihn; darum sollst du falsch Zeugnis reden FÜR deinen Nächsten. Die obigen Beispiele veranschaulichen in komplexerer und subtilerer Form die bevorzugten Mittel bestimmter sophistischer Denker, Debattierer und Lehrer.
Eine weitere Variante dieser Form des Irrtums besteht in der Verwendung der Worte "alle" oder ähnlicher Begriffe, an einer Stelle als Sammelbegriff, der "ein kombiniertes und vereintes Ganzes" bezeichnet, und an einer anderen Stelle als Singularbegriff, der "jedes, jedes oder alle einzelnen Individuen oder Objekte, die Teil eines Ganzen sind" bezeichnet. Beispiel: Die Aussage, dass "jeder Mensch alle Stöcke dieses Haufens wegtragen kann" (d.h. alle Stöcke einzeln, einen nach dem anderen wegtragen kann), unterscheidet sich weit von der Behauptung, dass jeder Mensch alle diese Stöcke auf einmal, in einer einzigen Last, wegtragen kann. Ebenso unterscheidet sich die Behauptung, dass "kein Mensch alle Stöcke in diesem Haufen wegtragen kann" (was bedeutet, sie mit einer einzigen Last wegzutragen), weit von der Behauptung, dass kein Mensch alle Stöcke, einen nach dem anderen wegtragen kann. Diese Form des Irrtums ist weitaus verbreiteter, als Sie sich anhand der oben genannten einfachen Beispiele vorstellen können. Sie wird gefährlicher, wenn sie in einer komplexeren und komplizierteren Form ausgedrückt wird.
Eine andere Variante derselben Form besteht darin, die Bedeutung einer grammatikalischen Redewendung zu verwechseln. Beispiel: "Immer zwei und zwei Tiere gingen hinein; zwei und zwei machen vier; deshalb gingen vier Tiere hinein". "Sie haben gesagt, dass Sie das, was Sie gestern auf dem Markt gekauft haben, heute gegessen haben; gestern haben Sie rohes Fleisch auf dem Markt gekauft; deshalb haben Sie heute rohes Fleisch gegessen." "Sie haben gesagt, dass es nicht wahr ist, dass Tugend aus Nützlichkeit besteht; wenn das wahr ist, dann fehlt es der Tugend an Nützlichkeit; deshalb sind Sie der Meinung, dass Nützlichkeit eine Sache ist, der es an Tugend fehlt." "Patriotismus ist der letzte Rest eines Schurken; deshalb ist jeder Patriot ein Schurke." Solche spitzfindigen Spitzfindigkeiten und Tricks zeichnen Winkeladvokaten, Besserwisser-Debattierer und andere ihrer Art aus; sie sind unter aller Kritik, wenn sie mit ernster Absicht in der Auseinandersetzung eingesetzt werden – und sie werden so viel öfter eingesetzt, als Sie vielleicht vermuten. Haben Sie jemals von dem Winkeladvokaten gehört, der dem Zeugen im Kreuzverhör die Frage stellte: "Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?" und auf einer Antwort "Ja oder Nein" bestand? Der Mann hatte seine Frau nie geschlagen: Stellen Sie sich sein Dilemma vor!
Eine andere Variante derselben Klasse von Täuschung ist die, bei der versucht wird, die Grundsätze eines allgemeinen Gesetzes auf einen bestimmten Fall anzuwenden, in dem die Umstände völlig anders sind. Beispiel: "Alle, die töten, sind Mörder; Soldaten töten; daher sind Soldaten Mörder." Diese Spitzfindigkeit wird entdeckt, wenn man sich auf die Definition von "Mord" bezieht, die lautet: "ein menschliches Wesen in böswilliger Absicht illegal zu töten." Dennoch haben Männer eines bestimmten Typs in der Öffentlichkeit hartnäckig versucht, diese Sophisterei zu betreiben und damit die öffentliche Meinung in bestimmte Richtungen zu beeinflussen. Noch einmal: die Spitzfindigkeit, dass "in Äsops Fabel der schnelle Hase von der langsamen Schildkröte geschlagen wurde; von den beiden Pferden, die an diesem Rennen teilnehmen, ist das eine schnell, das andere langsam; daher sollte das langsame Pferd dieses Rennen gewinnen". Hier gewann Äsops Schildkröte natürlich "trotz" ihrer Langsamkeit, nicht "wegen" ihrer Langsamkeit.
II. Die Prämissen müssen tatsächliche Tatsachen darstellen, d.h. sie müssen Tatsachen darstellen, die sich aus der eigenen sorgfältigen Beobachtung und dem eigenen Experiment oder aus der eigenen logischen Denkarbeit ergeben, oder aber aus sorgfältig erwogenen und akzeptierten Berichten über die Erfahrungen, Beobachtungen oder Überlegungen anderer, die als fähig und in der Lage angesehen werden, sorgfältig und korrekt zu beobachten, zu experimentieren oder zu argumentieren und mit logischer Präzision zu urteilen. Die Bedeutung dieser Regel wird deutlich, wenn man die Wahrheit des alten Aphorismus erkennt: "Man kann alles beweisen, was auch immer, wenn man bestimmte Prämissen annehmen darf; dies, ohne eine einzige technische Regel der Deduktion zu verletzen". Lässt man die Prämissen eines Arguments oder eines Folgerungsprozesses zu, so führt die Schlussfolgerung sicherlich, unvermeidlich und unveränderlich zu einer logischen Schlussfolgerung, ohne Rücks...