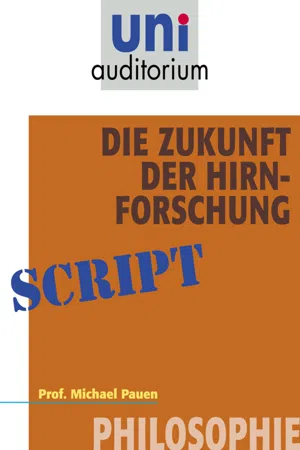
- 16 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Der wissenschaftliche Fortschritt wird häufig als "Kränkung" des Menschen und seiner vermeintlichen Größensucht betrachtet. Zum Ausdruck kommt dabei die Befürchtung, dass auch zentrale Bestandteile unseres Menschenbildes wie die Willensfreiheit oder das Ich/Selbstbewusstsein durch die wissenschaftliche Forschung widerlegt werden könnten.
Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die bisherige Wissenschaftsgeschichte nicht zu einer Kränkung geführt hat, sondern zu einem besseren Verständnis zentraler menschlicher Fähigkeiten. Ähnliches gilt für die heute umstrittenen Themen Ich/Selbstbewusstsein und Willensfreiheit: Philosophische Überlegungen ebenso wie empirische Befunde sprechen dafür, dass es sich hier um natürliche Fähigkeiten handelt, die durch die Wissenschaften erklärt und nicht widerlegt werden. Zu erwarten ist daher keine Revision unseres Menschenbildes, sondern eine Verbesserung unseres Verständnisses der zentralen menschlichen Fähigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Zukunft der Hirnforschung von Michael Pauen im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Filosofia & Storia e teoria della filosofia. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
FilosofiaIn einer sehr weit verbreiteten Vorstellung stellt die Wissenschaftsgeschichte eine Abfolge von Kränkungen des menschlichen Selbstbildes dar. Am besten auf den Punkt gebracht hat das wohl Sigmund Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1917. Dort heißt es: „Zwei große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Sie knüpft sich für uns an den Namen Kopernikus. Die zweite dann, als die biologische Forschung,“ und damit ist Darwin gemeint, „das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte. Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung erfahren.“ Und mit der heutigen psychologischen Forschung meint Freud in aller Bescheidenheit seine eigene Forschung.
Dieses Zitat wird bis heute sehr häufig wiederholt. In der Regel sind das Leute, die davon ausgehen, selbst der Menschheit die größte Kränkung beizubringen. Heute stehen vor allem zwei Themen zur Diskussion:
1. Zum einen das „Ich“ und das Selbstbewusstsein. Vielfach wird behauptet, die Wissenschaft habe widerlegt oder sei dabei, dass es so etwas wie ein Ich oder Selbstbewusstsein gibt.
2. Das zweite ist das Problem der menschlichen Freiheit.
Aus beidem stellt sich die Frage, ob Hirnforschung und Psychologie nicht zu einer fundamentalen Revision unseres Menschenbildes und unseres Selbstverständnisses führen werden.
Ich möchte im Folgenden zeigen, dass dem nicht so ist. Ich glaube erstens, dass unser Menschenbild heute stabil ist. Es ist auch in der Vergangenheit über längere Zeiten stabil geblieben. Weiterhin halte ich für die wesentlichste Veränderung innerhalb der Wissenschaftsgeschichte, dass an die Stelle von übernatürlichen Erklärungen, zum Beispiel einer immateriellen Seele oder Lebenskraft, natürliche, wissenschaftliche Erklärungen treten. Und das wird vermutlich auch in Zukunft so weitergehen.
Das führt aber nicht zu einer Widerlegung unseres Menschenbildes. Diese Erklärungen machen es vielmehr informativer, differenzierter und verständlicher. Wir werden mehr über uns erfahren, wir werden besser verstehen, warum wir die Fähigkeiten haben, die uns zur Verfügung stehen. Kurz: Wir brauchen kein neues Menschenbild.
Ich werde zunächst einige historische Hintergründe aufzeigen: Sie machen deutlich, dass es in der bisherigen Wissenschaftsgeschichte keine Kränkungen, keine fundamentalen Kränkungen und daher eben auch kein neues Menschenbild gegeben hat. In einem zweiten Teil versuche ich dann zu zeigen, dass die heutige psychologische und neurobiologische Forschung so etwas wie ein Ich nicht anzweifelt und behauptet, dass das Ich eine Illusion sei. Jedenfalls nicht, wenn man ein vernünftiges Verständnis davon hat, was es heißt, ein Ich zu sein.
Das Gleiche gilt auch für die Willensfreiheit. Auf die komme ich im dritten Teil. Mein Ansatz hier ist, dass wir nicht um die Willensfreiheit besorgt zu sein brauchen, wenn wir ein vernünftiges Verständnis davon haben, das wirklich unsere relevanten Vorstellungen in Bezug auf Freiheit erfasst.
Im vierten Teil werde ich schließlich auf empirische Untersuchungen zur Willensfreiheit eingehen, auf psychologische und neurobiologische Studien, die eben auch keine Widerlegung von Freiheit zum Ergebnis haben.
Historische Hintergründe
Erinnern wir uns noch einmal an das Zitat von Sigmund Freud am Anfang. Dort hieß es: Die Menschheit habe ihre erste wesentliche Kränkung erfahren, als sie erfuhr, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Der Urheber dieser Kränkung wäre demnach Kopernikus gewesen. Bei allem Respekt vor Freud, eine solche Behauptung kann man nur aufstellen, wenn man das mittelalterliche Weltbild nicht genau kennt. Dieses kann man sich als eine Hierarchie vorstellen, an deren unterem Ende der Mensch steht und am oberem Ende Gott. Diese Hierarchie entspricht unserem Blick unter offenem Himmel ins nächtliche Firmament. Am unteren Ende sind die Erde und der Beobachter, der auf der Erde steht. Darüber befinden sich die Planeten, die Fixsterne und schließlich in der höchsten Sphäre Gott.
Die Erde steht hier also auf der niedersten Stufe. Damit ist auch gemeint, dass die Erde aus einer Substanz besteht, die sehr wenig wertvoll ist. Die strahlenden Himmelskörper dagegen sind aus Materialien gefertigt, die wesentlich edler sind. An dieser Hierarchie-Vorstellung sieht man, dass die Erde damals nicht der Mittelpunkt des Weltalls war, sondern vielmehr ein Planet, der sich um den Mittelpunkt herumdreht.
Das ist aber nicht eine Weltsicht, wie sie zum Beispiel für Galilei selbstverständlich war. Galilei argumentiert ganz ausdrücklich, dass die Erde ein Stern ist wie anderen Himmelskörper auch, und nicht etwa der Bodensatz des Weltalls. Die Erde bewegt sich, und sie strahlt. So heißt es zum Beispiel in Galileis „Sideres Nuncius“, also der Schrift, in der er die Ergebnisse seiner Mondbeobachtungen publiziert: „Ich werde beweisen, dass die Erde sich bewegt und dass sie den Mond an Glanz übertrifft, nicht, aber“ – und jetzt kommt er auf diese traditionelle Vorstellung zu sprechen –, „eine Jauche aus Schmutz und Bodensatz der Welt ist.“ Die Quintessenz aus dieser Betrachtung ist eindeutig: Eine kopernikanische Kränkung hat es nicht gegeben. Das ist eine nachträgliche Projektion Freuds. Der Kopernikanismus hat zunächst einmal nach dem damals geltenden Weltbild eher zu einer Aufwertung der Erde geführt.
Aber hier geht es um einen Teil der Wissenschaftsgeschichte, der für unser Menschenbild nicht von entscheidender Bedeutung ist. Wesentlicher sind die Teile unseres Menschenbildes, bei denen es darum geht, ob wir wirklich selbstbewusste, bewusste und verantwortlich Handelnde sind.
Wenn es tatsächlich so sein sollte, wie Freud unterstellt, dass die Wissenschaftsgeschichte eine Folge von Kränkungen ist, dann müsste es angesichts der dramatischen Entwicklung der Wissenschaft seit dem alten Ägypten oder der Antike zu ebenso dramatischen Veränderungen des Menschenbildes gekommen sein.
Wenn wir uns aber die historischen Dokumente ansehen, dann sehen wir, dass das faktisch nicht der Fall ist. Dieses Menschenbild ist über sehr, sehr lange Zeit extrem stabil geblieben.
Verantwortung in der Antike
Das kann man daran erkennen, dass es die Vorstellung von individueller Verantwortlichkeit schon in ganz alten Kulturzeugnissen gibt. Dies ist genau ein Punkt, der für uns heute relevant ist. Das ist zum Beispiel schon aus der ersten ägyptischen Zwischenzeit, etwa 2.000 Jahre vor Christus, überliefert. In dem von mir gewählten Beispiel geht es um einen Gaukönig, der einige Grabmäler zerstört hatte, um daraus selber seine eigene Grabstätte zu bauen. Das war nach der Meinung seiner Mitmenschen der Grund für etliche Unglücksfälle. Er hatte den Zorn der Götter erregt oder dergleichen.
Der entscheidende Punkt ist hier, dass dieser Gaukönig die Verantwortung für seine Taten übernimmt. Er fühlt sich als eine verantwortliche Person und damit auch als eine bewusste, eine selbstbewusste Person. Das heißt, in den Grundzügen hat er dasselbe Menschenbild wie wir auch. Ein Zitat, in dem sich der Gaukönig selbst beschuldigt: „Denn es geschah infolge dessen, was ich tat. – Also was geschah, sind diese Unglücke. – Siehe, Mangel kam aus dem, was ich gemacht habe, Elend ist nun das Zerstören. Es gibt keinen, dem es nützt zu restaurieren, was er verwüstete, zu bauen, was er abriss, zu verschönern, was er entstellte. Hüte dich davor.“
Für solch eine Vorstellung von individueller Verantwortlichkeit gibt es viele Dokumente. Viele alte rechtliche Dokumente unterscheiden zum Beispiel zwischen verantwortlicher und fahrlässiger, ungewollter Übertretung von Normen. Oder denken Sie zum Beispiel an die Bibel, an die Genesis. Der Verfasser der Genesis versucht zu begründen, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, weil sie eine Norm übertreten haben und dafür verantwortlich sind. In dem Moment, wo sie sich vor dem Schöpfer zu verstecken versuchen, fühlen sie sich offensichtlich für ihr Tun verantwortlich. Die Vorstellung von individueller Verantwortlichkeit und damit auch von so etwas wie Selbstbewusstsein hat sich offensichtlich über sehr, sehr lange Zeiten erhalten, trotz aller dramatischen wissenschaftlichen Entwicklungen. Das spricht dafür, dass keine direkte Abhängigkeit von Wissenschaft und Menschenbild besteht. Insofern kann man sich fragen, ob es solch direkte Abhängigkeit heute geben sollte. In jedem Falle kann man zumindest nicht davon sprechen, dass die ältere Wissenschaftsgeschichte eine Abfolge von Kränkungen ist.
Darwin’sche Kränkung
Dasselbe gilt auch für den zweiten wesentlichen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte, die Freud sieht: Die so genannte Darwin’sche Kränkung. Ich erinnere noch mal kurz: Die biologische Forschung machte das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte und verwies auf seine Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur.
Es ist tatsächlich so, dass viele zentrale menschliche Fähigkeiten bis weit ins 19. Jahrhundert an eher übernatürliche Merkmale gebunden worden waren. Das scheint zunächst einmal für Freud zu sprechen. So wurde zum Beispiel der Unterschied zwischen der belebten und unbelebten Natur durch eine spezielle „Lebenskraft“ erklärt. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier wurde zum einen am separaten göttlichen Schöpfungsakt des Menschen festgemacht und zum anderen im Alltag von Menschen und Tieren durch die Existenz der Seele. Die Menschen hatten diese Seele, die Tiere hatten sie nach der üblichen Vorstellung nicht. Auch die denkerischen Talente der Menschen wie Geist, Selbstbewusstsein und Denken wurden so auf einen übernatürlichen Unterschied, nämlich auf die Seelensubstanz zurückgeführt.
Auf den ersten Blick kann man durchaus auf die Idee kommen, dass substantielle Merkmale unseres Selbstverständnisses kaputt gehen, wenn die Idee einer Seele, von Lebenskraft oder der Vorstellung einer unmittelbaren göttlichen Schöpfung als Ursprung der unterschiedlichen Arten widerlegt wird. Noch dazu müssen die Unterschiede zwischen Mensch und Tier, die man mit Hilfe der Lebenskraft oder der Seele begründet hatte, aufgegeben werden.
Aber faktisch ist das nicht der Fall. In Wirklichkeit sind im 19. Jahrhundert anstelle der alten Erklärungen, zum Beispiel des Unterschiedes zwischen der belebten und unbelebten Natur mit Hilfe der Lebenskraft, neue natürliche wissenschaftliche Erklärungen getreten. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier oder die kognitiven Fähigkeiten des Menschen werden etwa nicht bestritten – das wäre auch ganz merkwürdig, wenn man das machen würde – sondern man liefert eben dafür andere biologische oder physikalische Erklärungen.
Und diese Erklärungen verbessern unser Verständnis sogar noch. Der Bezug auf die Lebenskraft sagt uns beispielsweise nicht, worin der Unterschied zwischen der belebten und der unbelebten Natur liegt. Er macht nur ein bloßes Postulat. Biologische Theorien sagen dagegen sehr viel darüber aus, worin die konkreten Unterschiede zwischen der belebten und der unbelebten Natur bestehen. Biologische oder neurobiologische Theorien verraten auch eine ganze Menge über den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Das Postulat, dass Menschen eine Seele und Tiere keine Seele haben, gab uns dagegen in dieser Hinsicht überhaupt keine Erklärung.
Hinzu kommt, dass die Vorstellung von der besonderen Würde des Menschen seit dem 19. Jahrhundert nicht zurückgegangen ist. Diese Vorstellung ist nicht nivelliert worden. Im Gegenteil, wir haben heute wesentlich anspruchsvollere Vorstellungen von der Würde des Menschen und unternehmen wesentlich größere Anstrengungen, diese Würde des Menschen tatsächlich auch zu realisieren. (So unvollkommen diese Anstrengung und so unvollkommen diese Realisierung bis heute noch sein mögen.) Man denke nur daran, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts beispielsweise Sklaverei oder Kinderarbeit noch in weiten Bereichen der Bevölkerung auch der westlichen Länder akzeptiert waren. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr der Fall. Das spricht doch dafür, dass trotz – oder faktisch gerade wegen – der wissenschaftlichen Entwicklung unsere Vorstellung von der besonderen Würde des Menschen anspruchsvoller geworden ist und nicht, wie die Freud’sche Kränkungshypothese behauptet, gesunken ist.
Nun heißt die Tatsache, dass es in der Wissenschaftsgeschichte bislang keine Kränkungen gegeben hat, natürlich nicht, dass es so etwas nicht irgendwann geben kann. Tatsächlich gibt es heute eine ganze Reihe von Diskussionen, in denen behauptetet wird, die neurobiologische Forschung, die Hirnforschung, zwinge uns zu einer Revision unseres Menschenbildes. Sie also fügt uns heute solch eine Kränkung zu.
In zwei Bereichen geht man im Wesentlichen von solchen Kränkungen aus: Zum einen wird behauptet, die Hirnforschung widerlege die Willensfreiheit; zum anderen wird unser Konzept des Selbstbewusstseins zum Problem.
Ich möchte zeigen, dass auch in diesen beiden Fällen kein Anlass dazu besteht, unser Menschenbild zu revidieren. Die Hirnforschung bestätigt eher die Willensfreiheit und auch das Selbstbewusstsein und verhilft uns auch in diesen Bereichen zu einem besseren und differenzierteren Verständnis.
Ist das Ich eine Illusion?
Eine ganze Reihe von Psychologen, auch Philosophen, haben in den letzten Jahren versucht zu zeigen, dass das „Ich“ eine Illusion ist. Einer von ihnen ist der Münchner bzw. Leipziger Psychologe Wolfgang Prinz. Bei ihm heißt es etwa: „Das Ich ist nicht als ein fundamentales Naturphänomen anzusehen, sondern als ein kulturelles Artefakt, das in einem gesellschaftlich gestörten Attributionsprozess zustande kommt.“
Schauen wir uns das doch einmal ein bisschen genauer an. Was ist nun das „Ich“? Sprechen wir im Alltag von einem „Ich“? Sagen wir, ,ich habe mein Ich geändert’ oder, ich habe heute über mein Ich nachgedacht’? Normalerweise doch eher nicht. Was wir sagen, ist: ich laufe, ich bin traurig, ich habe heute über dieses oder jenes nachgedacht. Das heißt, wir benutzen Ich als ein Personalpronomen, in Sätzen, in denen wir uns selbst beschreiben oder in irgendeiner Art und Weise auf uns selbst beziehen. Wen meinen wir damit?
Wir meinen damit uns selbst als eine körperlich geistige Person, auf die sich andere mit unserem Namen oder mit dem Personalpronomen Er oder Sie beziehen können.
Hält man sich diesen Gedanken vor Augen. Was heißt es dann, wenn man sagt: Mein Ich existiert nicht? Das hieße doch: Ich existiere nicht. Aber wie kann man das sagen? In dem Moment, wo ich das sage, muss ich doch existieren. Und was ich ebenfalls besitzen muss, ist so was wie Selbstbewusstsein. Diese etwas merkwürdige Vorstellung von einem Ich geht letztlich noch auf eine Vorstellung einer Seele zurück, die sich in irgendeiner Art und Weise selbst und den eigenen Körper beobachtet. Das kann man auch an historischen Untersuchungen sehen. Wenn man diese etwas merkwürdige Vorstellung aufgibt, was kann man dann unter dem Ich verstehen? Man meint eine körperlich geistige Person, die vor allem eins besitzt: Selbstbewusstsein. Eine Person, die imstande ist, über sich selbst nachzudenken. Nur das kann man sinnvoller Weise als ein Ich bezeichnen.
Wie dieses Ich entsteht, darüber kann man heute eine ganze Menge sagen. Darüber gibt es psychologische Untersuchungen und natürlich eine Reihe von philosophischen Überlegungen. Als Beispiel ein ganz einfacher Fall: Ein Kind, das noch nicht über ein Selbstbewusstsein verfügt, hält sich selber die Augen zu, um nicht gesehen zu werden. Wie ist das zu erklären? Diesem Kind fehlt ein Selbstbewusstsein in Bezug auf seine eigenen Wahrnehmungen.
Das heißt konkret, es kann seine Wahrnehmungen noch nicht als solche verstehen. Es kann seine Wahrnehmungen nicht von denen anderer unterscheiden. Es denkt einfach: So wie ich die Welt sehe oder das, was ich da sehe, das ist das, was wirklich ist. Und die anderen müssen das auch so sehen. Erst in dem Moment, wo man Selbstbewusstsein entwickelt, kann man Unterschiede zwischen unterschiedlichen Realitäten erkennen. Wie die Fähigkeit, solche Unterschiede zu erkennen, entsteht, darüber wissen wir heute eine ganze Menge, darüber geben uns die Wissenschaften detailliert Auskunft. Diese Erkenntnisse widerlegen aber nicht die Existenz des Ich, sondern sie helfen uns auch an der Stelle wesentlich besser zu verstehen, wie dieses Ich und dieses Selbstbewusstsein entstehen.
Die Entstehung des Selbstbewusstseins
Selbstbewusstsein, das ist zunächst der philosophische Teil dieser Aufgabe oder der philosophische Teil dieses Rätsels. Selbstbewusstsein ist eine Fähigkeit, eigene Wahrnehmungen, eigene Gefühle, die eigene Lebensgeschichte oder auch eigene körperliche Merkmale als solche zu erkennen. Das heißt, den Unterschied zwischen den eigenen körperlichen Besonderheiten und denen anderer zu erkennen oder den Unterschied zwischen eigenen Überzeugungen und denen anderer oder den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer auseinander halten zu können. Diese Erkenntnisfähigkeit entsteht innerhalb der eigenen Lebensgeschichte. Schritt für Schritt, Fähigkeit für Fähigkeit.
Das kann man wissenschaftlich untersuchen und nachweisen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass Babys und kleine Kinder schon ganz kurz nach der Geburt die Fähigkeit zur Nachahmung haben. Wenn man einem kleinen Kind die Zunge herausstreckt, dann wird dieses Kind das auch selbst tun. Es kann also in irgendeiner Art und Weise bereits wahrnehmen, dass Sie die Zunge herausstrecken. Das ist erst einmal ein ganz einfaches körperliches Merkmal.
Mit sechs Wochen sind Kinder aber schon imstande, Emotionen zu unterscheiden. Sie kennen schon den Unterschied zwischen...
Inhaltsverzeichnis
- Historische Hintergründe