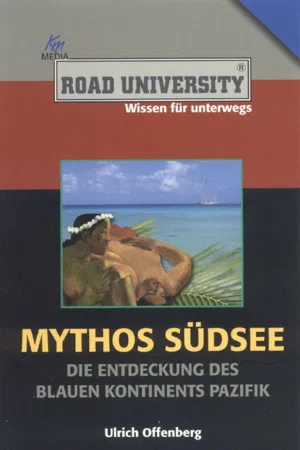
- 96 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Es begann mit einer theatralischen Inszenierung: 1513 tauchte der Spanier Vasco Nuenz de Balboa sein Schwert in die Fluten des Stillen Ozeans und nahm damit symbolisch die Südsee für seinen König in Besitz.
Der Edelmann ahnte damals nicht, dass er den größten Ozean der Erde entdeckt hatte. Ein Gebiet mit 20.000 Inseln, so groß wie die Oberfläche des Mondes. Ihm folgten Portugiesen, Holländer und Engländer. Sie alle waren auf der Suche nach Gold und dem geheimnisvollen "Südland", das seit der Antike irgendwo auf der anderen Seite des Erdballs vermutet wurde. Sie stießen auf freundliche Naturmenschen, kriegerische Kannibalen und wunderschöne Frauen, die offen der freien Liebe frönten - eine Inspiration nicht nur für den Maler Paul Gaughin.
Kühne Seefahrer wie Fernao de Magallaes, Aabel Tasman und James Cook schrieben Geschichte. Die Erzählungen der Seeleute von der anderen Seite der Erdkugel machten die Südsee zu einem Mythos.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Mythos Südsee von Ulrich Offenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & World History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Es war am frühen Nachmittag des 25. September 1513, als der spanische Edelmann Nunez de Balboa vor Begeisterung laut aufschrie. Der Anblick, der sich ihm und seinen erschöpften Begleitern bot, war phantastisch. Bis zum Horizont glitzerte ein gewaltiges, tiefblaues Meer. Der Spanier war endlich am Ziel seiner Wünsche und Hoffnungen angekommen. Er hatte geschafft, was noch keinem Europäer vor ihm gelungen war: die Entdeckung des sagenumwobenen „Südmeeres“.
20 entsetzliche Tage hatte sich Balboa mit seinen 190 Männern durch einen schier undurchdringlichen Dschungel gekämpft, ständig attackiert von Wolken von Moskitos, bedroht von giftigen Schlangen und Riesenspinnen, deren Stiche tödlich waren. Immer wieder mussten die Männer Angriffe feindlicher Indianerstämme abwehren. Meter um Meter hatten sie sich in ihren schweren Rüstungen vorgekämpft, oft am Ende ihrer Kräfte.
Angetrieben wurden sie einzig vom eisernen Willen Balboas, der von Ruhm und Reichtum träumte, wenn es ihm gelänge, das sagenumwobene „Südmeer“ mit seinen gewaltigen Schätzen an Gold und Silber zu finden. Dafür musste er sich aber 83 Kilometer quer durch die Landenge zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpazifik kämpfen, die heute vom Panama-Kanal durchschnitten wird. All diese Mühen schienen sich nun gelohnt zu haben. Balboa blickte von einer Anhöhe aus im Triumph auf den schneeweißen Strand, an dem sich die Wellen dieses fremden Ozeans brachen.
Der spanische Konquistador war sich der Bedeutung seiner Entdeckung durchaus bewusst. Seinen 69 Landsleuten, die den Todesmarsch durch den Dschungel überlebt hatten, gestattete er aber zunächst nicht, den Strand zu betreten. Er ordnete eine viertägige Ruhepause an, in der er eine aufwändige Zeremonie vorbereitete. Sie sollte dem Zweck dienen, alle Inseln und Kontinente, die von diesem Ozean umspült wurden, für die spanische Krone in Besitz zu nehmen.
Es war eine theatralische Inszenierung, die der abenteuerlustige Edelmann, der sich im übrigen auf der Flucht vor Gläubigern befand, den Männern schließlich bot. In der rechten Hand das blanke Schwert, in der linken die Flagge seines Königs, stapfte Balboa in voller Rüstung ins flache Wasser. Entschlossen stach er mit der Klinge in die sanft anrollenden Wellen. Dabei schwenkte der Spanier die Fahne seines Landes und diktierte dem anwesenden Notar mit hoher Stimme, dass er „diesen Ozean samt Inseln ein für allemal in den Besitz des spanischen Königreichs nehme.“
Seinen Männern am Strand, die dieses Schauspiel fasziniert beobachteten, befahl Balboa, den himmlischen Mächten ihre Referenz zu erweisen. Sie mussten sich tief verneigen und Jesus Christus sowie der Mutter Gottes für diese einzigartige Entdeckung von Herzen danken.
Balboa hatte, ohne es zu ahnen, fast 15.000 Kilometer von der Heimat entfernt, den größten Ozean der Welt entdeckt. Hinter dem Horizont erstreckte sich, auf der anderen Seite der bisher bekannten Erdkugel, ein blauer Kontinent, von dem wir heute wissen, dass er 20.000 Inseln umfasst und so groß ist wie die gesamte Mondoberfläche. Er hatte das Tor zu einer exotischen Welt aufgestoßen, die so gar nichts mit der bigotten, lustfeindlichen Wirklichkeit gemeinsam hatte, die in Europa zu Beginn des 16. Jahrhunderts herrschte. Während der Reformator Martin Luther gegen die willkürliche Herrschaft des Papstes rebellierte und zum Entsetzen seiner Anhänger eine Nonne heiratete und mit ihr Kinder zeugte, herrschte in der Südsee seit Jahrhunderten die freie Liebe, war der Tausch von Frauen selbstverständlich.
Franzosen in der Südsee
250 Jahre später berichtete der französische Seefahrer Louis-Antoine de Bougainville ausführlich über dieses ferne Paradies. Er leitete eine französische Weltumsegelung und ließ am 2. April 1768 vor Tahiti Anker werfen. Die später in Paris veröffentlichten Erzählungen über seine Erlebnisse in der Südsee elektrisierten das im Absolutismus erstarrte Europa. Sie entfachten in ganzen Generationen eine tief sitzende Sehnsucht nach einer Welt ohne einengende Gesetze und gesellschaftliche Zwänge. Bougainvilles Berichte von „edlen Wilden“ auf den paradiesischen Inseln inspirierten viele Schriftsteller und Maler wie Paul Gauguin zu ihren wichtigsten Werken.
Kaum hatten die Franzosen damals mit ihren beiden Schiffen Boudeuse und Etoile beigedreht, näherten sich Kanus der Einheimischen und umzingelten die Schiffe der Europäer. Die Tahitianer schwenkten grüne Palmwedel zum Zeichen der Freundschaft. In ihren Kanus saßen splitternackte junge Frauen. Das spontane, sachkundige Urteil der Franzosen: Die einheimischen Damen waren den Europäerinnen in Aussehen und ansprechenden Formen weit überlegen und zierten sich nur wenig. Auch die eingeborenen Männer zeigten sich generös: Die Gäste hatten unter den Töchtern des Landes die freie Wahl und konnten sich den Schönheiten ausgiebig widmen.
Louis Antoine de Bouganville berichtete sehr plastisch: „Man kann sich vorstellen, wie schwer es angesichts eines solchen Schauspiels war, 400 junge französische Seeleute, die sechs Monate lang keine Frauensperson mehr gesehen hatten, zu bändigen. Aller Vorsicht ungeachtet kam ein junges Mädchen auf das hintere Verdeck und stellte sich an eine der Luken über der Ankerwinde. Diese Luke stand offen, damit die Leute frische Luft bekamen. Sie ließ ungeniert ihre Bedeckung fallen und stand vor den Augen aller da wie Venus, als sie sich dem Paris zeigte. Sie hatte einen göttlichen Körper. Matrosen und Soldaten drängten sich zur Luke, und vielleicht ist niemals so fleißig an dieser Stelle gearbeitet worden. Durch unsere Sorgfalt hielten wir doch das verzauberte Schiffsvolk im Zaume, obgleich wir nicht wenig mit uns selbst zu kämpfen hatten.“
Der Schiffskoch, so heißt es in dem Bericht von Bougainville weiter, habe sich mit einer Inseltochter von Bord geschlichen. An Land angekommen, wurde er seiner Kleidung beraubt, intensiv untersucht und sollte dann vor versammelter Bevölkerung „seinen Mann stehen.“ Dabei gab es Probleme und viel Gelächter. Der Koch erhielt aber sein Eigentum zurück und beichtete dem Kapitän nach seiner Rückkehr kleinlaut von seinem Abenteuer. Begleitet wurde der französische Kapitän von dem Naturforscher Philibert Commercon und einem Assistenten, der sich J. Baret nannte. Dieser Assistent war eine verkleidete Frau – Jeanne. Bei der Landung auf Tahiti erkannten die polynesischen Männer sofort diese Verkleidung und versuchten ihr Liebesglück bei dieser Dame – sogar unter Androhung von Gewalt. Die Franzosen mussten schützend eingreifen.
Der Bericht Bougainvilles über seinen Besuch in Polynesien schuf jene verklärte Südsee-Romantik, die bis heute fortwirkt und von der der Mythos Südsee noch immer zehrt. Diese Insulaner, die laut Bougainville durch nichts verdorbenen waren, schienen Rousseaus Ideen vom glücklichen Naturzustand des Menschen zu bestätigen, der nur durch die Zivilisation verdorben würde. Dass es auch hier in der Südsee Klassengesellschaften, ausgeprägte Etikette gab, ja auch Mord und Totschlag wie überall auf der Welt, davon war zunächst keine Rede.
Besonders für die Völkerkundler der damaligen Zeit war der Bericht von Louis Antoine de Bougainville interessant. Für sie erschien Tahiti als das einzige Land der Erde, wo Menschen ohne Laster, ohne Vorurteile, ohne Mangel und ohne inneren Zwist leben. Die Früchte des Landes wuchsen, so schien es, ohne jede Kultivierung, und der Gott der Insel war die Liebe. Frauen waren seine Hohepriesterinnen, die Männer seine begeisterten Jünger. Die körperliche Vereinigung – ohne Zögern und Heimlichkeit – war hier ein religiöser Akt.
Alles bei diesem Volk trug in den damaligen vorschnellen wissenschaftlichen Expertisen den Stempel der vollkommensten Harmonie und Natürlichkeit. Es lag wohl an der prüden, eingeschnürten Klassengesellschaft des Alten Kontinents, dass die ehrwürdigen Professoren zu diesen euphorischen Urteilen gelangten. Auch akademische Weihen schützen offensichtlich vor Torheit nicht, wenn sexuelle Phantasie die Hormone in Wallung bringt.
Freie Liebe auf Tahiti
Bougainville erzählte vom friedlichen Handel zwischen den Eingeborenen und den weißen Entdeckern, von Ausflügen ins Landesinnere und der großzügigen Gastfreundschaft der Insulaner. Wörtlich heißt es: „Unsere Leute gingen täglich entweder einzeln oder zusammen in kleinen Gruppen unbewaffnet umher. Die Wilden nötigten sie in ihre Wohnungen und gaben ihnen zu essen. Es blieb nicht bei der Bewirtung allein, sondern man bot ihnen auch junge Mädchen an. Die Wohnung war gleich voll von Männern und Frauen, die die Neugier herbei lockte. Man streute ein Lager von Laub und Blumen und blies auf der Flöte dazu. Die Göttin der Liebe ist hier zugleich die Göttin der Gastfreundschaft, sie hat hier keine Geheimnisse. Die Wilden wunderten sich, wenn unsere Leute Bedenken trugen, ihr öffentlich zu opfern, welches den europäischen Sitten so sehr zuwider ist. Indessen zweifle ich nicht, dass mancher Matrose sich nach dem Landesbrauch bequemt hat.“
Neun Tage ankerten die Franzosen vor Tahiti, dann setzten sie die Segel Richtung Heimat. Bougainville hatte die Insel zunächst als „Neu Kythera“ bezeichnet, aber später nutzte er konsequent den einheimischen Namen „Tahiti“. Er registrierte die verschiedenen Tätowierungs-Formen der Geschlechter und befragte dazu einen Jüngling namens Aoturu, den er an Bord genommen hatte.
Tätowierungen, so berichtete Aoturu über einen Dolmetscher, seien Mannbarkeits-Symbole, sagten aber auch viel über die Stellung im Familienclan und den persönlichen Mut bei kriegerischen Auseinandersetzungen mit Nachbarvölkern aus. Bei den Frauen künden Tätowierungen über Stand und Herkunft sowie Anzahl der Kinder. Darüber hinaus sollen die schmerzhaften Verzierungen auch noch ihre besondere Schönheit unterstreichen. In Europa wird Aoturu in den Salons von Paris wie ein Maskottchen herum gereicht und stirbt schließlich auf einer Reise zu den Seychellen.
Doch schon bald gerieten Bougainvilles Entdeckungen und Erlebnisse in den Hintergrund. Die Akteure der Französischen Revolution, die Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit predigten und Europa vom Joch der absoluten Herrscher befreien wollten, hatten genug damit zu tun, ihre junge Republik gegen innere und äußere Gegner zu verteidigen. Vor allem Napoleon Bonaparte, der sich selbst zum Kaiser krönte, verfolgte andere Ziele.
Nach dem blutigen Sklavenaufstand auf Haiti, bei dem viel französisches Blut floss und die erste schwarze Republik in der Karibik errichtet wurde, war das französische Interesse an überseeischen Besitzungen erloschen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts, als Napoleon III. ein französisches Weltreich errichten wollte, gelang es den Franzosen, sich Tahiti als Teil der Kolonie „Französisch-Polynesien“ einzuverleiben. Sie ist heute noch Teil Frankreichs.
Natürlich blieb es bei den von Bougainville geschilderten, heftigen Fraternisierungen zwischen den weißen Männern und den einheimischen Schönheiten nicht aus, dass Geschlechts-Krankheiten ausbrachen. Die Frage, die in den Spelunken und Bordellen der Südsee bald heiß diskutiert wurde, lautete: Haben sie die Franzosen oder die Engländer eingeschleppt, oder war sie endemisch?
Bougainvilles Schiffsarzt dokumentierte, dass bei der Ankunft der Franzosen auf Samoa bei zwei Seeleuten die „Lustseuche“ aufgetreten war und danach auch noch bei weiteren Besatzungsmitgliedern. Dies spricht eindeutig dafür, dass Geschlechtskrankheiten auf den Inseln der Südsee schon vor der Ankunft der Franzosen latent vorhanden waren, denn sie waren die ersten Europäer, die Samoa anliefen.
Die Kolonisierung der Welt
In den etwa 250 Jahren zwischen dem Spanier Balboa und dem Franzosen Bougainville haben die europäischen Großmächte ihre besten Kapitäne auf die Suche nach Gold und Silber, nach kostbaren Gewürzen und unentdeckten Kontinenten losgeschickt.
Als erster umrundete der Portugiese Magalhaes – als Magellan in die Geschichte eingegangen – die Erde, von der man mittlerweile wusste, dass sie eine Kugel war. Magellan war es gelungen, den spanischen König und gleichzeitig den deutschen Kaiser Karl V. für die Idee zu begeistern, eine neue Schiffsroute zu den Gewürzinseln zu entdecken. Denn nach dem Vertrag von Tordesillas stand die östliche Route nur den Portugiesen zu. Unter dem Kommando des Portugiesen drang 1519 eine Flottille immer weiter nach Süden vor.
Die wagemutigen Seefahrer fanden dort eine sturmumtoste Passage – fast an der Südspitze des Kontinents. Der Weg durch dieses Felsenlabyrinth wurde nach dem Portugiesen „Magellanstraße“ genannt. Von dort segelten die Schiffe in die Südsee und durchquerten das große Wasser in 100 Tagen, ohne eine einzige Insel oder ein Felsenriff zu Gesicht zu bekommen. Ein unglaublicher Zufall bei der gewaltigen Anzahl von Eilanden und Atollen im Stillen Ozean.
Nach der langen, strapaziösen Reise waren die zu Mikronesien gehörenden Marianen das erste Land, das sie erspähten. An Bord herrschte längst die blanke Not. Der mitgeführte Zwieback war aufgebraucht, das Wasser in den Fässern faulig. Die ausgemergelten Männer ernährten sich notdürftig von exotischen Fischen, mitunter fingen sie auch verirrte Pinguine. 19 Männer überlebten diese Tortur nicht, sie gingen an der gefürchteten Seemannskrankheit der Skorbut, dem akuten Mangel an Vitaminen, zugrunde.
Endlich, am 6. März 1521, tauchte ein bewaldetes Eiland mit hohen Bergen auf: die Insel Guam – Islas de los Ladrones. Die Bucht von Umatac, von Magalhaes als Ankerplatz ausgewählt, übertraf in ihrer vollkommenen Schönheit alle Anlegeplätze, die die Seefahrer jemals angelaufen hatten. Eingeborene paddelten den weißen Ankömmlingen in Einbaum-Auslegerbooten neugierig und fröhlich winkend entgegen. Ungeniert kletterten sie an Bord und griffen nach allem, was sie interessierte und – buchstäblich – nicht niet- und nagelfest war. Den Begriff des Privateigentums kannten die Chamorren, wie sie sich nannten, nicht. Sie überrollten die Fremden auf ihren großen Schiffen wie eine Welle. Als sie sich schließlich auch noch des Beiboots bemächtigten, kochte der Zorn der Seeleute über.
Um das Boot zurück zu holen, wurde am folgenden Tag ein Strafkommando mit 50 Männern ausgeschickt. Die Europäer holten allerdings nicht nur das geraubte Boot zurück, sondern nutzten die Gelegenheit, den Eingeborenen auch noch ihre Vorräte an Schweinefleisch und Kokosnüssen zu rauben. Sie zündeten aus Rache 50 Hütten an. Außerdem – wahrlich kein Ruhmesblatt in der Kolonialgeschichte – schlachteten sie auch sieben Insulaner ab, um ihre an Skorbut leidenden Gefährten mit frischem Leber- und Nierenfleisch zu vorsorgen. Nach der Rückkehr des Strafkommandos gab Magalhaes sofort den Befehl, die Anker zu lichten. Er fürchtete Racheakte der Eingeborenen.
Der Portugiese trug entscheidend dazu bei, dass in der Geschichte der Eroberungen der Südsee das 15. Jahrhundert als „Jahrhundert der Spanier“ beschrieben wird. Allerdings erntete er damals ebenso wenig Anerkennung wie Balboa, der wenige Jahre, nachdem er zum Stillen Ozean vorgestoßen war, nach einer Intrige des spanischen Vizekönigs in Peru exekutiert worden war. Die Spanier waren bei der Suche nach dem gewinnbringenden Seeweg nach Indien immer schon in heftiger Rivalität mit dem portugiesischen Nachbarn. Das fing bereits weit vor Kolumbus an. Sie trauten dem Portugiesen daher nicht.
Auf Befehl der Admiralität ließen die Spanier Magalhaes vom Kapitän eines der anderen Schiffe bespitzeln. Als der berichtete, der Portugiese sei wohl in geheimer Mission für sein Vaterland tätig, brachten die Behörden des Königs die Ehefrau von Magalhaes in Vertretung des Gatten hinter Schloss und Riegel. Später zahlte Magalhaes für seine Entdeckungen mit seinem Leben. Nunez de Balboa wurde sogar in Panama von seinem eigenen Schwiegervater hingerichtet. Der Portugiese in spanischen Diensten starb dagegen durch die Hand eines Eingeborenen auf den Philippinen.
Magellan umsegelt die Erde
Magalhaes überquerte mit seiner Besatzung nicht nur als erster Europäer den Stillen Ozean, er gab ihm auch seinen bis heute gebräuchlichen Namen: Er ersetzte Balboas Wortschöpfung „Südsee“ durch „Pacificus“, „der Ruhige“, da sein Segelschiff während der hunderttägigen Überfahrt nicht ein einziges Mal von einem Sturm heimgesucht worden war. Das allerdings war reiner Zufall.
Magalhaes Weltumsegelung bewies zum ersten Mal ganz real die Kugelgestalt der Erde. Außerdem trat nach dieser Reise eine weitere Wahrheit zutage: Das von Kolumbus entdeckte Land war keineswegs Indien und die Einwohner demzufolge keine Inder oder Indianer, sondern die Ureinwohner eines anderen, neuen Kontinents. (Trotzdem hat sich der Begriff „Indianer“ für die Ureinwohner Amerikas bis zum heutigen Tag erhalten.)
Von der Expedition Magalhaes fertigte der Malteserritter Antonio Pigafetto einen Reisebericht mit den ersten detaillierten Beschreibungen der Ureinwohner und deren Kultur. Dieses einmalige Dokument blieb über die Jahrhunderte bis heute erhalten: „Jeder lebt hier nach seiner eigenen Façon und seinen Vorstellungen. Es gibt keinen Herrscher. Alle laufen unbekleidet herum. Einige tragen die Haare mit dem Bart verflochten bis zur Taille, als Kopfbedeckung dienen ihnen Palmhüte. Die Menschen sind von kräftiger Statur, ihre Körpermaße gleichen den unseren, ihr Teint ist olivfarben, wobei die ursprüngliche Gesichtsfarbe weiß war, die Zähne sind rot gefärbt, ein Ausdruck besonderer Schönheit.
Die Frauen tragen über dem Schambein einen schmalen Rindenstreifen aus der inneren Schicht der Palmborke, der dünn ist wie Papier. Sie sind von schlanker Gestalt, und ihre Hautfarbe wirkt heller als die der Männer, die Haare fallen lose herab, fast bis auf die Erde. In ihren Hütten fertigen sie Matten und Palmkörbe sowie andere unentbehrliche Dinge für die Hauswirtschaft an. Die Nahrung besteht aus Kokosnüssen, Bananen, Vögeln, Feigen, die fast eine Spanne lang sind, Zuckerrohr und Fliegenden Fischen. Körper und Haare reiben sie mit Kokos und Sesamöl ein.
Die Unterkünfte sind aus Holz, sie haben Fenster und einen festen Fußboden. Auf den Betten und in den Ecken der Zimmer liegen prächtige Palmenmatten. Die Menschen ruhen hier auf weichem, gehäckseltem Palmstroh. Sie besitzen keine Waffen, nur rutenähnliche Stöcke mit scharfen Fischgräten an der Spitze. Sie sind zwar arm, aber blitzgescheit und fürwahr diebische Elstern, und deswegen nannten wir die drei Inseln die Diebesinseln – Islas de los Ladrones.“
Die Entdeckung der Salomon-Inseln
Nachdem Magalhaes die erste Insel im Stillen Ozean entdekkt und die erste Kolonie für Spanien gegründet hatte, wurde Guam für die Spanier Ausgangspunkt weiterer Unternehmungen auf der Suche nach dem begehrten Gold. Sie glaubten unbeirrt daran, dass auf der anderen Seite der Erdkugel ein Land mit goldenen Bergen und Bäumen aus Edelsteinen zu finden sei.
Das Goldfieber führte die Seeleute schließlich auch auf die Inselgruppe der Salomonen. Ein Name, der so gar nicht nach Südsee klingen mag. Doch die Spanier waren auf der Suche nach den geheimnisvollen Goldinseln des Königs Salomon, die im Alten Testament unter dem Namen „Ophir“ erwähnt wurden. Der sagenumwobene biblische König Salomo wurde so zum Taufpaten der Inselgruppe der Salomonen.
Die umtriebigen Konquistadoren in Süd-Amerika waren zufällig aufgrund eines scheinbar verlässlichen Hinweises auf dieses geheimnisvolle Land Ophir gestoßen: Ein Herrscher aus Peru, der ruhmreiche Inka Tupac Yucanqui, hatte etwa 80 Jahre vor der Ankunft der Weißen angeblich mit Holzflößen eine große Meeresexpedition zu den Inseln Ninachumpi und Hahuschumpi im Stillen Ozean unternommen. Von dort brachte er große Mengen an Gold und Silber sowie einige Dutzend schwarze Gefangene mit. Zudem wussten Informanten zu berichten: Die Reise der Inka-Flotte zu den sagenhaften Inseln hätte keine zwölf Monate gedauert. Den Spaniern klang diese Legende wie Musik in den Ohren und wurde nur allzu gern geglaubt.
Ein Vierteljahrhundert nachdem Pizarro das Inka-Reich unterworfen hatte, erhielt der Vizekönig von Peru schließlich aus Spanien den Befehl, eine Expedition auszurüsten, um „die Inseln der Südsee aufzusuchen, die dem König Salomo gehören.“ Der Mann, der den Bericht über die Seereise des Inkaherrschers Tupac Yucanqui zu Papier gebracht hatte und von der märchenhaften Geschichte überzeugt war, hieß Pedro Sarmiento de Gamboa.
Dieser „Senor“ war weder ein Träumer noch ein Dummkopf, wie später über ihn verbreitet wurde. Im Gegenteil, er verfügte über gute technische Kenntnisse und kannte sich auch in der Astrologie aus. Außerdem war er ein brillanter Seemann. Ihm war die ganze damalige Welt bekannt. Und – auch das ist von Wichtigkeit – war er ein Adliger, ein „Hidalgo.“
Dem damaligen Vizekönig von Peru, Lope Garcia de Castro, legte Gamboa einen detaillierten Plan für die Expedition vor. Castro war einverstanden, bestimmte aber nicht Gamboa, wie zu erwartet gewesen wäre, sondern seinen gerade einmal 21 Jahre alten Neffen Alvaro Mendana de Neiro zum Leiter der Expedition. Ein Jüngling, der seine kühnsten Abenteuer nicht auf den Weltmeeren, sondern in den Schlafgemächern der Schönheiten von Lima erlebt hatte.
Wahrscheinlich traf der Vizekönig diese Entscheidung, um den Verdienst künftiger Eroberungen leichter für sich in Anspruch nehmen zu können. Gamboa wurde nur zum Kapitän eines der zwei Schiffe ernannt, die der Vizekönig zur Verfügung gestellt hatte. Eine bittere Enttäuschung für den Mann, der darauf gehofft hatte, einmal im gleichen Atemzug mit Kolumbus genannt zu werden.
Bei günstigem Wind verließ die kleine Flotte im November 1567 Callao, den Haupthafen von Peru. Drei Monate später gab es auf den Schiffen bereits erste Fälle von Skorbut. Die Männer waren unzufrieden und drohten zu rebellieren. Immer öfter rotteten sie sich drohend auf dem Deck zusammen, Meuterei lag in der Luft. Endlich aber kam Land in Sicht und die Kapitäne gaben den Befehl, vor einer großen Insel Anker zu werfen.
Der junge Expeditionsleiter nannte dieses Eiland „Santa Isabel“, da die Flotte am Tag der Heiligen Elisabeth, dem 17. November, vom Heimathafen in Peru ausgelaufen war. Die Expedition hatte ihr Ziel, die Inseln des Königs Salomon, erreicht. Eine erste, kurze Beschreibung der eingeborenen...
Inhaltsverzeichnis
- Geschichts-Daten
- Inhaltsverzeichnis
- Franzosen in der Südsee