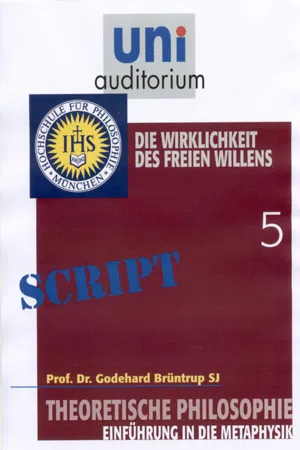
- 12 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Mit dem Wort "Philosophie" verbindet man gewöhnlich den Versuch, ein umfassendes Weltbild zu entwerfen und zu begründen. Die Metaphysik ist das Herzstück dieser theoretischen Unternehmung. Über den Bereich des naturwissenschaftlich Überprüfbaren hinaus versucht die Metaphysik letzte Grundfragen vor dem kritischen Auge der Vernunft zu prüfen: Gibt es Beständiges, oder ist alles im Fluss? Gibt es nur Materie oder auch Geist? Gibt es Freiheit, oder ist alles determiniert? Gibt es autonome Personen oder nur das biologische Lebewesen Mensch?
DIE WIRKLICHKEIT DES FREIEN WILLENS
Sind wir frei zu tun, was wir wollen? Oder wollen wir nur, was die Natur, die Gene, das Gehirn auch ohne unser bewusstes Wollen schon längst vorherbestimmt haben? Was wollen wir überhaupt unter Freiheit verstehen? Welche Freiheitsbegriffe gibt es? Ist Freiheit eventuell sogar mit natürlicher Determination vereinbar? Die drei klassischen Positionen in der philosophischen Freiheitsdebatte werden erläutert und kritisch untersucht: Determinismus, Libertarismus und Kompatibilismus.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Theoretische Philosophie, Teil 5 von Godehard Br im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Philosophy History & Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
PhilosophyIn dieser fünften Vorlesung in der Reihe Metaphysik werden wir uns mit der Frage nach der Freiheit des Willens beschäftigen, bevor wir in der letzten und sechsten uns mit dem tiefen metaphysischen Problem des Verhältnisses von Körper und Geist, dem sog. Leib-Seele-Problem, beschäftigen. Beide Probleme hängen zusammen. Das Problem der Freiheit des Willens verweist letztlich auf das ihm in mancher Hinsicht zugrunde liegende Leib-Seele-Problem.
In den letzten Jahren wurde gerade in der populären Presse oft diskutiert, ob die Willensfreiheit empirisch widerlegt sei. Dass es neurophysiologische Experimente gäbe, aus denen hervorginge, aus denen beweisbar und ableitbar wäre, dass wir uns über die Existenz der Willensfreiheit getäuscht hätten.
Wenn das tatsächlich so wäre, dann würde es sich beim Problem der Willensfreiheit gar nicht um ein philosophisches Problem handeln.
Erinnern Sie sich daran, dass ich in der ersten Vorlesung bei der Bestimmung dessen, was Metaphysik ist, herausgearbeitet hatte, dass metaphysische Fragen begriffliche Fragen sind, keine empirischen.
Das Problem der Willensfreiheit mag sicherlich eine empirische Komponente haben, aber wenn es denn überhaupt ein philosophisches Problem ist, muss es darüber hinaus eine rein begriffliche Komponente geben, die empirisch nicht entschieden werden kann. Um die Herausarbeitung dieser begrifflichen Komponente werde ich mich im Folgenden besonders bemühen.
In einem ersten Durchgang versuche ich zu definieren, was wir überhaupt unter „Freiheit des Willens“ verstehen. Was überhaupt ein freies Wesen ist.
Erstens: ein freies Wesen handelt aus Gründen. Das heißt, sein Verstand erfasst intentional gerichtet auf einen geistigen Inhalt, einen Begründungszusammenhang. Es hat also solche, wie die Philosophen sagen, intentionalen Zustände, mentale Gehalte, wie Überzeugungen und Wünsche. Überzeugungen gehen immer über etwas, ein Wunsch beinhaltet etwas - deshalb intentional. Ein System, was solche intentionalen Zustände nicht hat, kann auch nicht frei sein.
Zweitens: Ein freies Wesen muss normative Zusammenhänge erfassen. Also, Wesen, die nicht zwischen normativ richtig und normativ falsch und eventuell auch moralisch gut und moralisch böse unterscheiden können, können nicht in vollem Sinne frei sein. Diese Grundüberzeugung findet sich etwa in unserer Rechtsprechung, dass Personen, die nicht in der Lage sind, normative Urteile zu fällen, nicht in der Lage sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, auch nicht strafmündig sind.
Drittens: Der Prozess, der zu einer freien Entscheidung und einer freien Tat führt, muss in seinen wesentlichen Teilen bewusst erfolgen. Ein Wertempfinden ist konstitutiv für ein freies Wesen. Ein Wesen, das über keine bewusste Innenperspektive verfügt, also ein Wesen, das nichts erlebt, ein reiner Automat, kann auch nicht im relevanten Sinne frei sein.
Und viertens: Ein freies Wesen muss in der Lage sein, sich innerhalb von Grenzen – was diese genau sind, werden wir noch diskutieren müssen – selbst zu bestimmen. Es darf also nicht einfach ein Spielball fremder Mächte sein.
Kommen wir nun zu den empirischen Argumenten gegen die Existenz der Willensfreiheit. Die moderne Psychologie und Hirnforschung hat herausgefunden, dass viele unserer Handlungen quasi automatisch ablaufen. Wir kennen das vom Autofahren, dass wir etwa den Schalthebel betätigen, ohne dessen bewusst zu sein. Automatisch, vielleicht nur mit ganz geringer bewusster Aufmerksamkeit. Aus der Tatsache, dass sehr viele von unseren Handlungen derart halb oder gar nicht bewusst ablaufen, kann man natürlich nicht schließen, dass alle unsere Handlungen derart sind, dass wir uns für sie gar nicht bewusst und bei voller Klarheit entscheiden.
Libet-Experiment
Das stärkste Argument gegen die Willensfreiheit, das empirisch vorgebracht wurde, ist das sog. Libet-Experiment. In diesem Experiment stellte sich heraus, dass man durch Messungen von elektrischen Aktivitäten im Gehirn feststellen konnte, dass eine ganz kurze Zeit, bevor wir uns bewusst für etwas entscheiden, ein „Aktionspotential“ im Gehirn zu messen ist, das für sich allein schon ausreichen würde, die Handlung, für die wir uns einen Moment später bewusst entscheiden, auszulösen.
Es ist also so, dass das Bewusstsein immer einen Tick zu spät kommt. Das Bewusstsein erzählt nur das nach, für was sich das Gehirn schon entschieden hat. Der Punkt war hier allerdings, dass nur das positive Wollen ineffektiv ist, das positive Wollen strudelt sozusagen aus uns hervor, es ist ein unkontrollierter begleitender Kommentar.
Libet war der Meinung, dass wir wenigstens noch negativ eingreifen könnten und etwas, was so in uns empor strudelt, unterbinden und abbrechen könnten. Sein Experiment war, dass die Versuchspersonen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes einen Finger bewegen sollten oder eine Handbewegung machen sollten. Mit einem komplizierten Verfahren der Messung stellte sich heraus, dass die bewusste Entscheidung, die Hand zu bewegen, immer einen Tick zu spät kam gegenüber diesem Aktionspotential, dem Bereitschaftspotential im Gehirn.,
Wenn dem nun wirklich so wäre, dass wir gar keinen freien Willen hätten, dann fragt man sich natürlich, warum wir überhaupt diese Illusion haben, warum die Natur uns diesen freien Willen vorgaukelt. Es gibt ja gar keinen Sinn, wenn wir ihn nicht haben.
Die gängige Antwort ist, dass die Überzeugung, einen freien Willen zu haben, etwas in der Welt bewirkt, zum Beispiel, dass sie uns vor lethargischem Nichthandeln bewahrt. Man kann aber nicht leicht verstehen, wie das funktionieren soll. Die Überzeugung, frei zu sein, könnte in der Welt etwas verändern, wenn sie unseren bewussten Willen dazu bestimmte, nicht passiv zu bleiben, sondern eben etwas tun zu wollen. Aber da gemäß unserer Annahme der bewusste Wille sowieso nichts tut, sondern immer hinterher hinkt, ist auch die falsche Überzeugung, frei zu sein, völlig machtlos, da sie nicht vermittels des Willens in der Welt kausal wirksam werden könnte.
Es ist also gar nicht klar, was diese Hypothese - dass diese Illusion etwas bewirken soll in der Welt - wie diese Hypothese, dass unsere Überzeugungen eben gerade nichts tun in der Welt, verträglich sein soll. Schauen wir nun genauer auf das Experiment von Libet. Wir müssen die innere Wahrnehmung (wann habe ich das Gefühl, jetzt will ich den rechten Zeigefinger oder die rechte Hand heben) mit der äußeren Zeit synchronisieren. Die „erste-Personen“-Perspektive muss synchronisiert werden mit der äußeren Zeit, die im Experiment messbar ist. Libet hatte dafür eine geniale Idee.
Er hatte eine große Uhr, auf der die Teilnehmer an dem Experiment genau feststellen konnten, zu welcher Uhrzeit sie den Willensentschluss gefasst hatten, den Finger zu bewegen. Natürlich ist das ein komplexer Vorgang, auf die Uhr zu schauen, dann wieder auf das innere Bewusstsein. Will ich jetzt die Hand heben, will ich sie nicht heben? Wissen wir, wie viel Zeit dieser komplexe Prozess der Selbstbeobachtung und die Korrelation mit der Uhr eigentlich in Anspruch nimmt?
Vielleicht ist das ja selbst ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt.
Libet reizte bei den Versuchspersonen die Haut und ließ sie mit Hilfe der erwähnten Uhr berichten, wann sie sich dieser Hautreizung bewusst wurden. Damit nahm er sozusagen eine Eichung der Uhr vor.
Aber sind diese beiden Fälle wirklich gleich? Es besteht doch ein erheblicher Komplexitätsunterschied zwischen der Beobachtung einer Hautreizung, was ein evolutionär sehr sinnvoller Vorgang zur Abwehr von Verletzungen ist und dem sehr komplexen und künstlichen Vorgang, seinen eigenen Willen zu beobachten, etwas, was wir im Alltag gar nicht tun.
Viele Experimente, neuerdings einige von Banks in Kalifornien, zeigen, dass tatsächlich diese Art der Datierung ein reines Konstrukt ist. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben.
Wenn man beispielsweise die Fingerbewegungen des Probanden mit einem Signalton bestätigt und dann in Folgeexperimenten diesen Signalton absichtlich ein bisschen verzögert, dann datieren interessanterweise die Versuchspersonen auch ihre bewusste Entscheidung, den Finger zu bewegen, entsprechend der Verzögerung nach vorne. Sie beziehen also das Ergebnis der bewussten Entscheidung in die Bestimmung des Zeitpunktes der bewussten Entscheidung mit ein.
Allein daran können Sie schon sehen, dass aus der Perspektive des Subjektes in einem komplexen Zusammenspiel zwischen dem, was es beobachtet (die Aufmerksamkeit schwankt zwischen der Selbstwahrnehmung und der Uhr) irgendwie ein Zeitpunkt gemittelt wird, an dem man dann angibt, man habe die Entscheidung getroffen. Man muss aus rein experimentellen Gründen sagen, dass diese Zeiten auf sehr wackligen Beinen stehen. Das zeigt sich um so mehr, als in den Versuchsreihen bei einzelnen Personen das Bereitschaftspotential zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten auftrat. Bei nicht wenigen trat es nicht vor der Bewegung, sondern erst nach der Bewegung auf. Nur im gemittelten Durchschnitt trat es insgesamt etwas vor der Bewegung auf. Man sollte also in ein Experiment, das schon vom Versuchsaufbau her so viele Fragezeichen aufwirft, nicht gleich zu viel philosophische Brisanz legen.
Das eigentliche Problem der Experimente liegt aber viel tiefer. Es ist die Frage: Wo wird hier die Freiheit gesucht? Die Verursachung einer Handlung - und darum geht es ja bei der Freiheit - unterscheidet sich von gewöhnlichen Kausalerklärungen. Die logische Form einer gewöhnlichen Kausalerklärung ist Folgende: Ereignis A verursacht Ereignis B. Etwa wenn Billardkugeln zusammenstoßen. Die Form einer Handlungserklärung ist ganz anders. Es ist nicht Ereignis A verursacht Ereignis B, sondern eine Person P vollzog die Handlung H aus dem Grund G. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir im Folgenden auf philosophischer Ebene das Argument von Libet untersuchen.
Libet bat die Versuchsteilnehmer, die Handlung nicht bewusst zu planen, sondern die Handbewegung von sich aus völlig undeterminiert und grundlos auftreten zu lassen. Dadurch fehlte diesen Ereignissen schon das Charakteristikum einer freien Handlung. Wir wissen nicht einmal, ob die Teilnehmer einen Drang, ein Verlangen, einen Wunsch oder eine Absicht hatten, die Hand zu bewegen, oder vielleicht eine Mischung all dieser mentalen Zustände. Denn alles war nach Libet zulässig.
Dass uns dies vom eigentlichen Ort der Freiheit weg führt, will ich Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir an, ich will meinen Freund am nächsten Morgen in aller Frühe, sagen wir um 6 in der Frühe, um des Wertes der Freundschaft willen vom Flughafen abholen. Obwohl mir das schwer fällt, so früh aufzustehen. Ich stelle mir den Wecker um 5 in der Früh. Am Morgen klingelt der Wecker. Ich denke mir, ich kann noch 5 Minuten liegen bleiben. Und dann – das kennen Sie sicher auch – baut sich so eine innere Spannung auf. Man schaut noch mal, döst wieder etwas weg, die Spannung baut sich weiter auf und plötzlich, wie von selbst, ganz ruckartig, erhebt man sich aus dem Bett und steht auf. Man hat gar nicht den Eindruck, dass man sich hier noch mal bewusst entschieden hat, sondern dass sich irgendwie aus dem Gesamtkontext dieser Situation eine innere Spannung aufgebaut hat, die dann dazu führte, dass man sich wie von selbst erhob.
Die Parallele zum Libet-Fall ist offensichtlich. Der Versuchsteilnehmer entschließt sich aus irgendwelchen Gründen – Neugierde, Unterstützung der Wissenschaften oder um des Geldes wegen – an dem Libet-Experiment teilzunehmen. Er weiß, dass er, sagen wir in den nächsten 30 Sekunden seine Hand bewegen soll. Nun baut sich in ihm eine innere Spannung auf, die sich nach einigen Sekunden in einer spontanen Handbewegung entlädt. Selbst wenn er sich vornähme, nach genau 17 Sekunden die Hand zu bewegen und angespannt auf eine Uhr starrte, wäre zu erwarten, dass sich kurz vor der gewählten Zeit ein Bereitschaftspotential aufbaut, das nun auch sein Eigenleben führt.
Ich folgere daraus, dass Libet die Freiheit an der falschen Stelle gesucht hat. Er hielt eine sich plötzlich wie von selbst ergebende Körperbewegung für den Inbegriff einer freien Handlung. Die Freiheit ist aber in der bewussten Entscheidung des Versuchsteilnehmers zu sehen und zu finden, an dem Versuch aus Gründen teilzunehmen. Während des Versuches kann es dann durchaus sein, dass der Versuchsteilnehmer in sich einen Prozess in Gang gesetzt hat, der eine gewisse Autonomie hat. Der löst dann innerhalb des zeitlich gesetzten Rahmens die Handlung aus.
Die Handlung wird allerdings nicht dadurch unfrei, dass an ihrer Auslösung Prozesse beteiligt waren, die nicht vollständig unter meiner bewussten Kontrolle standen. Sie wird nicht einmal dadurch unfrei, dass es nicht unter meiner direkten Kontrolle lag, ob die Handlung sagen wir nach 15 oder 19 Sekunden ausgelöst wurde.
Ich schließe also daraus, dass Experimente der Art wie die etwa von Libet an dem eigentlichen Problem dessen, was eine freie Handlung ist, vorbei gehen. Das philosophische Problem ist dadurch nicht in einer bestimmten Weise entschieden oder vorentschieden.
Der Freiheitsbegriff
Das philosophische Problem tritt dadurch auf, dass der Freiheitsbegriff als Begriff ein Problem aufwirft. Vielleicht ist der Freiheitsbegriff in sich ein instabiler, wenn man ihn zu Ende denkt ein rational gar nicht nachvollziehbarer Begriff. Einige Philosophen haben so argumentiert und sagten, es sei ein infiniter Regress im Freiheitsbegriff. Ein Wesen könne sich nicht vollständig aus Gründen selbst bestimmen.
Diesen Gedankengang kann man folgendermaßen entwickeln.
Willensfreiheit betrifft ja Freiheit bezüglich rationaler Handlungen, das heißt Handlungen aus Gründen und nicht unbewussten Reflex- oder Gewohnheitshandlungen. Wenn man rational handelt, also aus Gründen handelt, heißt es, dass es bestimmte mentale Eigenschaften von mir sind, die mich zu einem solchen rational Handelnden machen, nämlich dass ich Gründe habe. Gründe zum Beispiel am Libet-Experiment teilzunehmen. Nennen wir „diese Gründe haben“ ein bestimmtes Ensemble von mentalen Eigenschaften von mir. Die Gründe, die mich dazu bewegen, den Freund vom Flughafen abzuholen, oder am Libet-Experiment teilzunehmen.
Wie ist es nun mit diesem Ensemble von Gründen? Wenn ich wirklich frei sein will, dann kann es ja nicht sein, dass mir diese Gründe einfach zufallen, dass ich einfach mit denen geboren werde, dann bin ich ja in diesem relevanten Sinne auch nicht frei. Um diese handlungsrelevanten mentalen Eigenschaften, also mein Ensemble von Gründen, um für dieses verantwortlich zu sein, muss man sich entschieden haben, genau diese handlungsrelevanten mentalen Eigenschaften zu haben, anzunehmen.
Nun, um sich aber dafür zu entscheiden - wenn diese Entscheidung nicht einfach irrational sein soll, sondern vernünftig und aus Gründen folgen soll - dann brauche ich nun eine weitere Menge von höherstufigen Gründen, aus denen ich mich für diese ersten Gründe entschieden habe. Sonst habe ich mich ja wieder nicht wirklich aus Gründen dafür entschieden, sondern die ersten Gründe sind mir einfach zugefallen. Gut, jetzt sehen Sie schon, was passiert. Für diese Gründe, die ausschlaggebend waren für die ersten Gründe - also die zweiten, höherstufigen Gründe, die ausschlaggebend waren dafür, dass ich mich für die auf niedrigerer Stufe erste Gründe entschieden habe - können mir ja auch nicht einfach nur zufallen. Auch für die brauche ich wieder Gründe. Und auch diese Gründe können mir nicht wieder einfach nur zufallen, sondern ich muss mich aus Gründen dafür entscheiden, wenn es eine freie Entscheidung sein soll. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Der Rekurs auf immer höherstufige Gründe nimmt kein Ende. Und da ein endliches Wesen eine unendliche Reihe nicht durchlaufen kann, kann sich kein Wesen aus Gründen selbst bestimmen. Irgendwann ist da Schluss. Man muss irgendwelche Gründe einfach als gegeben annehmen und kann sie nicht aus weiteren Gründen herleiten.
Eine mögliche Antwort auf dieses Argument - ich weise jetzt darauf hin, dass wir jetzt bei einem echten philosophischen Problem, einem begrifflichen Problem im Freiheitsbegriff sind - Freiheit scheint als vollständige Selbstbestimmung aus Gründen in einen infiniten Regress zu führen. Ein möglicher Regress-Stopper, der dieses unendliche Weiterlaufen nach immer höherstufigen Gründen zu Ende bringt, wäre, dass es so etwas wie höchste Prinzipien des Handelns gibt, die nach keinen weiteren Gründen verlangen, die irgendwie selbsteinsichtig sind. Zum Beispiel: Tue das Gute und vermeide das Böse. An diesen höchsten Prinzipien findet die Suche nach weiteren Gründen ein Ende.
Eine andere Möglichkeit, diesen Regress zu stoppen, wäre, dass man sagt: Diese Vorstellung, dass man für alle Gründe, die man hat, wieder weitere Gründe braucht, die wieder aus Gründen gewählt haben müssen und die wiederum aus Gründen, dass diese Vorstellung sowieso falsch ist. Wir lassen ein Element der Spontanität beim Ergreifen von Gründen zu, dass dieses Ableiten nicht von einer weiteren Kette von Gründen hergeleitet werden muss.
Dann können Sie aber sagen: Ja, aber diese Spontanität ist dann nicht wirklich begründet. Man kann in dem spontanen Akt Gründe erfassen. Aber es heißt von daher noch nicht, dass ich diesen Akt so ausführe wie ich ihn tue und nicht einen anderen, dass ich dafür noch mal wieder übergeordnete Gründe habe. Vielleicht gibt es unableitbar im Handelnden, in der handelnden Person und daher nicht fremdbestimmt so etwas wie Spontanität. Das ist tatsächlich der letzte Garant von Freiheit, so dass diese Idee, dass wir uns wirklich selbst bestimmen müssen, sowieso eine Überforde...
Inhaltsverzeichnis
- Libet-Experiment