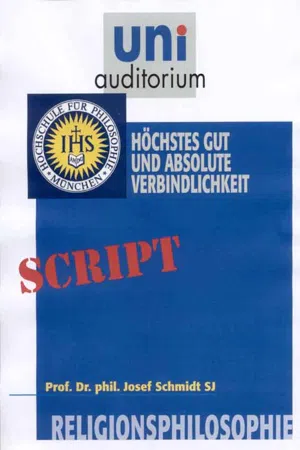
- 10 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Gibt es für uns einen Bezug zum Ewigen, Göttlichen, so dass die Welt nicht einfach "alles" ist? Haben wir eine letzte Orientierung, einen letzten Halt? Die Antwort der Religion ist die, dass wir aus einem uns tragenden, aber auch uns beanspruchenden Sinngrund leben, in dem wir Halt und Orientierung finden und für den der Name "Gott" steht.
Seit Beginn des kritischen Denkens im alten Griechenland wollte man diese Antwort im Diskurs denkend entscheiden.
HÖCHSTES GUT UND ABSOLUTE VERBINDLICHKEIT
Sollen unsere Bewertungen begründet sein, so setzen wir einen Maßstab der Beurteilung voraus. Platon nennt ihn die "Idee des Guten". Die Gewissheit von einer letzten und unbedingten Gutheit, die nicht nur unsere subjektive Konstruktion ist, sondern ihre Gutheit aus sich selbst besitzt und somit alles Gute begründet, muss ebenfalls Bestandteil eines vernünftigen Gottesbegriffs sein. Der sogenannte "ontologische Gottesbeweis" fasst all die Beweise in das Argument zusammen, dass unser Denken sich widersprechen würde, wenn wir nicht ein Höchstes und Unbedingtes voraussetzten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Religionsphilosophie, Teil 3 von Josef Schmidt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Bibles. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
Theology & ReligionThema
BiblesWir haben uns in der letzten Vorlesung mit dem sog. kosmologischen Gottesbeweis beschäftigt. Der Grundgedanke ist der, dass unsere Welt, unsere Endlichkeit, nicht zu Ende gedacht werden kann ohne einen Grund, der vollkommen in sich selbst steht, der diese Welt transzendiert, aber sie auch innerlich trägt. Und diese Begründung – so haben wir dann zum Schluss gesehen – muss so sein, dass sie auch die Selbständigkeit der Welt und der Dinge in ihr begründet bis hin zu dem, was eben besonders selbständig ist, nämlich die menschliche Freiheit.
Wir haben gesehen, dass dieser Grund in seinem Aus-sich-Sein auch ein Für-sich-Sein ist, ein Umseiner-selbst-willen-Sein. Das ist der Grundgedanke des Guten, des Sinnvollen. In dieser Weise lässt sich auch denken, dass die Freiheit in ihrer Selb ständigkeit begründet ist, nämlich von einem Grund, der sie nicht äußerlich determiniert, sondern innerlich trägt, sie herausfordert, sie gleichsam einlädt zu einem Tun und Handeln und Streben nach dem, was in sich selbst sinnvoll ist.
Das ist der Gedanke eines höchsten Guten, und nach Thomas von Aquin ist das ein eigener Gottesbeweis, den er so erklärt, dass wir in unserem Bewerten, d.h. in unserem Urteilen über das, was gut und schlecht ist, einen höchsten Maßstab voraussetzen. Dieser ist aber nicht einfach unsere Konstruktion, sondern hat als höchster Maßstab seine Gutheit in sich selbst. Und das, sagt Thomas, nennen alle Gott.
Dieser Gedanke, dass wir Menschen in unserem Erkennen und in unserem Urteilen auf ein höchstes Gutes ausgerichtet sind, das dann die Qualität hat, die dem Gottesbegriff zukommt, ist ein Gedanke, den Platon entwickelt hat. Es ist interessant zu sehen, wie Platon zu diesem Gedanken kam.
Wir müssen da einen Schritt in die damalige Zeit tun, in die damalige politische und kulturelle Situation des ausgehenden 5. und des Beginns des 4. Jahrhunderts vor Christus. Es ist die Zeit eines geistigen Umbruchs. Damals tobte ein schlimmer Krieg, der Peloponnesische Krieg, der sog. „Dreißigjährige Krieg“ der Antike. Er hat viele Maßstäbe des Verhaltens zum Wanken gebracht. Die alten Traditionen galten nicht mehr. Was gilt nun eigentlich? Gilt nur die Machtpolitik? In seinem Geschichtswerk geht Tukydides darauf ein, dass die Athener in ihrem Kampf gegen Sparta eigentlich nur auf die Macht setzen. Kann das aber das letzte Normgebende sein?
Sophisten
In dieser Zeit, in der eben traditionelle Werte ins Wanken geraten, taucht ein kulturelles Phänomen auf, das man Sophismus nennt. Wer sind die Sophisten? Es sind nicht mehr die Philosophen, wie wir sie kennen gelernt haben, die vorsokratischen Philosophen, die über das Sein und die Arché nachdachten, sondern Wanderlehrer, die für Geld ihre Weisheit verkauften. Und diese Weisheit besteht darin, dass sie den Menschen die Fähigkeit gibt, sich in der Gesellschaft durchzusetzen. Man muss nämlich bedenken: Athen ist eine Demokratie, das heißt: Wer erfolgreich sein will, muss reden können. Er muss sich in der Politik, auch vor Gericht, verteidigen können. Dazu geben die Sophisten den Menschen die entsprechenden Hilfsmittel.
Das wird aber bei den Sophisten verbunden mit einer Sicht der Werte, die man Relativismus nennen kann. Protagoras sagt: Über jede Sache gibt es verschiedene Meinungen. Worauf es ankommt ist, die an sich schwächere Sache zur stärkeren Sache zu machen.
Diese Mittel des Denkens und der Rhetorik stellen die Sophisten zur Verfügung. Die Traditionalisten wenden gegen sie ein. Da gibt es doch feste Werte. Wo käme man hin, wenn man alles relativieren würde. Ihnen entgegnen die Sophisten: Das ist ein Irrtum, eine falsche Vorstellung. Die Werte nicht physei, das heißt irgendwie von sich selbst her oder von Natur her. Sie sind thesei, d.h. sie wurden von den Menschen aufgestellt, und zwar nach ihren bestimmten Interessen. Man kann auch sagen, jeweils nach ihrem Geschmack. Darin besteht dann das Gute. Es ist das, was jeweils aus den Interessen folgt. Jeder nennt eben das gut, was ihm als gut erscheint.
Sokrates und dann in seinem Gefolge sein großer Schüler Platon setzen sich mit dieser Geistesrichtung auseinander. Sie wollen, dass es in diesem Wirrwarr des geistigen Umbruchs wieder zu einer Verständigung über Werte kommt, die von allen akzeptiert werden können. Doch dem stehen die Auffassungen der Sophisten entgegen. Aber Sokrates sieht auch ganz klar, dass man in dieser geistigen Situation nicht anders argumentieren kann als auf der Ebene der Vernunft und der Aufklärung. Man kann eben nicht einfach – wie die Traditionalisten – sagen: Wo kommen wir hin mit diesen Sophisten? Die gehören alle ins Gefängnis! Vielmehr muß man sich geistig mit ihnen auseinander setzen. Und das tun Sokrates und Platon.
Das wahrhafte Gute
In den Dialogen von Platon erleben wir, wie Sokrates sich mit verschiedenen Sophisten – Thrasymachos, Gorgias, Kallikles usw. – auseinandersetzt. Sokrates zieht sie in eine Diskussion hinein, etwa so: Was ist von der These zu halten, dass das Gute jeweils das ist, was wir für gut halten, also jeder Einzelne sozusagen nach seinem Geschmack das Gute bestimmt?
Sokrates stellt die ganz einfache Frage: Kann man sich da nicht irren? Nun ja, das kann man schlecht bestreiten. Wenn ich etwas für gut halte, kann es ja sein, dass es sich als nicht gut für mich herausstellt. Im Moment halte ich es zwar für gut, aber ich kann mich darin irren.
Es geht also in der Bewertung nicht nur um meine subjektive Anschauung, sondern es geht um Wahrheit. Ich will nämlich wirklich das Gute, und zwar das wahrhaft Gute. Dann muss ich mich aber auch darauf einlassen, dass mir jemand widersprechen kann, dass mir jemand sagt: Diese Sache hat verschiedene Aspekte! Ich muss mir Kritik gefallen lassen und prinzipiell zu einem Dialog bereit sein. Platon sagt in diesem Sinne, dass das eigene Nachdenken auch schon ein Gespräch ist, nämlich ein Gespräch der Seele mit sich selbst, durch das man verschiedene Gesichtspunkte sieht und dann auch zu einem Gespräch mit anderen bereit ist. In dem geht es um die Sache und um die Wahrheit.
Das Gute ist also etwas Objektives. Und wenn ich das Gute will, will ich auch wirklich das Gute in einem objektiven Sinn, und zwar so, dass dies auch letztlich das objektiv Gute ist. Ich kann nicht sagen, dass ich mich in meiner Intention, also in dem was ich will, dann doch auf eine einseitige Anschauung beschränke oder mich mit ihr begnüge. Ich kann das auch nicht in Kollektive übertragen und mich mit einem bloßen Konsens begnügen, der zutreffen kann oder auch nicht.
Wenn ich nach dem Guten ernsthaft frage, dann frage ich nach ihm so, dass ich wissen will, was letztlich – und zwar in einer letzten umfassenden Rechtfertigung – das Gute ist. Diese Intention zu leugnen hieße, mir selbst zu widersprechen.
Meine Frage nach dem Guten steht also gleichsam in einem universalen Horizont, den ich zwar nie ganz ausschöpfen kann, auf den aber meine Intention ausgerichtet ist. Dieser Horizont ist das Gute in seinem letzten, umfassenden Zusammenhang. Dieser Zusammenhang kann nur einfachhin und um seiner selbst willen gut sein. Er kann nicht mehr von einem äußeren Faktor her gut werden. Nimmt man dieses umfassende Gute in seinem strikten Sinn, dann ist es klar: Dies kann kein endliches Gutes mehr sein, auch nicht die Zusammensetzung von Gütern, die immer wieder endliche Synthesen sein würden. Jener letzte Horizont kann nur ein unendlich Gutes sein, das vollkommen in sich selbst gründet und deswegen auch vollkommen um seiner selbst willen ist und gut ist.
Platon hat diese Argumentation konkret ausgeführt. Es ist spannend zu sehen, wie er das getan hat. Er hat zum Beispiel (im Dialog “Gorgias”) mit einem Sophisten diskutiert, der ein reiner Machtmensch war, der die pure Macht idealisierte. Für ihn war das Vorbild der große Tyrann, der machen kann, was er will, der auch die größten Begierden haben kann. Er hat die Macht, sein Begehren immer zu befriedigen. Alles, wozu er Lust hat, kann er sich verschaffen. Alle Menschen um ihn herum sind dann seine Sklaven. Er ist der Herr über sie. Er herrscht über alle anderen und hat die absolute Macht. Das ist das Ideal. Das ist das höchste Gute..
Natürlich kann nicht jeder ein solcher Tyrann werden, obwohl es alle wollen. Diese vielen Schwächlinge sagen dann: Wir brauchen Gesetze, um uns vor solchen Tyrannen zu schützen. Doch einer, der kraftvoll ist, der wirklich das Gute erkennt und das Gute für sich will, der schafft es, sich als Machtmensch durchzusetzen und sich über die Gesetze, die nur Hilfsmittel der Schwachen sind, hinwegzusetzen. Eigentlich ist das das Ideal von jedem. Aber die wenigsten ergreifen es. Und die Übrigen sagen: Das darf man nicht tun. Die Gesetze verbieten es. Auch die Moral verbietet es. Sie erfinden auch noch die Götter als Polizisten.
Sokrates sagt zu diesem Sophisten folgendes: Schauen wir uns dieses Ideal einmal genauer an. Du vertrittst also den Standpunkt eines radikalen Egoismus. Alles konzentriert sich auf dich. Die Menschen sind nur deine Sklaven, möglichst nur Marionetten, mit denen du spielst. Kannst du eigentlich Freunde haben? Nein, Freunde kannst du prinzipiell nicht haben. Denn Freundschaft bedeutet Gleichrangigkeit Es würde bedeuten, dass du dir von deinem Freund auch etwas sagen lässt, dass du ihn respektierst, dass du ihn nicht bloß zum Instrument und zu deiner Marionette machst. Du herrschst zwar über die Menschen, aber die Zuneigung, die du bekommst, ist lediglich Schmeichelei. Das ist etwas ganz anderes als Freundschaft. Die Menschen schmeicheln dir, aber du weißt selbst: Das kann sich schlagartig ändern, wenn deine Marionetten nur die Gelegenheit haben, sich gegen dich erfolgreich zu empören.
Bei Freunden ist es anders. Auf Freunde kannst du dich verlassen. Freundschaft besteht in dieser Verlässlichkeit. Und wie ist es eigentlich in dir selbst? Du sagst, du kannst dein Begehren wachsen lassen und es dann immer erfüllen. Bist du eigentlich Herr in deinem Haus? Die Begierden laufen dir doch davon, und du hechelst hinter ihnen her und versuchst sie alle zu befriedigen. Bist du nicht im Grunde dein eigener Sklave?
Kallikles steigt daraufhin aus dem Gespräch aus mit der Begründung:. Ach, red nur weiter, mit dir kann man ja überhaupt nicht reden usw. Das heißt, er merkt, dass ihm geistig der Boden entzogen wurde. Sokrates hat hier im platonischen Dialog die Inkonsistenz eines radikalen Egoismus demonstriert. Man kann ihn nicht konsistent verteidigen. Es ist eine in sich widersprüchliche Position.
Platon und das Staatsideal
Was heißt das nun positiv gewendet? Was ist die Lehre aus einem solchen Dialog? Sie besagt, dass es so etwas wie objektive Maßstäbe des Guten gibt, nach denen wir uns richten müssen, dass also der Einzelne nicht einfach nur für sich allein leben kann, sondern nur in einem sozialen Zusammenhang sein Leben erfüllt. Und es heißt, dass der Mensch, wenn er nach dem Guten strebt, nach einer Ordnung streben muss, in die er als Einzelner eingefügt ist, und diese Ordnung ist dann das Gute. Um diese rechte Ordnung geht es, und zwar politisch und auch in der Seele.
In der Seele muss eine Ordnung sein, denn sie ist ein Gefüge, und in diesem darf nicht das Unterste zum Obersten erklärt werden. Die Ordnung der Seele entspricht dann auch der politischen Ordnung. Und so entwirft Platon ein Staats ideal in seiner Schrift “Politeia”, ein Ideal, in dem die äußere Ordnung mit der inneren Ordnung der Seele verbunden ist. Diese umfassende Ordnung, die das Gute ausmacht, nach dem wir streben, ist ein Ideal, eine Idee. Das heißt, wir sind auf ideelle Maßstäbe ausgerichtet, die für uns das objektiv Gute ausmachen.
Nach dieser ideellen Ordnung sind wir eingefügt in einen Zusammenhang, der auch über das Soziale hinausgeht und den ganzen Kosmos umfasst. Denn das Ideelle konstituiert auch die Welt und die Natur. Wir können nicht einzelnes bejahen ohne anderes mitzubejahen. Diese Mit- Bejahung muss umfassend sein und sich auf den ganzen Kosmos erstrecken. Wenn wir uns selbst bejahen, dann ist das auch ein Mitbejahen unserer Natur, der inneren und äußeren. Das heißt, die äußere Natur hat dann auch ihren Eigenwert, und wir müssen sie entsprechend respektieren. Für die Antike war das eine Selbstverständlichkeit, weil alles durch zogen gedacht wurde vom Leben, von den Göttern und den Nymphen usw.
Aristoteles lehrt, dass alles von Teleologie, also von Ziel- und Sinnhaftgkeit durchwirkt ist. Dies ist ein Ausdruck dieser Mit-Bejahung, in der wir unsere Welt für etwas in sich Bejahenswertes und Sinnhaftes halten. Das dies für die heutige ökologische Frage erhebliche Konsequenzen hat, dürfte klar sein.
Aber Platon geht noch einen Schritt weiter. Das ist dann der entscheidende Schritt zu einem vollkommen in sich Guten, das auch diese Welt nochmals transzendiert. Denn jene Ordnung muss nochmals gründen in einem Guten, das vollkommen in sich selbst steht, in dem es keine Trennung und Andersheit gibt, das vollkommener Selbstbezug ist. Nur dieses Gute kann dann der Garant des in sich Guten sein. Dies nennt Platon die “Idee des Guten”. Sie ist das vollkommen in sich Gute, das in sich selbst absolut Sinnvolle und damit alles in sich selbst Sinnvolle in diesem Kosmos und in unserer Welt Begründende. Sie ist nach Platon kein einzelnes Objekt, so dass wir uns von ihm distanzieren könnten. Es ist umfassend und deshalb nicht mehr distanzierbar.
Diese umfassende Idee des Guten, die so grundsätzlich ist, dass sie alles begründet, dass sie auch meine Subjektivität, sozusagen den Horizont, von dem her wir die Dinge beurteilen, begründet, also auf der Seite der Objektivität steht und auf der Seite der Subjektivität, und die zugleich dasjenige ist, was vollkommen in sich selbst steht und eben so kein Gegenstand der Welt mehr ist, das ist die vollkommen transzendente Wirklichkeit des Absoluten, des absolut Guten.
Die christlichen Kirchenväter der Antike haben in dieser Konzeption Platons einen philosophischen Gottesbegriff gesehen, besonders weil Platon von dieser Idee eine Transzendenz und Immanenz aussagt und ein Jenseits der Begreifbarkeit. All diese entspricht dem christlichen Gottesgedanken. Als Sokrates in der “Politiea” gefragt wird, wie dieses höchste Gute näher zu denken sei, weicht er aus und sagt: Ich kann euch eigentlich nur ein Gleichnis davon erzählen: Das Gute ist wie die Sonne, die das Licht gibt für uns. Dieses Licht beleuchtet die Dinge, die wir deshalb wahrnehmen können. Auch gibt die Sonne der Natur das Wachstum. So ist die Sonne ein “Analogon” der Idee des Guten. Wie die Sonne die äußere Lichtquelle ist, so ist das Gute die innere.
Bei Plotin wird dies im Spätplatonismus so ausgeführt, dass dieses Letzte, Höchste, dieses Gute – oder wie Plotin sagt das Hen (das Eine) – auch in der Seele ist und wir deswegen dieses Gute nur anzielen können, indem wir auch über unser Selbst nachdenken und es in uns als Ausrichtung auf das Gute finden.
Goethe hat diesen Zusammenhang in das Dystichon gefasst: “Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. / Läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnte uns Göttliches entzücken?”
Wir sehen hier, dass in der Ausrichtung auf jenes Höchste und Letzte etwas erreicht wird, was beide Seiten umfasst: das Objektive und das Subjektive. Und weil es eben nicht nur etwas Objektives, Bestimmtes ist, könnte man den Eindruck haben: Das gibt’s eigentlich gar nicht.
Platon hat dafür sogar einen ganz radikalen Ausdruck. Er sagt: Dieses höchste Gute ist “epekeina tes ousias”, d.h. jenseits des Seins. Man fragt sich: Ist es das Nichts? Nein. Es ist nur nichts in dem Sinne, dass wir es nicht objektivierend bestimmen und begreifen können. Es liegt aber allem Objektiven und Subjektiven zugrunde. Insofern ist es mit dem Licht zu vergleichen.
Wir haben auch schon von dem sog. „Wahrheitsbeweis“ von Augustinus gesprochen, wo es darum geht, dass unsere Vernunft von etwas Letztem, Höchsten gebunden ist und sich nach ihm richtet. Das ist für Augustinus die höchste Wahrheit. Man kann sagen, dass dieser Gedankengang sich genau einfügt in das, was Platon anhand der Werte und des Guten entwickelt. Das Höchste ist auch das Höchste im Sinne der Wahrheit, bzw. die höchste Wahr heit ist auch das Gute, das uns Bestimmende, nach dem wir uns richten müssen.
Als Wahrheit ist sie immer eine Zusammenfügung von zwei Seiten. Wir haben an der Wahrheit gesehen, dass sie eine Übereinstimmung ist. In ihr stimmen Sätze mit der Wirklichkeit überein, bzw. unsere Subjektivität mit der Objektivität.
Wahrheit ist also eine Beziehung. Wenn nun die höchste Wahrheit im höchsten Sinne diese Beziehung ist, dann steht sie auf beiden Seiten, dann ist sie der Zusammenklang unserer Subjektivität mit der Objektivität. Dieser Zusammenklang ist die Grundharmonie des in sich selbst Guten, das der Maßstab für unsere Bewertungen ist.
Diese eindrucksvolle Sicht, die man sich immer wieder neu durch den Kopf gehen lassen kann und die...
Inhaltsverzeichnis
- Sophisten