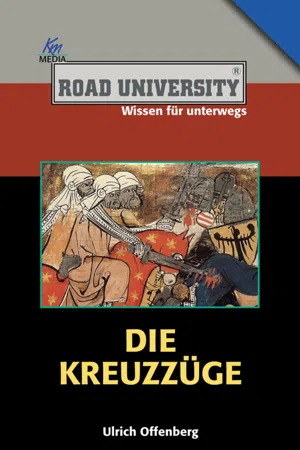
- 128 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Kreuzzüge
Über dieses Buch
200 Jahre lang kämpften, töteten und eroberten Ritter und Gemeine im Auftrag des Papstes im "Heiligen Land". Eine beispiellose, fundamentalistische Raserei des christlichen Glaubens, die Hunderttausende von Menschenleben kostete.
"Deus le volt!" Gott will es! Als Papst Urban II. am 27. November 1095 im französischen Clermont die Christenheit aufforderte, das Heilige Grab in Jerusalem zu befreien, brauch eine wahre Massenhysterie aus. Zwei Jahre brauchten französische und normannische Ritter, bis sie nach furchtbaren Entbehrungen Jerusalem eroberten und ein schreckliches Blutbad unter der Bevölkerung anrichteten.
Das Töten unschuldiger Menschen als gottgefälliges Werk, das hatte es noch nie zuvor in der katholischen Kirchengeschichte gegeben. Die Eroberung des Heiligen Landes war rücksichtslose Machtpolitik der römischen Papstkirche und führte zum Untergang des mächtigen Byzanz.
Knapp 200 Jahre hatte die Enklave im Nahen Osten Bestand. Der sagenumwobene Sultan Saladin vertrieb die Christen aus Jerusalem. Sein Nachfolger, der ägyptische Sultan Baibar, bereitete dem Traum vom heiligen Staat der Christenheit schließlich ein blutiges Ende.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
„Das gottlose Volk der Sarazenen entehrt die heiligen Orte, die einst von den Füßen des Herrn selbst betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei und hält die Gläubigen in Knechtschaft und Unterwerfung. Hunde streifen im Heiligtum umher, das Allerheiligste ist entweiht. Das Volk, das den wahren Gott verehrt, ist erniedrigt und muss unwürdige Unterdrückung erleiden. Die Priester müssen als Sklaven Ziegel brennen, die Fürsten der Länder und die Stadt Gottes, Jerusalem, müssen Tribut zahlen. Will einem nicht die Seele darüber vergehen, will einem darüber nicht das Herz zerfließen? Liebe Brüder: Wer kann das mit trockenem Auge anhören. …“
Es war der 27. November 1095, als Papst Urban II. im französischen Clermont vor einer gewaltigen Menschenmenge diese aufpeitschende Rede hielt. Schon in der Nacht zuvor waren die ersten Gläubigen angereist. Am Vormittag waren es dann an die 3.000 Leute, die den Worten des Heiligen Vaters lauschen wollten. Viel zu viele, als dass sie in der Kathedrale Platz gefunden hätten. Urban II. ließ sich daher zu einer improvisierten Tribüne aufs freie Feld tragen. Die Rede erzeugte jene Stimmung, die man heute als „Massenhysterie“ bezeichnen würde.
Als der Papst eine kleine Pause machte, erklang von irgendwoher zum ersten Mal der Ruf, das altfranzösische „Deus le volt!“, zu deutsch „Gott will es!“. Später, als der Papst mit seiner Rede geendet hatte, erklangen regelrechte Sprechchöre mit „Deus le volt“. Diese drei Worte sollten fortan der Schlachtruf des Kreuzzug-Zeitalters werden.
Als wäre er von den Sprechchören gerührt, ging der Bischof des Wallfahrtsortes Notre Dame de Puy leuchtenden Angesichts auf den Papst zu, beugte das Knie und bat um die Erlaubnis, mit ihm ins Heilige Land zu ziehen, um es zu befreien. Natürlich war diese Inszenierung abgesprochen, man wollte schließlich nichts dem Zufall überlassen. Wenn der Papst solch eine flammende Rede hält und in Gottes Namen zum Kreuzzug aufruft, muss das natürlich sogleich in direkte Aktion münden..
Diese Rede Papst Urban II. war der Funke, der den Flächenbrand auslöste. Die Zuhörer suchten in rasender Eile rotes, später auch nur buntes Tuch zusammen, zerrissen es in Streifen und formten daraus Kreuze. Die Frauen liefen nach Hause und holten ihre Nähnadeln. Umgehend wurde den entschlossenen Streitern Christi mit den Stoffstreifen das Kreuz auf den Wams genäht. Innerhalb von zwei Stunden hatten mehr als 500 Menschen, zumeist junge, arme Adelige, das Kreuz auf der Brust und legten den Eid ab, nach Jerusalem zu ziehen. Wenn nicht, würden sie unverzüglich dem Kirchenbann anheim fallen. Es gab für sie kein Auskommen mehr, egal, was sie tun würden, die Kirchenmacht hatte sie zwischen Himmel und Hölle fest im Griff.
Die politische Ranküne
Papst Urban II. hatte diesen Auftritt sorgfältig geplant. Bevor er die - zugegebenermaßen - große Rede in Clermont hielt, hatte er sich mehrfach mit dem Grafen Raymond von Toulouse und St. Gilles getroffen, einem reichen, im Kampf gegen die Mauren zu Wohlstand gekommenen, angesehenen Feudalherren Südfrankreichs. Der Graf hatte ihn bestärkt, es zu wagen, die Kriegsfahrt nach Jerusalem zu verkünden.
Sein Hauptinteresse aber war, wer denn dereinst Herrscher über dieses reiche Heilige Land sein werde, wenn es erst unter die Oberhoheit der Kirche gebracht sei. Aus seinem späteren Verhalten - er pochte stets darauf, der auserwählte Führer des Zuges zu sein - lässt sich folgern, dass der Papst ihm weit reichende mündliche Versprechen gemacht hatte. Als Gegenleistung bot Raymond an, als erster großer Feudalherr das Kreuz zu nehmen und damit ein Signal von großer Werbewirksamkeit zu geben.
Die beiden Mächtigen besprachen auch taktische Details. In Clermont sollten Boten des Grafen anwesend sein, und sowie der Papst die Rede beendet haben würde, sollten sie vortreten und mitteilen, Raymond von Toulouse nähme das Kreuz, um damit gegen Osten zu ziehen. Und genauso geschah es. Ein abgekartetes Spiel. Und niemanden schien es an jenem 27. November 1095 aufzufallen, dass der Graf, wäre die päpstliche Rede wirklich spontan gewesen, keine Ahnung vom Zug nach Jerusalem hätte haben können. Schließlich war er ja gar nicht vor Ort gewesen.
Der Hilferuf aus Konstantinopel
Der Auftritt des Papstes in Clermont hatte seine eigene Vorgeschichte. Im März 1095 versammelte Urban II. Hunderte von Kirchenfürsten im italienischen Piacenza um sich. Die Tagesordnung war umfangreich. Es ging unter anderem um das Zölibat und die Käuflichkeit der Kirchenämter.
In Piacenza sprach auch eine Delegation aus Konstantinopel beim Papst vor, und das sollte für das Abendland noch von großer geschichtlicher Bedeutung werden. Die Delegation bat um Hilfe gegen die anstürmenden Türken, die die Oströmer in Konstantinopel bedrängten. Ihre Bitte wurde letztendlich der Auslöser für die heiligen Kriege der Christenheit, sie waren die Initialzündung für die Kreuzzüge, die das Abendland verändern sollten wie kein zweites Ereignis danach. Sie sprengten das enge Weltbild des frühen Mittelalters und schufen Raum für die wundersame Blüte der Renaissance.
Der Papst stand dem dringenden Bittgesuch der exotisch gekleideten Menschen aus dem fernen Konstantinopel wohlwollend gegenüber. Es konnte keine bessere Gelegenheit als dieses Ansinnen der Gesandten aus dem Osten geben, um in Europa, vor allem in Frankreich, die unruhigen Elemente loszuwerden und seinem Ideal näher zu kommen, ein großer Kirchenreformer zu sein, der ewigen Frieden auf Erden brachte. Die Delegation sparte nicht mit Schreckensbildern. So erschütternd schilderte sie die Gräueltaten der Türken, dass die Kirchenfürsten angesichts des Elends und der Entbehrungen, die die Christen im Osten angeblich zu erleiden hatten, sogar in Tränen ausbrachen.
Das Geschäft der Bekehrung
Vermutlich hatte Urban II. schon seit seinem Amtsantritt sieben Jahre zuvor darüber gegrübelt, wie er die orthodoxe Kirche des Ostens unter seine Herrschaft bringen konnte. Sein Vorbild war der Glaubenskampf in Südspanien. Seit 400 Jahren kämpften dort die Christen einen wechselvollen Kampf gegen die Mauren. Dabei hatte sich auch jene reizvolle Gewohnheit herausgebildet, die später die Kreuzfahrer leitete: alle Ländereien, die ein Ritter im muselmanischen Land selbst eroberte, durfte er in Besitz nehmen. Freilich nur als Lehen unter päpstlicher Oberhoheit. Als Zugabe wurde die allgemeine Vergebung der Sünden gewährt. Ein für beide Seiten glänzendes Geschäft.
Der Papst unternahm, kaum war er zurück in Frankreich, zunächst eine Wallfahrt zum französischen Nationalheiligtum Notre Dame du Puy im Zentralmassiv in der Nähe von Clermont. Gleichzeitig ließ er das Volk wissen, dass er von Clermont aus eine wichtige Mitteilung an jeden Christen richten werde. Als Termin dafür wurde der 27. November 1095 bestimmt.
Nach der dramatischen Rede des Papstes gingen von Clermont aus Botschaften an alle Fürsten, Barone und Ritter noch in den entferntesten Ländern, Städten und Herrensitzen. Gleichzeitig prasselten eine Fülle von „Ausführungsbestimmungen“, wie man heute sagen würde, auf die künftigen Kreuzfahrer nieder: Der 15. August 1096 wurde zum Abmarschtag bestimmt. Wer daheim irdische Besitztümer zurücklasse, sollte sie unter den Schutz der Kirche stellen. Geistliche und Mönche durften nur mit Erlaubnis des Bischofs mitziehen, Alte und Gebrechliche mussten daheim bleiben, Frauen war die Teilnahme nur in Begleitung ihres Gatten, Vaters oder Bruders erlaubt.
Zum Führer der Heerscharen, über deren Umfang der Papst zu diesem Zeitpunkt noch nicht die leiseste Ahnung hatte, bestellte die Kirchenversammlung einstimmig den Bischof Adhémar von Puy, der sich spontan als erster dem Papst zur Verfügung gestellt hatte. Urban ließ keinen Zweifel: Das Oberhaupt musste ein Mann der Kirche sein. Ihm hatten sich alle weltlichen Herrscher, wie mächtig sie auch sein sollten, unterzuordnen. Klar war zu dem Zeitpunkt auch, dass weder der König von Frankreich noch der deutsche Kaiser am Kreuzzug teilnehmen würden: Beide waren zu dem Zeitpunkt von der Kirche in Acht und Bann gesetzt.
Das Lumpenheer bricht auf
Als hätte der Papst eine Zündschnur entflammt, raste Urbans Idee durch Frankreich, Flandern, Lothringen und griff auf Deutschland und Italien über. Massenversammlungen, die allesamt jener von Clermont glichen und mit dem Schrei „Gott will es!“ und dem Eid der Kreuzfahrer endeten, wühlten Westeuropa auf. Eine Massenbewegung, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte, nahm ihren Anfang.
Der Papst und seine Berater waren davon überzeugt, dass die Streitmacht Christi von den reichen Feudalherren ausgerüstet werden würde. Schließlich bot sich ihnen allen dabei die Chance, unruhige, beutegierige oder landlose Elemente loszuwerden: Das war doch eine größere Investition wert. Ursprünglich waren nur Adelige als Kreuzzügler vorgesehen, denn nur der Ritter führte damals Krieg. Das war keine Sache der Armen oder der Bauern.
Aber es kam völlig anders. Bettelarme, verängstigte und verzweifelte Menschen, die nichts zu verlieren hatten, nahmen das Kreuz am zahlreichsten. Ein Fieber schien die Menschen erfasst zu haben. Sie durchwühlten ihre winzigen Besitztümer, versuchten soviel Geld wie möglich daraus zu machen, luden Frau, Kinder und Kleinvieh auf klapprige Wägelchen und packten ihre bescheidenen Lebensmittelvorräte in Beutel: Gerste, gesalzenes Schweinefleisch und Hirse. Sie beschlugen ihre mageren Kühe und Ochsen mit Hufeisen wie die Pferde, spannten sie vor den Wagen und zogen los.
Sie wussten nicht wohin, also suchten sie die nächstgelegene Stadt auf, etwa Chartres, Paris oder Dijon. Dort lagerten sie vor den Toren, verkauften den Rest ihrer armseligen Habe und wunderten sich, dass die Preise für Gebrauchsgüter fielen. Niemand wollte mehr Kleider, Pfannen oder Becher kaufen. Dafür aber wurden Schafe, Ziegen und Geflügel immer teurer. Getreide gab es fast überhaupt nicht mehr.
Zwielichtige Gestalten ernannten sich zu Führern und der Zug setzte sich schwerfällig in Bewegung. Es ging nach Osten, dem Rhein entgegen. Trotz ihrer abgerissenen Jämmerlichkeit fühlten sie sich als Gottes auserwählte Heerschar.
Der Mönch und der Bettler
Den größten Zulauf, die größte Glaubensglut und die größte Autorität hatte ein gewisser Peter, Bettelmönch aus Amiens. Er wird von seinen Zeitgenossen als sehr klein und hässlich, erschreckend mager und von sehr dunkler Gesichtsfarbe beschrieben. Er selbst und sein Mantel sollen abstoßend schmutzig und stinkend gewesen sein. Er aß kein Fleisch und kein Brot und lebte nur von Fisch und Wein.
Peter war ein schweigsamer Mann - wenn er nicht predigte. Dann aber verkündete er mit donnernder Stimme die Schrekken des jüngsten Tags mit all seinen Schrecken, um gleich darauf wieder unvermittelt in hinreißenden Farben das Gelobte Land auszumalen: Dieses Land, wo Milch und Honig fließt, dieses Paradies, das Gott einst dem Volk Israel gab.
Neben Peter von Amiens auf seinem Maultier, der, einem Heiligen gleich, nach Osten reitet, Gaben entgegennimmt und bereits eine Truhe mit Goldstücken sein Eigen nennt, schwang sich ein ehemaliger Bettler zum Führer empor. Er nannte sich Walter Habenichts, ein Name, der allerdings nicht lange zutraf. Denn während Peter ein wahrer Gottesmann war, der nichts für sich beanspruchte, zog Walter Habenichts eine ins Lachhafte überspitzte Hofhaltung auf. Er ernannte Höflinge, hielt sich einen ganzen Harem, trug Geschmeide und trank nur noch edelste Weine. Mit Peter kam es so zwangsläufig häufiger zum Streit.
Am Karsamstag des Jahres 1096, am 12. April, trafen Peter und Walter mit ihren Pilgern in Köln ein. Es werden etwa15.000 Mann und einige tausend Frauen und Kinder gewesen sein, die da plötzlich, aus Frankreich kommend, vor den Stadtmauern lagerten. Die gastfreundlichen Kölner versorgten gutmütig das bettelarme, ausgehungerte Lumpenheer. Aber das war natürlich kein Dauerzustand. Es stellte sich die Frage aller Fragen: Woher das Geld nehmen, um weiterhin den Feldzug zu bezahlen? Mit Spenden allein war es nicht getan, das sah Peter ein. Da half auch seine Schatztruhe mit den Goldstücken nichts. Er musste eine Geldquelle erschließen, die stetig sprudelte und nicht so bald versiegte.
Peter kam auf eine damals nahe liegende Idee: Die Juden sollten zahlen. Skrupel oder Bedenken hatte hier weder Peter noch der mittelalterliche Mensch überhaupt. Schließlich waren es ja die Juden, die den Herrn gekreuzigt hatten. Und statt in ewiger Buße diese Untat ihrer Vorväter zu sühnen, gelang es ihnen, Geld und Gut anzuhäufen. Ein wahrer Frevel. Die Juden waren in diesen extrem kapitalarmen Zeiten die einzigen, die über bares Geld verfügten, die einzigen, deren Reichtum nicht in unverkäuflichen Ländereien, sondern in gemünztem Gold bestand.
Die Erpressung der Juden
Peter war ein Fanatiker, ein religiöser Einfallspinsel. Aber er war raffiniert. Zunächst ließ er überall, in Frankreich wie in Deutschland, erzählen, in Rouen hätten die Kreuzfahrer die Judengemeinde massakriert. Dieses Massaker war eine pure Erfindung und diente allein dem Zweck, die reichen Judengemeinden einzuschüchtern. Und um noch mehr Öl ins Feuer zu schütten, kehrte Peter in seinen Predigten immer wieder die Schuld der Juden am Tode des Heilands hervor. Er berichtete auch von Juden, die im Heiligen Land mit den Moslems gemeinsame Sache machten und christliche Pilger ausplünderten.
Schon bald kam es zu kleineren Plünderungen in einigen französischen Ghettos. In diesem Augenblick ließ Peter durchblicken, er sehe sich außerstande, die zutiefst verbitterten Massen vor Judenmassakern zurückhalten zu können, es sei denn, er könne in seinen Predigten erzählen, das sich die französischen und deutschen Juden bereit erklärt hätten, zur Befreiung Jerusalems einen erheblichen Geldbeitrag zu leisten. Eine blanke Erpressung, aber die Juden verstanden. Zehn Tage später hatte Peter einen gewaltigen Batzen Gold eingestrichen und ein Schreiben der jüdischen Gemeinde mit der Aufforderung an die Glaubensgenossen, den Überbringer dieses Briefes mit Geld und Lebensmitteln zu unterstützen.
Der Landesfürst Herzog Gottfried von Lothringen, in der Geschichte als Gottfried von Bouillon und erster Herrscher des christlichen Jerusalems bekannt, machte sich die Idee Peters sofort zu Eigen. Er ließ das Gerücht ausstreuen, dass er alle lothringischen Juden umbringen lassen werde, bevor er nach Palästina ziehe; sie dürften nicht friedlich daheim leben, während Christen in einen Kampf auf Leben und Tod zögen. Die Juden gerieten in Panik und boten dem Herzog eine Summe, die heute einigen Millionen Euro entsprechen würde. Daraufhin zeigte Gottfried Milde gegenüber den jüdischen Gemeinden und nahm das Gold gnädig entgegen.
Die Kreuzfahrer ziehen nach Osten
Das Lumpenheer des Peter von Amien und Walter Habenichts wanderte im Laufe des Sommers immer weiter rheinabwärts und überquerte schließlich die Donau. Weiter ging’s durch Süddeutschland und Österreich nach Ungarn. Die tägliche Marschleistung des riesigen Trosses war dabei beachtlich, obwohl die Fuhrwerke voll mit Lebensmitteln sehr schwerfällig waren und wohl auch Frauen, Kranke und Kinder den Marsch verzögerten. Der disziplinlose Haufen, inzwischen auf 35.000 Menschen angeschwollen, legte trotzdem täglich an die 30 Kilometer zurück. Nur zwei- bis dreitausend von ihnen waren beritten.
Ohne einen größeren Zwischenfall erreichte der Zug die Grenze des Oströmischen Reiches. In Semlin, der ungarischen Grenzstadt an der Save, gegenüber der byzantinischen Festung Belgrad, lagerten die Scharen und warteten auf die Erlaubnis aus Konstantinopel, weiter durch das Land von Alexios Komnenos, des Kaisers der Oströmer, ziehen zu dürfen.
Den ersten Zusammenstoß der bunt zusammen gewürfelten Truppe Peters mit dem perfekten, modern anmutenden Beamtenstaat Ostroms kann man sich gar nicht grotesk genug vorstellen. Auf der einen Seite die unwissenden, abergläubischen, abgerissenen Pilgerkrieger mit ihrem Anhang. Auf der anderen die zivilisierten Oströmer, Hüter der hellenistisch-römischen Kultur, deren straffe Struktur dem unendlich schwerfälligen Feudalsystem des Westens Hunderte von Jahren voraus war.
Der bewegliche, mittelmeertypische, griechisch orientierte Geist seiner herrschenden Aristokratie tat ein übriges: Die Abendländer fühlten instinktiv, dass man sie für Barbaren hielt, und die Wut des geistig Unterlegenen gegen den Klügeren vergiftete vom ersten Augenblick an die Beziehung zwischen den einander so fremden Völkerschaften.
Die Pilger sind nicht willkommen
Die Pilger waren anfangs überzeugt, den Oströmern willkommen zu sein. Schließlich waren sie ja die Erretter vor dem Türken-Terror. Aber der oströmische Gouverneur zeigte keine Begeisterung. Sein geübter Blick wird den geringen militärischen Wert dieser Streiter Christi sofort erkannt haben. Er meldete seiner vorgesetzten Dienststelle in Konstantinopel, er sehe keinen Grund, diese Horden in seine Provinz marschieren zu lassen. Im Übrigen bitte er um Weisung. Und dann wartete er ab.Angst hatte er keine. Schließlich verfügte er über eine bestens disziplinierte Söldnerschar, zumeist Türken vom Stamm der Petschenegen. Tapfere Männer, die durch nichts zu beeinflussen waren, weil sie nur ihre Muttersprache verstanden und ihrem Kommandeur stets bedingungslos gehorchten.
Das Kabinett in Konstantinopel beriet. Was war zu tun? Die Tochter des Kaisers, Anna Komnena, schriftstellerisch begabt, beschreibt das Heer des Volkes, das sie selbst gesehen hat: „Diese Menschen, die ein gewisser Kukupetros anführte, waren wie von einer heiligen Glut entflammt. Alle Straßen waren voll von ihren Pferden, ihren Wagen, ihren Männern, Frauen und Kindern. Ihre Stimmung war euphorisch, denn sie waren sich alle gewiss, den Weg Gottes, den Weg des Himmels zu gehen. Die gallischen Krieger trugen, genauso wie die Frauen und Kinder, alle das rote Kreuz auf der Schulter.“
Die Regierung war in einer Zwickmühle: Zurückweisen oder durchmarschieren lassen und verpflegen, das war die Frage. Man beriet tagelang. Indes wurde die Streitmacht Gottes unruhig. Sie plünderten einen ungarischen Bazar, es kam zu einem Handgemenge, das sich zu einem Gemetzel auswuchs. Die Pilger rasten durch Semlin, ein Ritter namens Gottfried Burel ernannte sich zum Befehlshaber. Es gelang ihm, mit einer Schar von Männern die Zitadelle von Semlin zu erstürmen, 3000 Ungarn zu töten und ihre Vorräte zu erbeuten.
Aus Furcht vor Vergeltung flohen diese über den Fluss nach Belgrad, zum oströmischen Statthalter. Zum Glück hatte der mittlerweile genaue Anweisungen aus Konstantinopel erhalten. „Einkaufen lassen, Plünderungen verhindern, von Petschenegen flankieren, zum Weitermarsch antreiben“, lautete der Befehl. Außerdem mussten die Kreuzfahrer Geiseln stellen. Godefroy Burel und andere Ritter wurden nominiert. Die Kreuzfahrer konnten auf oströmischem Gebiet reichlich Lebensmittel einkaufen, die Bevölkerung erwies sich als freundlich und schenkte den ärmeren Pilgern sogar Lebensmittel und Kleider.
Die Banditen und Räuber, die sich dem Zug angeschlossen hatten, waren enttäuscht. Sie forderten mit Nachdruck, man solle sie plündern lassen. Auf dem Weg nach Sofia passierte es dann. Einige Dörfer wurden angezündet. Der Statthalter ließ daraufhin sofort die Söldnertruppen zuschlagen. Man kann nicht von einem Gefecht sprechen.
Der Zusammenstoß mit den geschulten, von Offizieren befehligten Soldaten verlief so, wie später der Zusammenprall eines Indianerstammes mit Pfeil und Bogen mit einer Maschinengewehrkompanie. Binnen einer halben Stunde waren alle Pilger zerstreut, ein Viertel erschlagen, die Schatztruhen Peters von den Petschenegen fortgeschafft, Weiber und Kinder in Gefangenschaft geschleppt, der Rest der Streiter Christi auf wilder Flucht.
Es dauerte viele Tage, ehe sich die Scharen wieder zusammenfanden. Sie waren kleinlaut und sahen in der blutigen Aktion den strafenden Finger Gottes. Der ferne Kaiser in Konstantinopel tat das, was man auch heute tun würde: Er sandte an Peter vonAmiens eine Botschaft, in der er den Vor-fall bedauerte. Im Übrigen, so versicherte er, werde er die Pilger herzlich in seiner Hauptstadt empfangen.
Am 1. August 1096 traf das abendländische Heer am Bosporus ein. Nur fünf Tagesreisen weiter residierte ein türkischer Sultan. Die Kämpfe konnten beginnen. Der Kaiser riet Peter und Walter, auf die Hauptheere zu warten, die der Papst angekündigt hatte. Seine militärischen Experten hatten diesen Haufen schlicht als „Zivilistenpack“ charakterisiert.Aber die Streiter Christi wollten nicht warten. Der Kaiser ließ sie schließlich ziehen. Er war ein erfahrener General und wusste, dass er sie nicht lebend wieder sehen würde.
Das päpstliche Heer lässt auf sich warten
Während das Lumpenheer also im Glauben, einen glorreichen Sieg zu erringen, gegen die türkischen Heiden zog, waren die großen Herren Westeuropas immer noch nicht bereit zum Abmarsch. Sie ließen sich Zeit, die Herren Grafen und Herzöge, Ritter und Barone. Es gab einfach so viel zu ordnen und zu klären: Wer im Falle ihres Todes ihre Güter erben werde, woher man das Geld für Pferde, Rüstungen und Waffen nehmen, wer ihre Gattin überwachen und wer das Besitztum gegen übermütige Feinde beschützen solle. Als der 15. August 1096, den der Papst als Abmarschtermin festgesetzt hatte, herannahte, war noch keiner der Großen abmarschbereit.
Der Papst griff immer wieder in die Vorbereitungen ein. Seinen Legaten gelang es schließlich, einen Plan durchzusetzen, der vernünftig war und auf den Erfahrungen erfolgreicher Jerusalem-Pilger fußte: Man konnte nicht als geschlossene Masse marschieren. Keiner der Länder Europas wäre imstande gewesen, Heere in einer Größenordnung zwischen 30.000 und 50.000 Mann zu ernähren. Urban II. empfahl daher, in vier Heeresgruppen zu marschieren.
Die östliche Gruppe, sie umfasste die lothringischen, brabantischen und wallonischen Ritter, erhielt Gottfried von Bouillon als Befehlshaber und sollte durch Ungarn und Serbien marschieren, also den unrühmlichen Spuren der Schar Peters von Amiens folgen.
Raymond von Toulouse und St. Gilles wählte für sein großes und erstklassig ausgerüstetes Heer einen anderen, besonders schwierigen Weg: Quer durch Norditalien und die ganze endlos lange dalmatinische Küste mit ihren tief eingeschnittenen Buchten entlang bis zum heutigen Albanien, wo das Heer endlich die römische Via Egnatia nach Konstantinopel erreichen konnte.
Raymond, der reiche und ältliche südfranzösische Herr, verkündete, er werde wohl nicht mehr in seine Heimat zurükkkehren. „Das Heilige Grab sehen und dann ruhig sterben“, war sein Wahlspruch. Aber das durfte man nicht für bare Münze nehmen. Später, im Heiligen Land, als es um die Frage ging, wer über Jerusalem regieren solle, zeigte sich Raymond als derjenige, der am begierigsten...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Die politische Ranküne
- Der Hilferuf aus Konstantinopel
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Die Kreuzzüge von Ulrich Offenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.