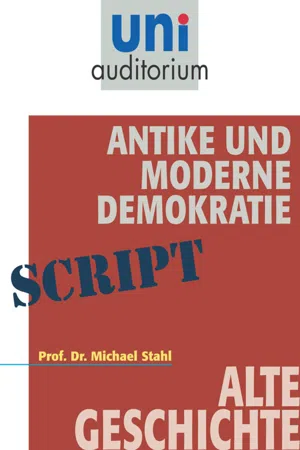
- 14 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Hat die griechische Demokratie einen Platz im modernen Geschichtsbewußtsein? Wie könnte die Brücke aussehen, über die der Historiker von seiner politischen Gegenwartserfahrung aus zu den alten Athenern gelangt?
Vom Selbstverständnis der modernen Demokratie aus betrachtet, erscheint die politische Ordnung Athens in klassischer Zeit als etwas weitgehend Fremdes: Der die beiden Epochen trennende Graben scheint nicht überbrückbar zu sein. Man kann jedoch die Wesenszüge der griechischen Demokratie mit den unübersehbaren Problemen und Schwierigkeiten der modernen Demokratie konfrontieren. Deren Hintergründe werden dann deutlicher, und es eröffnen sich Perspektiven für Weiterentwicklung und Wandel.
Prof. em. Dr. Michael Stahl
hatte bis 2011 den Lehrstuhl für Alte Geschichte an der Technischen Universität Darmstadt. Sein Lehrbuch "Gesellschaft und Staat bei den Griechen" erschien 2003 in zwei Bänden, 2008 präsentierte er "Botschaften des Schönen", Bilder aus der antiken Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Antike und moderne Demokratie von Michael Stahl im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Education & Teaching History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
EducationThema
Teaching HistoryI. Die Grundlegung: Brücken zwischen Gestern und Heute
„Niemand wird heute der Illusion verfallen, die Antike hielte Lehren für eine zukünftige Welt in Händen. Sie ist untergegangen in der strengen Bedeutung des Wortes, und wer ihre Toten beschwört, befragt sie nicht mehr nach verbindlichen Lebensregeln.“
Mit diesen Worten resümiert der Althistoriker Werner Dahlheim die nunmehr etwa 200-jährige wissenschaftliche Erforschung des Altertums. Die Altertumswissenschaft hat im Laufe dieser zwei Jahrhunderte trotz mancher gegenteiliger Bemühungen ihre lebensweltlichen Wurzeln tatsächlich weitgehend verloren.
Aber auch außerhalb der akademischen Mauern löste sich jene klassizistische Traditionspflege der Antike als selbstverständliches und integrales Element der öffentlichen Kultur bereits vor mehr als zwei Generationen praktisch in Luft auf – von einigen randständigen Residuen abgesehen.
Freilich: Zerstört haben den Glauben an die sinnstiftende Kraft der Antike nicht zuletzt die Historiker selbst. Sie haben, wie Dahlheim notiert, „die Griechen wieder in ihre eigene Welt zurückversetzt und sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen.“
Diese sog. historistische Strömung gibt denn auch in der Altertumswissenschaft bis heute den Ton an. Ihr geht es darum, die Antike möglichst weit von uns wegzurücken, damit wir erkennen können, wie für uns fremd es bei den Alten zuging. Und deshalb hätten wir Modernen nichts mehr mit ihnen zu tun.
Wenn das richtig wäre, so liefe es darauf hinaus, daß die Erinnerung an Griechen und Römer für uns keinen Deut wichtiger wäre, als die an die Vergangenheit von Indern, Chinesen oder Südseeinsulanern. Das interessierte Publikum fragt sich dann allerdings, warum von Seiten der Sachwalter der antiken Hinterlassenschaften häufig keine Mühen und Kosten gescheut werden, eben diese Antike so opulent wie möglich zu präsentieren – in Museen oder teilweise großartigen Ausstellungen. Und die dortigen Besucher, zumeist nicht gering an Zahl, empfinden sich keineswegs naiv und unaufgeklärt, wenn sie von der Schönheit eines antiken Kunstwerks einfach überwältigt werden und überhaupt den Eindruck mitnehmen, das Gezeigte ginge sie und ihre Zeitgenossen doch etwas an.
Der Wissenschaftsbetrieb allerdings ist weithin geprägt von interesseloser Gleichgültigkeit. Man möchte nicht wahrhaben, daß die These der vollkommenen Andersartigkeit oder Alterität der Antike in der Sache falsch ist.
Denn die Prägekraft der antiken Tradition für die europäische Kultur bis in die Gegenwart ist trotz aller Mythenzerstörung nicht ernsthaft zu leugnen. In vielen Bereichen unseres Lebens – von unserer urbanen Lebensweise bis zu den Grundbegriffen der Kunst und Philosophie, von Politik, Recht, Verwaltung und Religion bis zur technischen Formung der natürlichen Lebenswelt – stehen wir, ob wir es zustimmend zur Kenntnis nehmen oder nicht, nach wie vor auf den Schultern der antiken Welt.
Und im übrigen ist die Alteritätsthese auch theoretisch falsch: das gesamte, nicht erst neuzeitliche Geschichtsdenken hat seit jeher als unabdingbare Grundlage für Geschichte die Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit erkannt. Der Gedanke der Alterität gründet sich hingegen auf die Vorstellung der Einzigartigkeit der Moderne mit ihren beiden Grundpfeilern Fortschritt und Emanzipation, und das heißt eben auch Befreiung von überkommenen Bindungen und Verpflichtungen.
Mit der permanenten Zerstörung von Tradition werden die Brücken zwischen Gegenwart und Vergangenheit eingerissen, und das Vollgefühl des modernen Singularitäts- und Befreiungsbewußtseins entzieht auch dem Historiker die Geschäftsgrundlage: den Neu-, Um- und Weiterbau jener Brücken, die das Heute mit dem Gestern und Vorgestern verbinden.
Das aber bedeutet den Verlust von Geschichte und damit den Rückfall in vorhochkulturelle Verhältnisse. Wir sind vermutlich nicht sehr weit davon entfernt und sehen zugleich, wie zahlreiche Entwicklungslinien der Moderne zunehmend fragwürdig werden.
In diesem sich abzeichnenden epochalen Umbruch zu einer anderen Moderne, wie schon früher an den Knotenpunkten der europäischen Geschichte, wird es wichtig, die Vormoderne als einen notwendigen, weil zukunftshaltigen Teil unseres Geschichtsbewußtseins zurückzugewinnen. Denn der Rückgriff auf die antike Geschichte als ein produktives, lebendiges und kritisches Medium für die Entwürfe von Zukunft meint gerade nicht Affirmation bestehender Verhältnisse oder Flucht in eine idealisierte Vergangenheit.
Die antike Vergangenheit in Perspektiven der Gegenwart hereinholen – was kann das heißen? Es heißt nicht, Phänomene der Antike auf einer vordergründigen Ebene zu aktualisieren und etwa Modernes in ein äußerlich antikes Gewand zu hüllen (wie z.B. bei manchen Inszenierungen bei den Olympischen Spielen oder der Verarbeitung der Antike im Film oder in der Werbung). Genauso wenig kann es umgekehrt heißen: im Antiken das Moderne im Verhältnis eins zu eins wiederzufinden.
Perspektivierung des historischen Blicks heißt auch nicht: die Antike als absolut gesetztes Vorbild wiederholen zu wollen. Das Ergebnis wäre auch in diesem Fall in ästhetischer Hinsicht Kitsch und in der Aussage unverbindlich. Die Ausfertigung von Patentrezepten ist nicht statthaft, und einfach übertragbare Lehren sind nicht zuhaben.
Die Antwort lautet vielmehr: Die aus der Gegenwart gewonnenen Perspektiven auf die Antike fördern an dieser etwas zutage, das auf einer dritten Ebene, einem tertium comparationis, liegt. Über die Epochenbrüche hinweg kann man auf dieser Vergleichsebene beiden Zeiten gemeinsame Probleme und Aufgaben identifizieren. Ziel ist auf diese Weise die bewußte und reflektierte Wiederaneignung von antiker Vergangenheit als Teil unserer Geschichte.
II. Die Fremdheit der griechischen Demokratie
Warum wir die Antike in erneuerter Form brauchen und wie wir dahin kommen, möchte ich an einem wichtigen Beispiel vorführen. Es ist nur wenig mehr als 2500 Jahre her, daß die Griechen, im Athen des ausgehenden sechsten vorchristlichen Jahrhunderts, mit der endgültigen Institutionalisierung einer bürgerstaatlichen Ordnung eine neue Seite der Weltgeschichte aufschlugen. Wir können auf ihr, wie zu zeigen sein wird, gerade heute mit Gewinn lesen.
Daß wir es bisher nicht genügend tun, ist die Folge des geschilderten Selbstverständnisses insbesondere der deutschen Geschichtswissenschaft. In den USA hingegen erfuhr das 2500-jährige Jubiläum der Demokratie durchaus mehr öffentliche, von der Wissenschaft begleitete Aufmerksamkeit.
So ist es kein Wunder, daß kein umfassender und systematischer Vergleich zwischen antiker und moderner Demokratie existiert. Das kann natürlich in diesem Rahmen nicht nachgeholt werden. Aber es ist doch möglich darüber nachzudenken, wie ein solcher Vergleich aussehen könnte und was dabei in den Blick kommen müßte.
Mit der Bezeichnung „antike Demokratie“, ein für alle Mal sei es gesagt, ist nach unserer Überlieferungslage primär die politische Ordnung Athens vom ausgehenden sechsten bis gegen Ende des vierten vorchristlichen Jahrhunderts gemeint. Parallele Entwicklungen gab es allerdings in den meisten griechischen Gemeinden, wir kennen sie freilich nur bruchstückhaft.
Mit unserem Thema haben sich nur wenige Arbeiten befaßt, und sie gehen alle von einem tiefen Graben aus, der die moderne Demokratie trennt und grundlegend unterscheidet von ihrem antiken Vorläufer.
„Die alte griechische Demokratie war doch etwas ganz anderes als die Staats- und Gesellschaftsform, in der wir heute leben.“ So vor etlichen Jahren der Althistoriker Fritz Gschnitzer vor einem Forum von Geschichtslehrern. Gschnitzer führt eine Reihe von Beobachtungen an, aus denen für ihn die Andersartigkeit der Demokratie bei den Griechen hervorgeht: die direkte geschichtliche Folgenlosigkeit der griechischen Demokratie; die Konkurrenz anderer Staatsformen; die Größe der Gemeinwesen; die Untrennbarkeit von Politik und Leben; die Dominanz des Krieges; das Übergewicht des Volkswillens; die heimliche Oligarchie.
Etwa zur gleichen Zeit erschien eine umfangreiche, seitdem maßgeblich gewordene Gesamtdarstellung der athenischen Demokratie von dem Althistoriker Jochen Bleicken. Er verglich die funktionalen Strukturen der athenischen Demokratie mit denen der modernen.
Auch Bleicken ist davon überzeugt, daß man in Athen nicht „den Anfang oder den Urzustand demokratischer Ideen und Institutionen“ finden könne, auch er konstatiert also eine fundamentale Differenz.
Die von beiden Autoren vorgetragenen Argumente sind repräsentativ für die Auseinandersetzung mit unserem Thema in der Moderne. Die Vergleichsmomente haben jedoch ein unterschiedliches Gewicht. Ich möchte sie nun im einzelnen besprechen und beginne mit eher Äußerlichem und Mißverstandenem:
1. Kurzlebigkeit und Folgenlosigkeit: War die athenische Demokratie eine kurzlebige Erscheinung? Immerhin hat sie institutionell voll entwickelt fast 200 Jahre existiert, und die Entstehung ihrer Idee datiert sogar noch einmal fast 100 Jahre früher.
Und aus der Tatsache, daß zwischen antiker und moderner Demokratie kein unmittelbarer Traditionszusammenhang besteht, kann nicht gefolgert werden, daß das eine mit dem anderen nichts gemein hätte. Die Tatsache darf nicht ignoriert werden, daß es im Laufe von 2500 Jahren wiederholt zu Rezeptionen, also bewußten Rückgriffen, gekommen ist, wenn es in späterer Zeit darum ging, wieder Demokratien einzurichten.
2. Alternative Staatsformen: Die Konzentration des heutigen Blicks auf die Demokratie als die griechische Staatsform schlechthin rechtfertigt sich nicht zuletzt durch die bleibend auf den Bürgerstaat bezogene Identität der Griechen selbst. Außerdem mißachtet der Verweis auf vergangene Vielfalt das für jede Geschichte grundlegende Prinzip der Auswahl.
3. Das Größenargument: Das ist, weil auf den ersten Blick vermeintlich evident, ein sehr beliebter Einwand. Wie könne man überhaupt millionenstarke Bürgerschaften der Gegenwart vergleichen mit einer griechischen Polis, die oft keine tausend Köpfe zählte?
Aber aus der schieren Größe ist eine strukturelle Differenz nicht notwendig abzuleiten. Schon innerhalb der bürgerschaftlich verfaßten Griechengemeinden gab es enorme Größenunterschiede. Und die modernen Kommunikationstechniken demonstrieren zunehmend, daß direkte Partizipation auch in nach Millionen zählenden Bürgerschaften im Prinzip möglich ist.
4. Der Krieg als Hauptgeschäft: Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß Art und Umfang der politischen Agenda sich im Vergleich stark unterscheiden. Daß dabei in der athenischen Demokratie der Krieg eine überragende Rolle spielte, ist jedoch in diesem Zusammenhang weniger von Belang. Es fordert vielmehr dazu auf, über die Aufgaben staatlicher Ordnung grundsätzlich, also auf der vorhin genannten dritten Ebene nachzudenken. Darauf komme ich noch zurück.
5. Die Politik als Lebenselement: Das Ineinander von Politik und Alltagsleben oder besser: dessen durchgreifendes Betroffensein von Politik ist für die Griechen gerade nicht typisch.
Die Bürgergemeinde und das Haus des einzelnen Bürgers bildeten deutlich getrennte Sphären. Dazu ganz gegensätzlich scheinen die Erfahrungen in unserer Gegenwart zu sein, in der das freie gesellschaftliche Leben des Bürgers durch einen übermächtig eingreifenden Staat immer stärker eingeschränkt wird.
Der Vergleich führt daher weiter, wenn man, wie Bleicken es tut, nach der Bedeutung der politischen Partizipation für den einzelnen Bürger fragt. Denn die athenischen Bürger übten eine direkte Regierung über sich selbst aus. Dieses Prinzip war, wie Bleicken bemerkt, „beinahe bis zur Absurdität auf die Spitze getrieben“. Es waren nämlich „alle Athener, faktisch möglichst viele von ihnen Souverän, Regierung, Amtsträger und Gerichtsherr zugleich“.
Um diese Rolle jedem Bürger zu ermöglichen, wurden alle Barrieren für die direkte Teilnahme an der Politik, so weit es nur ging, beseitigt. Denn die politische Tätigkeit besaß für den Athener einen Wert an sich.
Dies nun gilt ebenso für die Idee der Demokratie in der Moderne. Dennoch wird hier fast allgemein das im alten Athen erreichte Ausmaß an tatsächlicher und unmittelbarer politischer Beteiligung für undurchführbar gehalten. In der politischen Praxis hat es sich daher nur in besonderen Fällen durchgesetzt, etwa in der Schweiz.
6. Die Bedeutung des Volkswillens: Die umfassende und direkte Teilhabe aller Bürger am politischen Leben gewährleistete, daß demokratische Beschlüsse den Willen der Masse des Volkes zum Ausdruck brachten. Erstaunlich ist im Rückblick nicht nur, wie lange dieser Grundsatz aufrechterhalten werden konnte, sondern auch daß er in der Regel zu sachgerechten Entscheidungen geführt hat.
Das hängt allerdings vor allem an zwei Voraussetzungen: Die Volksversammlung hat sich bei ihrer Urteilsbildung von Fachleuten beraten lassen, wir kommen darauf gleich noch zurück. Und sie fühlte sich immer gebunden an das vorhandene Netz von traditionellen Verhaltensregeln und Gesetzen. Oberste Richtschnur dabei war, daß Wille des Volkes nur sein konnte, was sich am Gemeinwohl orientierte. Dieses wiederum war durch die Beispiele der Väter in der Geschichte des Bürgerstaates klar vorgegeben.
Gerade solche unstrittigen Vorgaben der Tradition sind durch deren zunehmende Erosion heute kaum noch vorhanden. Der politische Blick richtet sich statt dessen unter dem Zeichen des permanenten Wandels primär auf den Fortschritt in eine zu schaffende bessere Zukunft.
Sie herbeizuführen, ist die Aufgabe einer möglichst starken Regierung, und der Volkswille kommt deshalb vornehmlich in deren Wahl und indirekter Kontrolle zur Geltung. Dies hat aber, wie Bleicken richtig feststellt, „mit dem athenischen Demokratieverständnis nichts mehr zu tun“.
7. Das Verständnis von politischer Führung: In der modernen Demokratie ist die Regierung die anerkannte Instanz von Machtausübung, solange sie von einem Parlament wirksam kontrolliert wird und solange ihre Kompetenzen fest umgrenzt sind. Dagegen hat es in der athenischen Demokratie eine Regierung als eigenständiges Machtzentrum nicht gegeben. Die staatlichen Funktionäre übten nicht Macht aus im Auftrage des Volkes, sondern blieben ganz in die Bürgerschaft eingebunden und agierten eher als deren Helfer und Vermittler denn als wirkliche Verwaltungsträger.
Für eine exekutive Rolle kamen in der athenischen Demokratie somit sämtliche Bürger in Betracht, und alle, die wollten, sind – in der Regel durch das Los – tatsächlich mit bestimmten Regierungsaufgaben betraut worden. Aristoteles hat in seiner politischen Theorie daher ganz treffend von der Identität von Herrschen und Beherrschtwerden gesprochen.
Deswegen boten die meisten Ämter auch keinen Ansatzpunkt für die Bildung einer Schicht von Berufspolitikern. Die Athener sorgten mit allen Mitteln dafür, daß Politiktreiben eine Angelegenheit der Bürgerschaft als ganzer blieb, ja sie gingen dafür sogar das Risiko von gelegentlichen Fehlentscheidungen und Mißerfolgen ein.
Natürlich mußten politische Entscheidungen angestoßen, informiert, geklärt und formuliert werden. Auch dafür durfte sich jeder Bürger, der das wollte, aufgerufen fühlen und in den Versammlungen des Volks das Wort ergreifen. Doch taten das zumeist diejenigen, die dafür die persönlichen Voraussetzungen und Neigungen besaßen. Die Überlieferung nennt sie Redner, Politiker oder Demagogen, und ohne sie konnte das Volk nicht zu Entscheidungen kommen.
Je engagierter ein Redner die Initiative ergriff, je kompetenter er die zur Entscheidung anstehende Sache auseinanderlegte, die Handlungsoptionen erörterte und je bündiger er einen Antrag formuliert...
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Grundlegung: Brücken zwischen Gestern und Heute