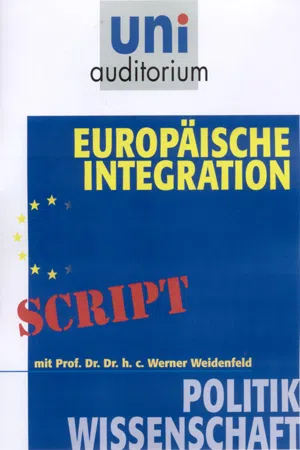
- 14 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
GESCHICHTE
Am Anfang standen Krieg, Verwüstung, Leid. Plötzlich machen sich einige Staaten Europas auf, ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten. Entlang welcher Leitbilder entwerfen sie dieses Projekt ohne Vorlage? Was sind die wichtigsten Stationen der europäischen Einigung?
INSTITUTIONEN
Die politischen Systeme der Nationalstaaten sind vielen von uns ein Begriff. In der Europäischen Union aber wird "überstaatlich" regiert. Welche Institutionen gibt es und was sind ihre Aufgaben? Was hat die EU-Verfassung mit all dem zu tun?
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
Die Europäische Union hat schon heute 27 Mitglieder. Trotz vieler Gemeinsamkeiten hat jedes Land eigene Interessen und Ideen. Wie können diese unter einen Hut gebracht werden? Die Entscheidungsverfahren spielen deshalb eine besondere Rolle. Wie funktionieren sie in der Europäischen Union? Wie können sie weiter verbessert werden?
ZUKUNFT
Die Europäische Einigung lässt sich nur aus unserer gemeinsamen Geschichte verstehen. Aber sie ist vor allem eine Aufgabe für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Wo liegt die Zukunft der europäischen Einigung?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Europäische Integration von Werner Weidenfeld im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Die vielen Gesichter Europas
Europa zeigt mehrere Gesichter. Es ist widersprüchlich, ambivalent, aber alles gibt ein Stück weit die Wirklichkeit wieder. Zum Beispiel: es gibt das große Gesicht der Erfolgsgeschichte Europas. Über Jahrhunderte haben sich die Europäer auf den Schlachtfeldern getroffen, haben Kriege gegen einander geführt. Haben sich wechselseitig vertrieben. Europa kennt die großen Ruinen.
Aber nach dem zweiten Weltkrieg hat man dann den Kompass der politischen Kultur total umgekehrt. Man hat das Koordinatensystem neu gewendet und statt mit Armeen gegen einander los zu gehen, hat man sich auf eine Rechtsordnung geeinigt. Also nicht mehr die rohe Gewalt sollte in Europa entscheiden, sondern es sollte geregelte Formen der Konfliktaustragung geben. Eine große historische Erfolgsgeschichte, weltweit bewundert. Viele haben damals von einer Art „Wunder der europäischen Integration“ gesprochen.
Dann gibt es das Europa der kleinen, pragmatischen Fortschritte. Schritt für Schritt den Binnenmarkt vollendet. Eine gemeinsame Währung eingerichtet. Wettbewerbskontrolle eingeführt. Den Binnenmarkt weitergebracht. Die Frage der Wettbewerbskontrolle intensiviert. Irgendwann mit der Koordinierung der Außenpolitiken begonnen.
Und dann gibt es das Europa der Krise. Ineffizient, stagnierend, intransparent und das in einer Situation, wo dieses politische System Europäische Union unglaublich mächtig geworden ist Wir haben ja über Jahrzehnte Kompetenzen vom Nationalstaat auf diese Europäischen Union übertragen. Unser Leben wird heute von 6.000 Bundesgesetzen geregelt, aber von 12.000 europäischen Gesetzen. Also hier, wenn wir über Europa sprechen, sprechen wir über ein riesiges Machtkonglomerat, das sich dort gefunden hat.
Konzeptionelle Spaltung Europas
In dieser Situation von Fortschritt und Krise gleichzeitig, bleibt es nicht aus, dass dadurch Grundsatzdebatten aller Art geführt werden. Worauf soll diese Integration überhaupt hinaus laufen? Hat die Erweiterung irgendwo einmal eine Grenze? Wie kann man eine zuverlässige Grundordnung herbeiführen für diesen großen Kontinent? Alles das steht heute auf der Tagesordnung und wir führen diese Diskussion auch kontrovers. Man kann geradezu von einer konzeptionellen Spaltung Europas sprechen. Auf der einen Seite diejenigen, die sagen: „Das geht nur, wenn wir so etwas wie die ‚Vereinigen Staaten von Europa’ bilden“. Der Hauptfürsprecher einer solchen These ist zurzeit der belgische Ministerpräsident.
Auf der anderen Seite die Gegenthese: „Wir sind doch nur einem gemeinsamen Markt beigetreten“, wie der britische Premierminister sagt. Also zwei ganz unterschiedliche Bilder von der Zukunft Europas, die miteinander ringen.
Dann müssen wir hinzuziehen, dass wir in den letzten 15 Jahren Geschichte im Zeitraffer erlebt haben. Praktisch in einem Wimpernschlag der Historie haben wir das Ende der Teilung Deutschlands, das Ende der Teilung Europas erlebt. Den Untergang einer Weltmacht, der Sowjetunion, das Ende einer Ideologie, des Kommunismus mit seinem universalen Herrschaftsanspruch. Dann die Erweiterung der Europäischen Union, die Schaffung einer gemeinsamen Währung. Alles das in einem kurzen Augenblick der Geschichte. Dann ist es ganz klar, dass wir so etwas wie ein „Ermüdungssyndrom“, eine leichte Abschlaffung der europäischen Kräfte durchaus einmal in solch einer Zeit der Hektik und der Veränderungen erleben können. Gleichzeitig kann man beobachten, dass wir schwache Mitgliedsstaaten haben. Wie soll dieses Europa stark sein, wenn seine Mitgliedsstaaten nach innen schwach sind?
Also: wir haben einen sehr komplizierten Gegenstand, den wir erklären müssen. Denn wie soll man das Ganze denn verstehen? Wir haben an keinem Punkt so etwas wie eine Art Masterplan. Also nicht eine einfache Formel, die ich Ihnen jetzt nennen könnte und damit wäre in Europa alles erklärt. Nein, das gibt es nicht, vielfach reiner Wildwuchs. Da ist Zentimeter an Zentimeter angedockt worden. Man sieht nicht wirklich ein großes Erklärungsschema dafür und nichts von dem, was sich dort entwickel hat, hat sich parallel zu den nationalen Traditionen entwickelt. Wir könnten es uns sonst ja leicht machen. Schauen Sie auf Ihr Heimatland und Sie wissen, wie Europa funktioniert. Nein, dieser Weg ist uns verstellt.
Man muss die komplizierten Interessenlagen kennen, die Motive muss man sehen. Die verschiedenen Zentimeter Entwicklungsformen genau wissen. Die Schichten der Zeitgeschichte Europas. All das zusammen erst lässt uns dieses große, bedeutende, aber komplizierte Gebilde verstehen.
Ein europäischer „Flickenteppich“
Es stellt sich uns also zunächst einmal die Frage: „Über welches Europa sprechen wir denn?“ Wenn Sie einen Blick auf die politischen Organisationen Europas werfen, dann werden Sie feststellen, dass es davon ein ganze Reihe gibt. Also das ist nicht von vorne herein klar. Die größte Organisationsform, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, mit 55 Mitgliedern. Aber ein ganz lockerer Verbund. Die haben nicht die Absicht, sich supernational zu organisieren.
Dann gibt es den Europarat mit 46 Mitgliedern. Dieser Europarat war nach dem zweiten Weltkrieg ursprünglich die große politische Vision. Daraus geworden ist aber nur eine sehr viel bescheidenere Lösungsform. Der Europarat will gewisse Rechtsgrundlagen gemeinsam legen und hat das auch getan und ist ansonsten ein Kommunikationsforum der Abstimmung.
Ernster – und damit kommen wir zu dem Punkt, der uns hier bewegen soll – die Europäische Union mit heute 27 Mitgliedstaaten. Aber auch hier ist es nicht so einfach, denn nicht alle Europäischen Unionsmitglieder gehören den anderen Organisationen an. Nur alle gehören dem Europarat an. Aber beipielsweise der Nato, einer anderen Organisation, gehören sie nicht alle an. Sie gehören auch nicht alle dem Euroraum an, also der gemeinsamen Währung. Sie gehören auch nicht alle dem sogenannten Schengenraum an, also dort, wo die Europäer ihre innere Sicherheit gemeinsam organisieren wollen.
Wir haben also so eine Art „geschichteten Flickenteppich“ in Europa. Nur 9 Staaten in Europa gehören allen europäischen Organisationsformen an. Wenn man also vom häufig sogenannten Kerneuropa spricht, kann man sagen: Schauen wir auf diese Spinne der verschiedenen Organisationsformen und wir werden herausfinden, dass 9 Staaten allen angehören und faktisch durchaus solch einen Kern bilden.
Dann gibt es die verschiedenen Beitrittskandidaten zur Europäischen Union, also Kroatien, Mazedonien, die Türkei, das große Kontroversthema. Ich will darauf aufmerksam machen, dass wir schon heute so etwas wie eine Schichtung in Europa haben, so etwas wie eine differenzierte Integration, ein ganz wichtiges Bild, um über die Zukunft Europas nachzudenken. Eine Differenzierung also. Ein Teil der Staaten gehört verschiedenen Organisationsformen an. Mächtigstes Zentrum ist die Europäische Union. Im folgendem sprechen wir über diese Europäische Union mit den 27 Mitgliedstaaten.
Der „Magnetismus“ der Union seit den Römischen Verträgen
Es fällt sofort auf, diese Union hat über Jahrzehnte einen großen „Magnetismus“ entwickelt. Sie begann in den 50er Jahren mit 6 Mitgliedstaaten, den großen, Frankreich, Deutschland, Italien und den kleinen, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Das ist die Keimzelle der eigentlichen supernationalen Integration. Dieser Magnetismus hat immer mehr Staaten an sich gezogen – bis heute 27 – und hat gleichzeitig über die Jahrzehnte immer mehr Kompetenzen an sich gezogen. Selbst die, die als Politiker häufig gegen Europa gesprochen haben, sind dann nach Brüssel gereist und haben Kompetenzen übertragen und dem ihre Stimme gegeben. Weil die Themen, die Aufgaben, die sich der Politik stellen, eben häufig aus nationalen Grenzen ausgewandert sind und gar nicht mehr national zu regeln sind.
Das spüren auch ganz national denkende Politiker, die eigentlich gerne alles selbst in der Hand haben wollen, aber sie spüren, das kriegen wir nicht mehr alleine hin, das können wir nur im europäischen Verbund regeln. Um es etwas präziser zu machen mit dieser ja großen Erweiterungsgeschichte Europas: es begann mit den Römischen Verträgen im März 1957, mit den 6 Staaten. Sie hatten einen kleineren Vorläufer 1952 mit der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Also dort hatte man dieses Marktsegment Kohle und Stahl vergemeinschaftet. Das war damals symbolisch ganz eng und dicht gefasst, denn dahinter vermutete man eigentlich die Kriegsindustrie. Kohle und Stahl war ökonomisch bedeutsamer als heute und gleichzeitig ein Symbol für Kriegsindustrie und das sollte nationalen Händen entzogen sein.
Aber ernst wurde es mit den Römischen Verträgen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft. Damit war man mit 6 Staaten zusammen. 1973 gibt es dann die erst Erweiterungsrunde mit Dänemark, Irland und Großbritannien. Damit waren wir 9 Staaten. 1981 kommt Griechenland dazu, dann sind wir 10, 1986 Spanien und Portugal, 12, 1995 kommen Österreich, Finnland und Schweden dazu, dann sind wir 15. Dann 2004 treten gleichzeitig 10 Staaten bei. Sehr stark aus Osteuropa nach Ende des Ost-/Westkonflikts. Also, 2004 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta, und Zypern. Damit umfasst die Europäische Union 25 Staaten und dann 2007 Bulgarien und Rumänien und wir haben den heutigen Zustand der 27 Staaten.
Nun, wie hat das Ganze denn funktioniert? Ich habe darüber gesprochen, dass es eigentlich eine Kriegs- und blutige Geschichte ist, auf die Europa zu diesem Zeitpunkt aufbaut und dann sich wendet und eine andere Art von Vision, wie man Politik betreiben soll, realisiert.
Europas Suche nach einem neuen Selbstverständnis
Da kommen eine ganze Reihe von Motiven und Interessen zusammen zu diesem Zeitpunkt am Ende des zweiten Weltkrieges. Da sind zunächst einmal die Negativerfahrungen, also der Krieg. Das wollte man nicht mehr. Aber das gab einen ganz großen Anschub – Negativerfahrung, großer Weltkrieg. Das Elend, das damit einherging, die Unfreiheit, die mangelnde Freizügigkeit, auch der weltpolitische Gesichts- und Gewichtsverlust der Europäer. Sie hatten ja eigentlich nach dem zweiten Weltkrieg nichts mehr zu sagen. Sie haben über Jahrhunderte die Welt dominiert.
Das ins Positive gewendet ergibt als Motivationsskala den Wunsch nach einem neuen Selbstverständnis. Diese Art nationalistischer Verirrung und nationalistischer Perversion wollte man hinter sich lassen. Man wollte eine ausbalancierte Identität. Sehr wohl sollte man Deutscher, Franzose oder Brite oder Italiener sein, aber man wollte gleichzeitig Europäer sein. Keine Schicht der Identität sollte, wie im Totalitarismus geschehen, alles dominieren. Also der Wunsch nach einem neuen Selbstverständnis.
Hinzu kommt der Wunsch nach Sicherheit. Sowohl nach innen wie nach außen. Es hatten die Europäer ja untereinander und dann auch gegen außereuropäische Mächte Krieg geführt. Beides kommt zusammen. Man wollte nach innen keinen Krieg mehr gegeneinander führen, aber man wollte sich auch absichern gegenüber der Bedrohung von außen. Es hatte sich ja nun eine gigantische Weltmacht herausgebildet, die Sowjetunion, die sichtbar einen expansiven Kurs verfolgte und die Westeuropäer fühlten sich echt bedroht. Sie hatten Sorge um ihre Sicherheit. Wussten aber, jeder einzelne westeuropäische Staat allein ist viel zu klein, um diesen gigantischen Machtapparat der Weltmacht Sowjetunion auch nur widerstehen zu können.
Dann gab es die Hoffnung auf Prosperität. Dieser ruinierte Kontinent wollte auch wieder im Wohlstand leben. Die Marktbedingungen eines jeden einzelnen Nationalstaates waren jedoch viel zu klein, um wirklich im großen Stil ökonomisch agieren zu können. Gemeinsam hingegen hat man eine doch auch weltweit beachtete Marktposition.
Und schließlich der Wunsch nach Freiheit und Mobilität. Man wollte die Einschränkungen hinter sich lassen, die man praktisch Jahrzehnte hinweg erfahren hatte, und hegte gleichzeitig die Erwartung einer neuen gemeinsamen Macht. Diejenigen nämlich, die bis gestern weltpolitische Großmächte waren, waren ja jetzt, nach dem zweiten Weltkrieg, zu weltpolitischen Zwergen geworden und das wollte man eben gemeinsam überwinden.
Europäische Integration – kein „Urknall“, sondern Erfahrung seit der Antike
Aus diesem spezifischen Gefüge, aus Motiven, Interessen und Erfahrungen am Ende des zweiten Weltkrieges ist dann die europäische Integration durchaus nicht wie in einem Urknall entstanden, sondern dahinter steht auch eine lange Erfahrungsgeschichte, vom 6. Jahrhundert vor Christus bis heute. Da hat sich auch so eine Art Schicht von Erfahrung abgesondert, auf der man aufbauen kann.
Ich will dazu ein paar Stichworte nennen: Im 6. Jahrhundert vor Christus wird zum ersten Mal der Begriff Europa überhaupt benutzt. Er kommt aus der Mythologie der alten Griechen. Europa, die Braut des mächtigen Gottes Zeus, und um diese Mythologie herum bildet sich ein Art Wahrnehmungsbild, was Europa eigentlich sei, nämlich die Kultur der alten Griechen. Diese Kultur wird zum Ankerpunkt der Vorstellung von Europa. In der Geburtsstunde ist Europa also nicht nur ein geographischer Begriff, sondern verbindet sich mit einer Kulturform. Die Weisheit der griechischen Philosophen, die Weisheit der griechischen Polis, die die öffentlichen Dinge gemeinsam regelt, das ist der Raum, in dem die Menschen damals dachten, da liegt Europa, umgeben vom Land der Barbaren draußen.
Diese Vorstellung, in der sich ein Raumbild mit einer Kulturform verbindet, kennzeichnet Europa durch die Jahrhunderte bis heute. Dieses Bild wandert zunächst einmal mit den Erkundungen und Eroberungen der Griechen damals. Dieser Raum der Zivilisation, den man Europa nannte, breitete sich also aus. Er stieß irgendwann an natürliche Grenzen. Nach Norden, nach Westen, aber nie im Osten. Das ist das Thema, das uns von damals bis heute in Europa begleitet. Die Frage, wo eigentlich die Grenze Europas liegt, im Blick auf den Osten Europas gestellt. Wenn Sie über die Jahrhunderte in verschiedene Atlanten hineinschauen, werden Sie immer wieder andere Grenzziehungen finden. Es verbindet sich mit einer bestimmten kulturellen Wahrnehmung.
Und zu dieser konstituierenden Form über die griechische Antike kommt dann die römische Erfahrung hinzu. Das römische Reich hat ja eine besondere Art von Rechtsform, rechtlichem Denken, effizienter Administration gebracht und das wird ein zweites konstituierendes Element des Europabildes.
Dann kommen hinzu religiöse Elemente. Im 3. Jahrhundert nach Christus konstituiert sich das Europabild als der Raum, in dem das Lateinische als Liturgiesprache benutzt wird. Sie sehen, welche unterschiedlichen kulturellen Quellen diese Europavorstellung preisen. Damit ist Europa aber auch in alle Religionskonflikte involviert. Wir haben dann die Nationalstaaten, die Kriege gegeneinander führen. Wir haben die Aufklärung, die Europäer wollen, dass man praktisch als Kernelement ihrer Daseinform die Vernunft ansieht. So finden Sie die verschiedensten Varianten. Aber gleichzeitig neben diesen Konflikten, die ja auch praktisch die großen Imperien auf europäischen Boden gegen einander führt – Osmanisches Reich, Zarenreich, Deutsches Reich, das britische Imperium, die Franzosen, die Spanier – also diese Art Konfliktformen sehen wir auf der einen Seite – und die haben ja auch blutige Spuren hinterlassen – aber wir sehen auf der anderen Seite auch die großen Gemeinsamkeiten.
Gleiche, zeitgleiche Stilformen, Formen der Musik, der Malerei, der Architektur. All das kennzeichnet diese Art kulturellen Verständnisses von dem, was wir als Europa sehen wollen. Das Ganze wird auch noch einmal dadurch verdichtet, dass es immer wieder große Pläne gibt, nicht nur eine Art kulturelles Raumbild von Europa zu haben, sondern dieses Europa auch konkret politisch zu organisieren.
Das hat nicht erst nach dem zweiten Weltkrieg angefangen. Einer der ersten großen konkreten Pläne stammt von dem italienischen Dichter Dante, 1306, der große deutsche Philosoph Immanuel Kant, 1799, oder der französische Politiker und Denker Victor Hugo, 1851. Sie alle habe konkrete, handfeste Europapläne vorgelegt. Das zieht sich a...
Inhaltsverzeichnis
- Die vielen Gesichter Europas