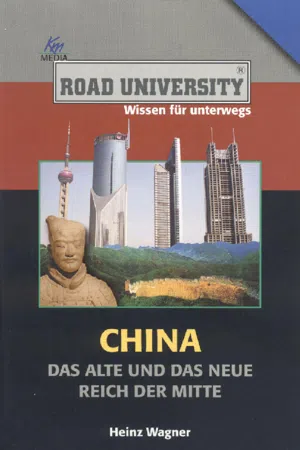
- 144 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Vor 2.200 Jahren vereinigte ein lokaler Fürst alle chinesischen Reiche zum ersten einheitlichen Staat, gründete das Reich der Mitte und ernannte sich selber zum ersten Kaiser.
In einer wechselvollen Geschichte entstand die einzigartige Kultur Chinas, das sich selbst als Vielvölkerstaat versteht. Mit der Erfindung von Papier, Buchdruck, Kompass und Schießpulver war China über viele Jahrhunderte der Entwicklung Europas voraus. Selbst Eroberungen durch die Reiterheere Dschingis Khans, Bürgerkriege, die Kolonialisierung durch Europa, die Besetzung durch Japan und Maos Kommunismus konnten dieses Land nicht zerstören.
Nach der Öffnung durch den Reformer Deng nimmt es nun mit atemberaubender Geschwindigkeit seinen Platz im Kreis der wirtschaftlichen und militärischen Großmächte ein.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu China von Heinz Wagner im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & World History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Am 8. September 1793 bot sich in Jehol, der kaiserlichen Sommerresidenz in der Nähe von Peking, ein prächtiges Schauspiel. Der Sonder-Botschafter seiner Majestät des Königs Georg III. von Großbritannien, Lord George Macartney, kam mit einem Gefolge von 100 Gesandtschaftsmitgliedern und 600 großen Kisten voller Geschenke. Er sollte dem Kaiser des großen chinesischen Reiches der Mitte die Glückwünsche seines Königs zum 80. Geburtstag überbringen. Kaiser Qianlong fühlte sich geschmeichelt. In bester konfuzianischer Tradition verstand er die britische Gesandtschaft als Tributmission. Warum sonst sollten Barbaren aus dem fernen Westen an seinen Hof kommen?
Doch Macartney hatte einen ganz anderen Auftrag. Er sollte – neben den Glückwünschen – einen Handelsvertrag abschließen und die gegenseitige Errichtung von Gesandtschaften in Peking und London vereinbaren. England war zu der Zeit der weitaus wichtigste europäische Handelspartner Chinas. Es nahm ein Siebtel des Tees ab, der in China auf den Markt kam und importierte Seide, Porzellan, Lackwaren und anderes mehr. Die Chinesen zeigten umgekehrt allerdings nur wenig Interesse an dem, was England anzubieten hatte. So musste Großbritannien Jahr für Jahr ein großes Handelsdefizit mit Silber begleichen.
Die Geschenke der englischen Gesandtschaft waren auch gar nicht nach dem Geschmack der Chinesen. Es waren moderne Produkte, die die englische Kompetenz in Wissenschaft und Technologie zeigen sollten. Dazu gehörten ein Planetarium, das die Bewegungen des Sonnensystems nachbildete, ein Fernrohr, eine Luftpumpe und andere britische Manufakturprodukte. Die Chinesen wiederum schenkten Jadeskulpturen, perlenbestickte Seidenbörsen und andere Luxusgüter. Was die diplomatischenAnliegen der Briten betraf, waren die Chinesen nicht einmal dazu bereit, in Gespräche darüber einzutreten.
Am 3. Oktober wurde Macartney zu einem Treffen mit dem Chefminister gerufen. Nachdem er die üblichen drei Stunden gewartet hatte, spielte sich eine erstaunliche Zeremonie ab. In der Mitte der Halle war einArmstuhl aufgestellt. Er diente als Thron für den Brief des Kaisers. Die Chinesen vollführten den Kotau, die vorgeschriebene Niederwerfung, vor der kaiserlichen Papierrolle. Macartney und die Seinen beugten nur das Knie, was bei den Gastgebern stillschweigende Missbilligung hervorrief. Am Nachmittag wurde der Brief in einer weiteren Zeremonie übergeben.
Das Schriftstück stellte sich als kaiserliches Edikt an die britische Krone heraus, mit dem Qianlong huldvoll dem englischen König anbot, in ein Vasallenverhältnis einzutreten und somit an der chinesischen Zivilisation teilnehmen zu dürfen. „Wir, Kaiser durch die Gnade des Himmels, instruieren den König von England, unsere Anweisung zur Kenntnis zu nehmen“. Weiter hieß es, der Gesandtenaustausch sei unnötig. Kein Interesse habe man auch an der Einfuhr an britischen Waren. „Wir haben niemals technische Spielereien geschätzt und haben nicht den geringsten Bedarf an den Manufakturwaren Deines Landes. (…) Du, König, solltest einfach in Übereinstimmung mit unseren Wünschen handeln, Deine Loyalität stärken und ewigen Gehorsam schwören, um so sicher zu stellen, dass Dein Land an den Segnungen des Friedens teilhat. “
König Georg III. und selbst Macartney bekamen den Inhalt des Briefes in dieser brüsken Form nie zu Gesicht. Schon der Gesandtschaftsübersetzer, der den Brief ins Lateinische übersetzte und auch Macartney selbst, entfernten oder milderten, was den britischen Stolz verletzen konnte. Für die Briten endete die aufwändige und teure Gesandtschaft so mit einem Fehlschlag. Die Berichte, die die Reiseteilnehmer zu Hause veröffentlichten, fanden in Europa weite Verbreitung und trugen wesentlich dazu bei, dass die bis dahin vorherrschende Bewunderung für China in kopfschüttelndes Unverständnis, ja gar in Verachtung umschlug.
Auf dem Höhepunkt der Macht
Zu diesem Zeitpunkt stand China in Asien auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Weiten der Mongolei, Ostturkestans und Tibets waren dem Reich als Militärprotektorate eingegliedert, und wurden von einheimischen Herrschern nur verwaltet. China war mit 12,5 Millionen Quadratkilometern größer als jedes chinesische Reich zuvor, doppelt so groß wie das Ming-Reich und weit größer als das Territorium der heutigen Volksrepublik.
2.000 Jahre lang hatten Reiterhorden aus dem Norden das riesige Agrarland bedroht. Immer wieder hatten Nomadenstämme Teile des Reichs oder sogar China komplett unterworfen. Nun war die Gefahr aus dem Norden endgültig gebannt: Das Ziel und die Bestimmung des Universal-Kaisertums, China und Innerasien zu einem Großreich zu vereinen, waren erfüllt. Von tiefer Symbolik für die jetzt gefestigte Zusammengehörigkeit Innerasiens und Chinas war, dass das neue Großreich vom Nomadenstamm der Mandschus geschaffen worden war. Dieser hatte die chinesische Kultur übernommen und stellte drei der konfuzianischen Modellkaiser.
Die Macht des neuen Großreichs strahlte auf die umliegenden asiatischen Länder aus: auf Korea, ganz Indochina, Bhutan, Nepal, Afghanistan, die zentralasiatischen Khanate Kokand und Buchara oder die Kasachen. Sie alle schickten Tributgesandtschaften nach Peking. Das Reich und seine Einflussgebiete erstreckten sich von der äußeren Mongolei im Norden bis zur malaiischen Halbinsel im Süden, von Korea im Osten bis weit nach Zentralasien im Westen. China zählte damals schon 330 Millionen Einwohner. Eine Bevölkerung, zweieinhalb Mal so zahlreich wie in allen europäischen Staaten der damaligen Zeit zusammen genommen.
Doch China damals ahnte nichts von der wissenschaftlichen Revolution, die in Europa im 17. Jahrhundert begann und auch nichts von dem heraufdämmernden industriellen Zeitalter des 18. und 19. Jahrhunderts. China war völlig mit sich selbst beschäftigt – und selbstzufrieden…
Kaiser Qianlong errang zwar die Kontrolle über die Seidenstraße. Die aber war für den Handel nunmehr kaum noch von Bedeutung. Großbritannien eroberte die Weltmeere. Offenkundig wurde die Machtverschiebung nur 57 Jahre später im ersten Waffengang zwischen dem englischen Empire und China, dem Opiumkrieg. Der Niedergang der letzten chinesischen Dynastie war unaufhaltsam. Es wurde ein Absturz, der das einst größte und fortgeschrittenste Reich der Erde innerhalb eines einzigen Jahrhunderts in ein armes Land verwandelte. Heute zählt es wieder zu den Weltmächten. Chinas langer Weg durch zweieinhalb Jahrtausende ist ein faszinierendes Kapitel der Menschheitsgeschichte.
Das große Überlegenheitsgefühl
Betrachtet man heute den geografischen Raum Chinas mit all seinen Völkerschaften, dann bilden die Han die bedeutendste Gruppe. Dabei wohnen diese chinesisch sprechenden Volksgruppen nicht nur im Staatsgebiet der Volksrepublik. Es existiert auch ein so genanntes „äußeres China“, das von chinesischen Bevölkerungsgruppen gebildet wird, die sich in den meisten südostasiatischen Ländern, etwa in Indonesien, auf den Philippinen, in Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Taiwan und Laos, angesiedelt haben.
Über 1.500 Jahre vor Christus, von der Shang-Dynastie bis zum ersten Kaiser, bildete sich die chinesische Kultur im Kerngebiet des Mittel- und Unterlaufs des Gelben Flusses und weitete sich stetig aus. Die Chinesen prägte die Erfahrung, von Völkern niederer Kulturstufen umgeben zu sein. Von Nichtsesshaften, von Jägern und Sammlern in den Wäldern des Nordostens, den Steppennomaden des Nordens und Nordwestens und den Ureinwohnern des Südens. Die Erdwälle, die der erste Kaiser Qin Shihuangdi zum Bau der Großen Mauer zusammenfügen ließ, bildeten die Grenze zwischen bebautem Ackerland und den Steppen und Wüsten des Nordens. Über diese Grenze hinaus ließen sich damals Ackerbau und Zivilisation nicht ausweiten.
Diese Erfahrung vermittelte den Chinesen ein Bewusstsein der Überlegenheit über alle anderen Völker. Sie begriffen ihre Kultur als die Zivilisation schlechthin. Außerhalb ihres Reiches gab es nur den unbedeutenden Rest der Welt, dem alle anderen angehörten.
Es gibt auch keinen Landesnamen für China. Der Begriff wurde erst spät von den Europäern geprägt. Er leitet sich vom Qin-Reich des ersten Kaisers ab. Die Chinesen selbst sprechen von Zhongguo, dem „Reich der Mitte“ und nennen sich selbst, „wir Leute vom Reich der Mitte“. In dieser Vorstellung nimmt China die Mitte der Erdfläche ein, die im Osten an den Ozean stößt und an den anderen Seiten von den Gebieten der Barbaren umgeben ist. Die Zivilisation blüht in der Mitte, daher das Reich der Mitte. Ein chinesischer Name für das eigene Land lautete: „Kulturblüte der Mitte“.
Der Kaiser war nicht nur der Herrscher Chinas, sondern er herrschte über „Alles unter dem Himmel“. Seine Herrschaft war nicht als direkte politische Herrschaft gedacht, sondern als moralische Oberhoheit, als Ausstrahlung der überlegenen, chinesischen Zivilisation. Es war die Tugendkraft des Kaisers, die nach der konfuzianischen Lehre die Barbaren unwiderstehlich in die Knie zwang.
Während der Regierungszeit des großen Kaisers Wudi (141 – 87 v. Ch.) brachten Erkundungsexpeditionen in den fernen Westen die Nachricht, dass jenseits der Wüsten noch andere Hochkulturen wie Indien und das Reich der Parther existierten. Dies hätte für die Chinesen eigentlich ein Schock sein müssen, ebenso wie das Vordringen des Buddhismus als Erlösungsreligion. Doch das chinesische Überlegenheitsdenken war schon zu lange zu tief verwurzelt. Konsequenzen wurden deshalb aus diesen Erfahrungen nur von wenigen Außenseitern gezogen.
Als China dann unter den Tang-Herrschern im 7. bis 9. Jahrhundert nach Christus zur alles überragenden Zivilisation der Welt aufstieg und Korea, Vietnam und selbst Japan zu chinesischen Tochterkulturen wurden, die die chinesische Schrift und die konfuzianische, klassische Literatur übernahmen, sah sich die chinesische Herrschaftsschicht mehr als bestätigt.
Die verschiedenen Völker chinesischer Sprache und Kultur bilden dabei auch heute keineswegs ein einheitliches Ganzes. Sie unterscheiden sich durch ihre Traditionen, ihr Brauchtum, die ethnische Zusammensetzung und ihre Dialekte. Das Fehlen einer nationalen Klammer, mit deren Hilfe man in Europa so klar zwischen Franzosen, Spaniern, Italienern und Portugiesen unterscheiden kann, verschleiert in der chinesischen Welt eine Vielfalt, die sich in der Geschichte des Landes begründet. Der zentral gelenkte Schulunterricht und das landesweit einheitliche Fernsehen verwischen die sprachlichen Eigenheiten der einzelnen Regionen weiter.
Der Begriff Dialekt für diese sprachlichen Eigenheiten führt ein wenig in die Irre. Denn diese Dialekte werden in China jeweils von Millionen von Menschen gesprochen. Die nordchinesischen Dialekte bilden dabei eine ziemlich homogene Sprachfamilie, zu der mehrere Hundert Millionen Menschen gehören. Die relative Einheitlichkeit erklärt sich durch die stetige Vermischung der Völker, die sich im Lauf der Jahrhunderte in den Gebieten zwischen der Mongolei und dem Jangtse-Becken angesiedelt haben. Dagegen zeugt die sprachliche Verschiedenartigkeit der Dialekte im Süden und Südosten von der Stabilität der Bevölkerungsgruppen dieser Gebiete. Eine neuere Statistik weist eine Gesamtzahl von 528 Dialekten in China aus.
Die europäische Bezeichnung „Mandarin“ für die früheren chinesischen Staatsbeamten, eine Art politische und soziale Führungsschicht des traditionellen Chinas, steht heute nur noch für die weit verbreitete, standardisierte chinesische Verkehrssprache.
Schrift und Sprache
Die Einsilbigkeit der Grundwörter ist für das Chinesische charakteristisch. Es ist eine herbe und gleichzeitig sensible Sprache, deren Stärke im konkreten Ausdruck liegt. Es kommt dabei weniger auf die klare Formulierung von Gedanken an, sondern vor allem darauf, sein Begehren mitzuteilen.
Zwischen Schrift und Kultur bestehen enge Beziehungen. Ohne dieses Instrument der Aufzeichnung und Weitergabe hätten große Zivilisationen nicht entstehen können. Die chinesische Schriftart hat tief greifende Wirkungen. Sie ist das einzige Beispiel einer originellen, komplexen Schrift, die einem so bedeutenden Teil der Menschheit als Ausdrucksmittel gedient hat. Ihre Schwierigkeit brachte vor allem den höheren sozialen Klassen Vorteile, die sie perfekt beherrschten. Schrift und Bücherwissen hatten in China immer einen hohen Stellenwert. Obwohl das Erlernen des lateinischen Alphabets viel weniger Zeit beansprucht, scheint der Anteil der Gebildeten in der chinesischen Welt höher gewesen zu sein als im Westen.
Im Zentrum der chinesischen Kultur steht eindeutig die Schrift. Sie bildet das Rückgrat aller Verständigung – auch jenseits aller Dialekte. Sie lässt alle phonetische Veränderungen, die im Lauf der Zeit eingetreten sind, alle Varianten der Dialekte oder sogar den Wandel in der Struktur der Sprache selbst unberücksichtigt. Seit der Vereinheitlichung durch den Staat „Qin“, Ende des dritten Jahrhunderts vor Christus, ist die chinesische Schrift eines der wirksamsten Instrumente der politischen Einigung gewesen. Neben der sprachlichen Mannigfaltigkeit der Dialekte hat sich aus politischen und administrativen Gründen eine Schrift durchgesetzt, die der gesamten chinesischen Welt zugänglich ist.
Bis heute gibt es in China im Prinzip keine allgemein gültige Ausspracheregel. Ein und derselbe Text kann in den verschiedenen Dialekten verschieden ausgesprochen werden. Kann man sich mündlich nicht verständigen, nimmt man die Schrift zu Hilfe, die jederzeit eine Verständigung ermöglicht. Die Tatsache, dass phonetische Veränderungen in der Schrift nicht ausgedrückt werden, hat eine Kontinuität der Schrifttradition ermöglicht, wie sie in keiner anderen Kultur möglich war.
Dank ihrer Eindeutigkeit ist die Schrift in allen Regionen Asiens zu einem universalen Ausdrucksmittel geworden. Sie ist dabei keineswegs eineAusnahmeerscheinung. Nach ihrem Modell entstanden in Ostasien ähnliche Schriftarten. Die Schrift der Kitan, die tangutische Xixia-Schrift, die Schrift der Dschurdschen oder die vietnamesische Chunom-Schrift funktionieren alle nach demselben Prinzip. Außerdem wurden die Kursivformen der chinesischen Schrift die Grundlage der japanischen Silbenschrift und des koreanischenAlphabets.
Selbst Völker, deren Sprache sich vom Chinesischen stark unterscheidet, haben die chinesische Schrift übernommen. Sie lesen sie zum Teil heute noch auf ihre Weise und nach ihren Sprachgewohnheiten. Das schriftliche Chinesisch war so zum Beispiel die Kultur- und Verwaltungssprache Vietnams bis zu seiner Eroberung durch Frankreich. Das galt auch für Korea bis zu dessen Annexion durch Japan. So gibt es auch eine bedeutende, chinesisch geschriebene Literatur, deren Autoren – Dichter, Historiker, Romanschriftsteller, Philologen oder Philosophen – keine Chinesen, sondern Koreaner, Japaner und Vietnamesen waren. Man kann sagen, dass in Ostasien so eine grenzüberschreitende Kulturgemeinschaft entstanden ist, die sich durch die Verwendung der chinesischen Schrift auszeichnete.
Auch wenn der Stil nach Epoche und Art des Schriftstücks variiert, hat man dennoch als Chinese heute kaum Schwierigkeiten, einen Text aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert zu lesen. Das geht ebenso gut wie ein im klassischen Chinesisch abgefasstes Werk der neuesten Zeit. Aus dieser Tatsache erklären sich auch der traditionelle Charakter des chinesischen Wissens und dessen erstaunliche Ansammlung im Lauf der Jahrhunderte. In der Schriftsprache existiert ein riesiger Vorrat an Formeln, die von Generationen von Dichtern, politischen Schriftstellern, Historikern, Moralisten und Gelehrten in unaufhörlicher Arbeit angehäuft wurden.
Diese außergewöhnliche Kontinuität der Schrifttradition erfordert vom Leser eine sehr breite Bildung, deren Aneignung viel mehr Zeit erfordert, als das Erlernen der Schrift selbst. So erklärt sich die Rolle der Schrift als Regierungs- und Verwaltungsinstrument sowie das Ansehen der Gebildeten, die fähig waren, politische Funktionen auszuüben. Die Rhetorik, in der griechischrömischen Welt hoch geschätzt, spielt in Ländern chinesischer Kultur nur eine untergeordnete Rolle.
Nach der Überlieferung ist die Schrift von einem Minister des ersten Kaisers, also im dritten Jahrhundert vor Christus, erfunden worden. Zunächst wurde mit dem Ziel, eine im ganzen Staat gebräuchliche Kanzleischrift einzuführen, ein Verzeichnis von 3.000 Zeichen veröffentlicht. Diese waren für alle Schreiber verbindlich. Dieser erste Herrscher hat in der chinesischen Kultur den Ruhm eines Gründer-Heroen. Er gilt als Stammvater der chinesischen Gesellschaftsordnung.
Im weiteren Verlauf wuchs die Zahl der Schriftzeichen auf etwa 10.000 an. Im Jahre 485 nach Christus wurden die Wörterlisten mit kaiserlichem Erlass um 1.000 weitereAusdrücke erweitert. Die Kunst der Schriftsteller und Dichter misst sich in China auch an der Vielzahl der in ihren Manuskripten verwendeten Schriftzeichen. Das betont den Einfluss, den das Schriftsystem bei der Entwicklung der Sprache in China hatte.
Das vorkaiserliche Reich
Die Chinesen verstehen sich als ein Volk mit einer sehr langen Geschichte. Mythen und archäologische Funde geben ein genaueres Bild etwa ab dem zweiten Jahrtausend vor Christus, mit dem Übergang zur Bronzezeit. Damit beginnt die eigentliche Geschichtsschreibung in China. Die geografische Ausdehnung umfasste damals nur einen Teil des heutigen Reiches und wuchs erst allmählich mit der Integration und Assimilierung weiterer Völker und Kulturen.
Das archaische Königtum der Shang-Zeit hatte bereits eine politische Organisation, kannte die Schrift, das Rad, architektonische Techniken, Bronzekunst, hatte Opfergefäße, Dekorationsmotive und vieles mehr. Insgesamt soll die Shang-Dynastie etwa 30 Könige umfasst haben. BeiAusgrabungen fanden sich unter anderem Knochen und Schildkrötenpanzer, die Inschriften trugen. In zahlreichen Fundstätten deuten menschliche Skelette darauf hin, dass die Opferung von Kriegsgefangenen üblich war.
Der archäologische Nachweis von Städten mit Schutzwall, Wagen, Waffen und Bronzegefäßen deutet darauf hin, dass es schon damals eine Adelsklasse gab, die mit Kriegsführung und Opferhandlungen beschäftigt war. An ihrer Spitze stand das Königsgeschlecht. Der Herrschaftsbereich erstreckte sich schon damals über die gesamte nordchinesische Tiefebene. Auf demselben Gebiet lebten aber auch Fremdvölker, die von den Shang als Barbaren angesehen wurden.
Die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckten, großen Königsgräber liefern ein gutes Bild Chinas zur Shang-Zeit. Die Gräber haben einen kreuzförmigen Grundriss in Nord-Süd-Ausrichtung und eine rechteckige Gruft. Der hölzerne Sarg des Königs ruht über dem zentralen Raum, in dem ein Hund geopfert wurde. Rings um das Grab wurden Skelette von bewaffneten Männern gefunden, wohl Gefolgsleute und Diener des Königs. Auch der Wagen des Königs mit Pferden und Wagenlenkern sowie Bronzegefäße und andere Wertgegenstände wurde dem Toten ins Grab mitgegeben. Die Sitte, beim Begräbnis eines Königs seine nächsten Diener zu opfern und mit ihm zu begraben, findet sich auch in zahlreichen anderen Kulturen der Bronzezeit wieder.
Auf Grund ständiger Kriege während des ersten Jahrtausends vor Christus nannte man diese Ära die „Zeit der kämpfenden Reiche“. Das vierte und dritte Jahrhundert vor Christus waren zugleich eine Zeit raschen wirtschaftlichenAufschwungs und technischer Neuerungen. Es gab bereits großflächige Landbewirtschaftung mit Trockenlegung von Sumpfgebieten und Bewässerungssystemen. Gleichzeitig kam es zu einer rapiden Bevölkerungszunahme, die sich in der frühen Han-Zeit fortsetzte. So erklärt sich auch die große Bevölkerungszahl der ersten bekannten Volkszählung im Jahre 2 n. Chr. mit 57 Millionen Einwohnern, also mehr Menschen als für das gesamte Römische Reich damals geschätzt wurden, das sich um das Mittelmeer im fernen Westen erstreckte.
Die Erschließung von Neuland hat wesentlich zur Stärkung der Zentralmacht beigetragen. Dazu kam die Verbreitung von Eisenwerkzeugen, die eine tiefere Bodenbearbeitung und größere Bauwerke ermöglichten. Bereits um 400 vor Chr. war das Eisengießen weit verbreitet und hoch entwickelt. Die frühe Entstehung des Eisen- und Stahlhandwerks in China erklärt sich aus den Erfahrungen auf dem Gebiet des Bronzegießens und der Verwendung eines Kolbengebläses. Es ist bemerkenswert, dass sowohl das Eisengießen als auch bessere Methoden des Geschirrs für die Zugtiere in Europa erst gegen Ende des Mittelalters auftauchten.
Die wirtschaftliche Entwicklung vor der Gründung des ersten Kaiserreiches intensivierte auch die Handelsbeziehungen zu den Nachbarvölkern, zu mandschurischen und koreanischen Stämmen und zu den Steppennomaden. Es scheint, dass schon im 4. und 3. Jahrhundert vor Chr. Seide aus dem Staat Qin nach Nordindien gelangte. Daher der indische Name „Cina“ für das Seidenland.
Die Zeit vor der Vereinigung der Reiche war eine Epoche sozialer Umwälzungen. Die alten Adelsgesellschaften verloren ihre Macht und ihre Kulte. Die wirtschaftliche Blüte, die zum Entstehen einer kleinen Schicht von reichen Händlern und Großgrundbesitzern führte, verstärkte die Ungleichheiten. Die Zahl der Pächter, Landarbeiter und Schuld-Sklaven – neben der Sklaverei als Strafe die einzige Form von Sklaverei, die China je gekannt hat – stieg rasant an. Landlose Bauern fanden in den wachsenden Zentren Beschäftigung oder wurden auf Neuland angesiedelt, das die Herrscher erschließen ließen.
Solche Veränderungen führten zum Zerfall der alten Dorfgemeinschaft. Das Land musste neu organisiert werden. Das geschah durch grundlegende Reformen, die die Grundlage für den zentralisierten Staat in China legten. Die Reformer, später als „Legalisten“ bezeichnet, schufen die grundlegenden Institutionen des neuen Staates und auch das Kaiserreich selbst.
Das Kaiserreich
Dieses Reich entstand durch die Unterwerfung von sechs weiteren chinesischen Reichen durch den tyrannischen Fürsten Zheng, den Herrscher von Qin in der Zeit von 247 bis 210 v. Chr. Er gründete, nach der militärischen Einigung, das erste chinesische Kaiserreich der Geschichte und nahm den Ehrentitel „erhabener Herrscher, Kaiser der Qin“, Qin Shihuangdi an. Der Titel wurde künftig die offizielle Bezeichnung aller Kaiser.
Qin Shihuangdi ließ sich als Gottkaiser verehren. Mit Hilfe seines Beraters, des Legalisten Li Si, wurde das im neuen Qin-Reich herrschende Verwaltungssystem auf die gesamte damalige chinesische Welt ausgedehnt. Im neuen Staat Qin wurde die Standardisierung von Gewichten, Münzen, Hohlund Längenmaßen sowie des Achsstandes durchgeführt und die erste Schriftnorm eingeführt, die die verschiedenen, damals in den chinesischen Ländern üblichen Schriftarten ersetzen sollte.
Das Reichsgebiet teilte der Kaiser in Verwaltungseinheiten, Präfekturen, Kommandanturen und Kreise ein. An der Spitze jeder Einh...
Inhaltsverzeichnis
- Geschichts-Daten
- Inhaltsverzeichnis
- Auf dem Höhepunkt der Macht
- Das große Überlegenheitsgefühl