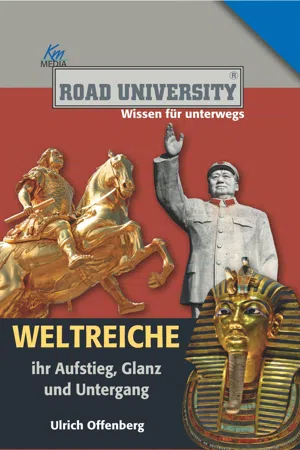
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Sie kamen über das Meer, durch Wüsten und Grassteppen. Unter den Hufen ihrer Pferde wurden Reiche zerstört und neue - größere - gegründet. Mächtige Stadtstaaten eroberten benachbarte Siedlungsgebiete, Eroberer bestiegen den Thron neuer Dynastien.
Von den Sumerern, Pharaonen, dem Imperium Romanum, den Osmanen bis zu Mongolen und den Herrschern des "Reiches der Mitte", China, spannt sich der Themenbogen der frühen Geschichte. Europäische Seefahrer entdeckten und eroberten neue Kontinente für ihre Könige: Portugiesen, Spanier und Engländer, in derem Empire die Sonne nie unterging.
Die Neuzeit dominieren die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland - und wieder China, der von neuem erwachende Drache. Weltreiche "eroberte" aber auch der Glaube an einen jenseitigen Herrscher. Christentum und der Islam überspannen den ganzen Erdball.
Der Glanz großer Weltreiche währte manchmal 1.000 Jahre, oft nur ein Menschenleben. Sie markieren den Pulsschlag einer langen Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Weltreiche von Ulrich Offenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Christentum – Jesus und die Folgen
Als in Rom „Kaiser Augustus“ über ein Weltreich herrschte, wurde vermutlich im Jahre 7. oder 6. vor der abendländischen, christlichen Zeitrechnung in Bethlehem, in der jüdischen Provinz Judäa, dem Zimmermann Joseph aus Nazareth und seiner Verlobten Maria ein Sohn geboren. Der Kaiser hatte eine Volkszählung im ganzen „Imperium Romanum“, zu der auch Palästina gehörte, angeordnet und es war die Pflicht des Joseph, sich in seiner Geburtsstadt, in Bethlehem, registrieren zu lassen. Da die Gasthöfe im Ort überfüllt waren, hatten er und seine hochschwangere Verlobte notdürftig Unterkunft in einem Stall gefunden. Dort brachte Maria ihren Sohn Jesus zur Welt. So weit, so gut, oder besser: Legenden bildend. Kurz nach der Geburt des Knaben soll sich dann noch eine seltsame Erscheinung zugetragen haben: Ein Komet mit einem langen, deutlich sichtbaren Schweif schwebte am Himmel und schien über dem Stall inne zu halten.
Die Leute in der Umgebung und die Hirten, die in der Nähe ihre Schafe weideten, waren zunächst entsetzt. Galten doch Kometen sowie Sonnenfinsternisse seit alters her als Unglücksboten. Doch bald kam der Gedanke auf, diesmal könne das Zeichen Glück verheißen.
Die Juden erwarteten seit langem sehnsüchtig den Messias, den Erlöser, der das Volk Israel von fremder Herrschaft befreien sollte. Die Hirten glaubten, in dieser Nacht sei der lang Erwartete tatsächlich gekommen und machten sich auf den Weg zum Stall, um das neugeborene Kind anzubeten und ihm Geschenke zu bringen. Kurze Zeit später trafen auch noch drei fremde Magier ein, denen der Stern die Geburt eines großen Königs verheißen hatte.
Die hatten in Bethlehem den Gesuchten nicht gleich gefunden. Weil sie nach einem König forschten, fragten sie – das lag nahe – im Palast von König „Herodes I.“ nach. Dort aber wusste niemand von einem neu geborenen König. Der listige Herrscher bat die drei Magier weiter zu suchen und ihn sofort zu benachrichtigen, sollten sie das Kind gefunden haben. Die Hirten geleiteten die drei Männer in den Stall, dort breiteten sie ihre Geschenke aus: Gold, Myrrhe und kostbares Weihrauch aus dem Oman. Inzwischen aber hatte der König eine grausame Vernichtungsaktion in Gang gesetzt: Er ließ in Angst um seine Herrschaft alle Jungen töten, die im letzten Jahr geboren worden waren.
Die Nachricht von den Kindermorden verbreitete sich schnell. Da jedoch der Stall, in dem Maria ihren Sohn geboren hatte, weit außerhalb der Stadt lag, konnten Joseph und Maria rechtzeitig entkommen. Angeblich führte sie ihre Flucht Ägypten. Noch eine Legende, obwohl es in der Geschichtsforschung Hinweise gibt, dass es tatsächlich zu den von Herodes befohlenen Kindsmorden gekommen ist.
Der Sohn des Zimmermanns Joseph und seiner Verlobten Maria wurde von seinen Eltern „Jesus“ genannt.
Er schien so ganz aus der Art geschlagen, erwies sich schon in früher Jugend als religiöser Schwärmer und fühlte in sich die Berufung, Menschen zu Gott zu führen. Erst recht, als er im Alter von 27 Jahren am Fluss Jordan einen Mann traf, der ihn wie kein zweiter inspirierte: Einen frommen Einzelgänger, den alle „Johannes den Täufer“ nannten. Johannes rief die Menschen, die zu ihm pilgerten, zur Buße auf, zur Erneuerung ihrer Gesinnung und ihres Tuns. Denn das Ende, so predigte Johannes, stünde unmittelbar bevor und Gott werde schon bald als Richter auf Erden wandeln. Schon damals waren Welt-Untergangstheorien populär. Und so ließ sich auch dieser Jesus von Nazareth mit dem Wasser des Jordans von Johannes taufen. Die charismatische Persönlichkeit dieses Mannes beeindruckte ihn stark. Fortan zog der Sohn des Zimmermanns aus Nazareth selbst als Prediger durch Judäa. Einer von Hunderten, angewiesen auf Almosen, die ihm die Mitbürger zusteckten. Das Grundmotiv seines Vorbildes, die Verkündigung des bevorstehenden Endes, behielt er in seinen Predigten bei. Allerdings mit einer kleinen, aber wichtigen Variante: Der Zeitaspekt war ein anderer. Die Herrschaft Gottes stand, der Predigt Jesus zufolge, nicht nur nahe bevor, sondern sei bereits da, beziehungsweise im Anbrechen. Eine Herrschaft, geprägt von uneingeschränkter Liebe. So spitzte Jesus die uralte jüdische Gewissheit von der Nähe Gottes, von seiner Führung des Volkes und der Welt, aufs äußerste zu. Er predigte, dass ohne irgendwelche Zwischeninstanzen Gott den Menschen unmittelbar gegenüber stünde.
Sache der Menschen wäre einzig und allein der Gehorsam diesem Gott gegenüber.
Neu und zündend war das Gebot der doppelten Liebe: zu Gott und zum Nächsten – also der vollen, vertrauenden Hingabe des ganzen Menschen an Gott und der Aufopferung für den Mitmenschen. Bis zum Verzicht auf die Vergeltung von Unrecht, ja bis zur Feindesliebe wurde dieses Gebot durch Jesus zugespitzt.
So war der nahe Gott, von dem Jesus predigte, nicht in erster Linie der strenge Weltenrichter, sondern der liebende und vergebende Vater. Ganz anders als „Johannes der Täufer“ rief Jesus die Heilsuchenden nicht zu sich an den Jordan, sondern kam ihnen entgegen und suchte sie auf. Jesus stellte sich – auch das war neu – selbst in seine Verkündigung hinein.
Die Souveränität seines Auftretens hatte in der Geschichte Israels kein Beispiel. Er beanspruchte – alle Regeln des religiösen Lebens missachtend – Funktionen, die allein Gott vorbehalten sein sollten, für sich: Die Sündenvergebung, die Erneuerung des Gesetzes, die angeblichen Wunder. Der Schleier des Geheimnisses, der diesen Mann umgab, irritierte seine Zeitgenossen. An ihm und an seiner Verkündigung schieden sich die Geister.
Es gab die unmittelbaren Anhänger, die „Jünger“ im engeren und weiteren Sinn, die sich seinem Anspruch beugten und ihre bisherige Lebensordnung aufgaben. Vermutlich auch ein innerster Kreis von zwölf Getreuen, dazu eine größere Gruppe anderer, die sich die Botschaft von der nahen Gottesherrschaft zu Eigen machten und sie ihrerseits weiter trugen.
Es gab die Enttäuschten, die gehofft hatten, in ihm den lang erwarteten politischen Befreier Israels zu finden, der die römischen Fesseln beseitigen würde. Schließlich gab es die erbitterten Gegner, den Hass der strengen Juden und der Priesterkaste gegen diesen Mann, der das auserwählte Volk Israels und die Heiligkeit des Gesetzes zwar nicht bestritt, diese aber radikal aktualisierte und so die alte Ordnung zerstören wollte.
So kam es unausweichlich zur Katastrophe. Sie wurde ausgelöst durch den Einzug Jesus in Jerusalem. Sicher hat er hier nicht den Tod gesucht, ganz sicher aber die Konfrontation mit den Herrschenden. Sein Auftreten erschien ihnen als ein Angriff auf die religiösen und politischen Werte des Volkes und eine Gefahr für ihre Interessen. Es fiel der Beschluss, diesen Mann unschädlich zu machen.
In der Nacht vor dem Passah-Fest erfolgte die Verhaftung und Verurteilung dieses eigensinnigen Propheten, der nichts von dem, was er verkündet hatte, zurück nehmen wollte. Der römischen Besatzung gegenüber wurde Jesus als politischer Unruhestifter denunziert. Der durch Herodes Verurteilte endete nach römischer Sitte am Kreuz.
Dieser Tod des Jesus von Nazareth und die ratlose Hoffnungslosigkeit seiner verunsicherten Anhängerschaft blieben aber nicht das letzte Wort. Es folgte ein Neuanfang, der den Lauf der Weltgeschichte veränderte und viele Jahrhunderte, bis zum heutigen Tag, überdauern sollte. Die Person Jesus wurde so berühmt wie keine andere Menschengestalt. Auch wenn er gesagt haben soll, sein Reich sei nicht von dieser Welt, so wurde er doch der Gründer einer Religion, wie sie die Erde noch nie gesehen hatte.
Seine Anhänger, durch die Kreuzigung ihres Führers beraubt, behaupteten nun, dass Gott Jesus auferweckt und zu sich geholt habe. Der Widerspruch zwischen dem unbedingten Machtanspruch dieses Mannes und seinem schmachvollen Tod am Kreuz sei so durch den Gott, dessen Ankunft Jesus ja immer verkündet habe, gelöst. Der vollkommen Gehorsame sei in die vollkommene Gemeinschaft mit Gott, die ihm verheißen war, aufgenommen worden.
Die Botschaft selbst habe sich bestätigt, und die Rätsel um seine Person seien geklärt, denn Gott selbst habe ihn als seinen Sohn legitimiert. So erzählt, wurde es eine runde Geschichte – und volkstümlich ausgedrückt ein Schuh daraus.
Von Anfang an zeichneten sich die ersten christlichen Gemeinden durch großes Engagement aus. Sie drängten auf die Straßen und Plätze und berichteten von der Liebe Gottes und von dem Opfer, das dieser Jesus von Nazareth für alle Menschen gebracht hatte. Die Predigten orientierten sich an den Erzählungen über den Gekreuzigten.
Die Jerusalemer Tempel-Aristokratie versuchte, diese Strömungen unter Kontrolle zu bringen und schickte Emissäre in jüdische Gemeinden, um den Einfluss dieser Gruppen einzudämmen. Einer dieser Männer war ein griechisch gebildeter, aus Tarsus am Schwarzen Meer stammender jüdischer Student, Saulus. Auf lateinisch Paulus. Auf dem Weg nach Damaskus hatte er ein Erweckungserlebnis und wurde fortan bis zu seinem Tode der wichtigste Propagandist dieser neuen Lehre.
Doch noch fehlte der jungen christlichen Glaubensgemeinschaft ein gemeinsames, theologisches Fundament. Dies begründeten die Erinnerungen der Augenzeugenberichte des Lebens, der Passion und der Auferstehung Jesu, die Evangelien. Schriften, in den unter Verarbeitung älterer Vorlagen ein zusammenhängendes Gesamtbild der Lehre und des Lebens Jesu gezeichnet wurden. Die drei ersten, die so genannten „synoptischen“ Evangelien, umfassen den weitaus größten Teil.
Matthäus gilt als Verfasser des ersten Evangeliums. In ihm wird berichtet, wie Jesus ihn von seinem Dienst am Zolltisch weg rief und zum gemeinsamen Mahl bat. Der Überlieferung nach zog er im Jahr 42 nach Parthien, um dort das Evangelium zu verkünden. In seinem Evangelium wollte Matthäus ganz besonders nachweisen, dass Jesus der im Alten Testament verheißene, aber von seinem Volk abgelehnte Messias sei.
Das Doppelwerk des Lukas, dem Verfasser des „Lukas-Evangeliums“ und der Apostelgeschichte, ist die erste christliche Schrift, die dazu dienen sollte, die frühchristlichen Überlieferungen festzuhalten und weiter zu geben. Zuvor bestand das verbreitete christliche Schrifttum lediglich aus Fragmenten und Gelegenheitsaufzeichnungen. Die Schriften des Lukas – er wirkte als Arzt – entstanden im Jahr 80 oder 90. Sie sind auch das erste wichtige Indiz dafür, dass sich gebildete Menschen dem Christentum zuwandten.
Lukas schrieb seine Berichte aufgrund von Zeugenaussagen von Menschen, die Jesus begegnet waren oder über ihn etwas von anderen erfahren hatten. Er schildert einen sehr menschlichen Jesus, der mitfühlt und am Schicksal der Menschen, besonders auch der Leidenden, großen Anteil nimmt.
Der Evangelist Matthäus war einer der zwölf Apostel und hieß ursprünglich Levi. Er soll Zöllner in der antiken Hafenstadt Kapharnaum gewesen sein. Somit war er einer der Steuereintreiber, die von den Juden verachtet wurden, weil sie im Dienste der römischen Besatzungsmacht standen.
Der Evangelist Markus war vermutlich der Übersetzer von Petrus und arbeitete auch als dessen Sekretär. Sein Evangelium, das älteste und kürzeste, war vor allem für Nicht-Juden bestimmt. Markus berichtet darin weniger über die Reden Jesu als über seine großen Taten. Er zeigt beim Sohn Gottes auch die menschlichen Züge auf. Johannes, aus dessen Evangelium besonders oft um Ostern zitiert wird, war von Beruf Fischer und Anhänger von Johannes dem Täufer, bevor er sich als Apostel Jesus anschloss. Er soll in der Hafenstadt Ephesus gewirkt haben. Sein Evangelium ist das jüngste der vier und das theologisch anspruchsvollste.
Alle Evangelien sind heute noch in ihrer ursprünglichen Form bekannt. Die später angefertigten griechischen Übersetzungen lagern in den Archiven des Vatikans in Rom.
Der Untergang Jerusalems nach der Eroberung und Zerstörung des Tempels durch die Römer unter ihrem Feldherrn Titus im Jahre 70 hatte auch für die junge christliche Kirche unmittelbare Auswirkungen. Der Schwerpunkt des Christentums rückte nun in den hellenistischen Bereich. Judaistische Lehren und Gebräuche, die bei den ersten Christen noch Geltung hatten – wie die Beschneidung der männlichen Nachkommen oder das Festhalten an den jüdischen Speisegeboten – verfielen rasch.
Zwar blieb der Gott der Juden der Vater von Jesus Christus – dennoch war nach dem Jahre 70 die Trennung in zwei Religionen entschieden. Statt Rücksichtnahme auf die jüdischen Wurzeln findet sich von jetzt an eher Anti-Judaismus bei den christlichen Verkündern. Der Vorwurf: Die Juden hatten ihren eigenen Messias nicht erkannt und noch dazu den Römern ausgeliefert.
Im Jahre 150 lagen die meisten Christen-Gemeinden in Kleinasien, im Osten des Römischen Reiches. Bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts war das Griechische so gut wie überall die Kirchensprache. Die rasche Ausbreitung des Christentums lag auch am Ernst und der Prinzipientreue der Anhänger Jesu. In einer Zeit, in der voller Inbrunst von Sittlichkeit und Tugend gesprochen wurde, praktizierten diese Christen sie besonders eindrucksvoll. Großen Eindruck hat offenbar auch die Nächstenliebe gemacht, die frühe christliche Gemeinden gerade in Zeiten der Not überleben ließ. Von der Kirche wurden zudem gesellschaftliche Schranken durchbrochen. Sklaven und Frauen waren gleichberechtigte Mitglieder in den christlichen Gemeinden.
Der Erfolg zog neuen Erfolg nach sich. Bald gab es in Kleinasien kaum eine Siedlung ohne eine christliche Gemeinde. In der römischen Gesellschaft des 2. Jahrhunderts waren Abscheu und Gleichgültigkeit gegen diese „barbarische Sekte“ dennoch stark.
Der Beginn des vierten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung markiert den Niedergang des „Imperium Romanum“. Die ständigen Konflikte an den langen Grenzen vor allem im Norden und Osten und die dadurch erforderlichen hohen Ausgaben für das Militär führten zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dauerkrise.
Die Mannschaftsstärke der Legionen konnte nur noch mit Söldnern, meist Mitglieder germanischer Stämme, aufrechterhalten werden. Die göttlich verehrten Kaiser wurden als Retter bei existenziellen Nöten angerufen.
Diese staatliche Hilfe gab es nicht gratis. Opfer wurden für den Staat und die Götter eingefordert. Den Juden, die sich verweigerten, wurde eine Steuer – Fiscus Judaicus – auferlegt.
Die Anhänger Christi mit ihrem monotheistischen Absolutheitsanspruch standen von Anfang an im Konflikt mit den staatlichen Autoritäten. Sie verweigerten den Kaisern gegenüber jede Respektbekundung, was als Majestätsbeleidigung ausgelegt wurde. Auf die Opferverweigerung stand im dritten Jahrhundert die Todesstrafe. Viele Glaubensstarke fanden den Märtyrer-Tod.
Erst in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts schränke Kaiser Gallienus (253 bis 268) nach dem Tode seines Vaters Valerian die Verfolgungspraxis gegen die Christen ein und erließ ein Toleranzedikt.
Kaiser Konstantin, den die Nachwelt „den Großen“ nannte, führte dann letztlich das Christentum als Staatsreligion ein. Angeblich hatte er 312 in Rom bei der berühmten „Schlacht an der Milvischen Brücke“ gegen seinen westlichen Rivalen „Kaiser Maxentius“ eine Vision, die ihn bekehrte. Christliche Geistliche wurden daraufhin von der Steuerpflicht entbunden. Die Kirche erhielt das Recht, Erbschaften anzunehmen, in zivilen Streitigkeiten Gericht zu halten und Sklaven frei zu lassen. Die ersten Schritte zu einem Staat im Staat. Konstantin ordnete an, Prachtausgaben von Bibeln herzustellen und setzte im Jahre 321 den Sonntag – bisher dem Sonnengott Jupiter geweiht – als verbindlichen Feiertag fest. Schließlich entzog der Kaiser den heidnischen Tempeln das Privileg, Kaiserbilder aufzustellen. Baufällige Tempel sollten nicht renoviert und neue nicht erbaut werden. Heidnische Opferzeremonien wurden unter Todesstrafe gestellt. Die römische Religionspolitik hatte sich um 180 Grad gedreht.
Konstantin kämpfte gegen Heidentum und Judentum und für eine einheitliche Reichskirche. Doch eine Frage blieb ungelöst: War Jesus nur ein von Gott gesandter Mensch mit messianischer Vollmacht oder der Sohn Gottes selbst? Bedeutendster Vertreter der Lehre von einem von Gott als Messias bevollmächtigten Menschen Jesus war der Priester „Arius“. Diese Lehre fand in den östlichen Teilen des römischen Reiches großen Zuspruch. Sein größter Widersacher war der Bischof von Alexandria, „Athanasius“.
Um den Streit zu beenden, berief der Kaiser in Nicäa in Kleinasien an Ostern 325 eine Bischofsversammlung ein. Das Konzil sprach sich mit großer Mehrheit für die Lehre des „Athanasius“ aus und verwarf die Lehre des „Arkus“. Freilich stellte das in Nicäa verabschiedete Glaubensbekenntnis keineswegs das Ende aller Streitigkeiten dar. Vielmehr sollten Konflikte und Debatten darüber die Kirche noch lange in Atem halten.
Der oströmische Kaiser Konstantin war es, der Rom zu einer christlichen Hauptstadt um baute. Am Stadtrand, an dem er über große Grundstücke verfügte, ließ er die „Laterankirche“ errichten. Eine gewaltige Basilika, 50 Meter breit, 100 Meter lang und in drei Schiffe gegliedert. Christus, auf Fresken und Reliefs zuvor nur ein in einer schlichten Tunika gekleideter bartloser Jüngling mit kurzem Haar, erscheint nun als langhaariger Mann mit Mittelscheitel und Kinnbart. Eine Darstellungsweise, die früher die Abbildungen des griechischen Gottes „Asklepios“ gekennzeichnet hatte.
Mit und nach Konstantin erheben den bärtigen, autoritär wirkenden Christus dann noch die Insignien der Macht, purpurne Gewänder und einen goldenen Schein. „Christus Pantokrator“, der Herrscher über die Welt. Eine grandiose Erfolgsgeschichte innerhalb von vier Jahrhunderten.
Von Anfang an wirkte sich die Vorrangstellung Roms innerhalb des Reiches auch auf die Bedeutung der christlichen Gemeinden innerhalb der Kirchenhierarchie aus. Die Stadt am Tiber war schon immer Treffpunkt und Ziel von Christen aus allen Himmelsrichtungen gewesen. Diese Gemeinde war nicht nur groß und reich, sie besaß, was keine andere vorzuweisen hatte: Die zwei größten Apostel und Märtyrer. Peter und Paul hatten hier gelebt und missioniert, waren hier heldenhaft gestorben und lagen hier begraben. Die Heiligkeit der römischen Gemeinde und eine gewisse Vorrangstellung ihres Bischofs wurden im späten 2. Jahrhundert allgemein anerkannt. Die Stammzelle der römisch-katholischen Kirche, deren Führer sich später als Nachfolger Petri und – gar nicht bescheiden – als Stellvertreter Gottes auf Erden bezeichneten. Die Neutralität, die Konstantin zwischen dem Christentum und den übrigen Religionen offiziell gewahrt hatte, wurde bereits von seinen Söhnen aufgegeben. Gesetzlich war fortan jede heidnische Kultübung im Reich untersagt.
Es gab nun auch erste Auswüchse extremer Frömmigkeit. Asketen wie Mönche verarbeiteten ihre Enttäuschung darüber, dass die ersehnte Wiederkehr des göttlichen Herrn ausblieb, oft dadurch, dass sie sich so weit wie nur möglich aus der unerlösten Welt zurück zogen und durch Gebet und Andacht Gott und der jenseitigen Welt so nahe wie möglich zu kommen suchten.
Die Eremiten verschärften diese Praxis, wenn sie auf soziale Beziehungen mit Gleichgesinnten verzichteten und sich in die Einsamkeit, in die Wüste, auf Berghöhen oder gar auf Säulen begaben und dort oft bei wenig Nahrung Jahre verbrachten. Berühmt wurde der syrische Säulenheilige Simeon zu Beginn des fünften Jahrhunderts, der 30 Jahre auf einer 20 Meter hohen Säule mit einer etwa vier Quadratmeter großen Fläche nicht nur 40 Tage fastete, sondern sich auch noch täglich bis zu 1000 mal tief verbeugte. Als er noch in einem Kloster lebte, hatte er sich schon vorher freiwillig für zehn Jahre einmauern lassen. Vermutlich lag es auch an diesen „Säulenheiligen“, die vor allem im Osten von sich reden machten, dass die Kluft zwischen Ost und West immer tiefer wurde.
Das Christentum in seiner heutigen Gestalt ist nicht denkbar ohne den Kirchenvater Augustin (354 bis 430). In seinem berühmtesten Buch, den “Confessiones”, schildert er seinen Werdegang von der weltlichen Laufbahn und Lebensart des Rhetorikers über die Wendung zur Philosophie, die unbefriedigende Beschäftigung mit der Astrologie bis zur überwältigenden Begegnung mit dem geistlich und geistig imponierenden Christentum.
Augustin hat mit den “Confessiones” das ...
Inhaltsverzeichnis
- Deckel
- Titelblatt
- Urheberrecht
- Inhaltsverzeichnis
- Das Reich der Sumerer
- Ägypten – das Geschenk des Nils
- Die Hethiter – das Volk der 1000 Götter
- Die Assyrer – die Preußen des Orients
- Das Perserreich der Achämeniden
- Das Reich Alexanders des Großen
- Rom
- Christentum
- Der Siegeszug des Islam
- Byzanz
- Das Reich der Osmanen
- Azteken-Reich
- Das spanische Kolonial- und Weltreich
- Das Reich der Habsburger
- Das britische Empire
- Russland und die Sowjetunion
- China – der wieder erstarkte Drache
- Die USA – der imperiale Riese