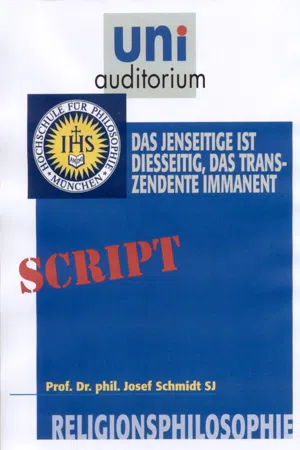
eBook - ePub
Religionsphilosophie, Teil 5
Das Jenseitige ist diesseitig, das Transzendente immanent
- 8 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Gibt es für uns einen Bezug zum Ewigen, Göttlichen, so dass die Welt nicht einfach "alles" ist? Haben wir eine letzte Orientierung, einen letzten Halt? Die Antwort der Religion ist die, dass wir aus einem uns tragenden, aber auch uns beanspruchenden Sinngrund leben, in dem wir Halt und Orientierung finden und für den der Name "Gott" steht.
Seit Beginn des kritischen Denkens im alten Griechenland wollte man diese Antwort im Diskurs denkend entscheiden.
DAS JENSEITIGE IST DIESSEITIG, DAS TRANSZENDENTE IMMANENT
Mit der Frage der Personalität Gottes hängt die nach seinem Verhältnis zur Welt zusammen. Wenn Gott sich von der Welt radikal unterscheidet, scheint er ihr gegenüberzustehen. Das Verhältnis ist nur in einer Einheit von Transzendenz und Immanenz zu begreifen.
Wie weit werden die verschiedenen Modelle des Gott-Welt-Verhältnisses, die in der Geschichte der Philosophie entwickelt wurden, wie Monismus, Dualismus oder Pantheismus der geforderten Differenz-Identität von Gott und Welt gerecht?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Religionsphilosophie, Teil 5 von Josef Schmidt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Bibeln. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
Theologie & ReligionThema
BibelnAls wir uns mit den Gottesbeweisen beschäftigt haben, wurde klar, dass es sich hier nicht um Beweise handelt wie in den axiomatischen oder empirischen Wissenschaften, sondern um Beweise ganz eigener Art. Sie bestehen in verschiedenen Varianten und von verschiedenen Aspekten ausgehend in dem einen Gedanken, dass zwar alles um uns herum und wir selbst endlich und begrenzt ist, dass aber eben diese Erkenntnis nur möglich ist, wenn wir in eine Dimension hineinreichen, die dieser Begrenztheit nicht unterliegt. Da diese Einheit nur aus einer strikten Reflexion auf sich selbst sich ergibt, hat sie keine äußeren Voraussetzungen. Und eben hierin erfasst sie eine letzte Voraussetzungslosigkeit. Auf andere Weise könnte man zu dieser gar nicht kommen. Ich könnte nur zu leugnen versuchen, dass ich zu ihr gelangen kann. Nur es zeigt sich, dass ich sie eben dann auch wieder voraussetze. Denn dann gilt ja, dass es sie nicht geben kann, d.h. nicht nur faktisch nicht gibt, sondern notwendig nicht, also voraussetzungslos.
Nun liegt aber in diesen Beweisen auch enthalten, dass sie neue Fragen aufwerfen. Sie sind also in ihrer Letztbegründung auch unabgeschlossen. Sie werfen Fragen auf, die zu ihrem genaueren Durchdenken nötigen und auf diese Weise eine gewisse Kreativität im Blick auf das Verständnis unserer Wirklichkeit entfalten.
Ein wichtiges Folgeproblem der Gottesbeweise ergibt sich damit, dass wir offensichtlich unterscheiden müssen zwischen einem Bereich des Unendlichen, des Absoluten, des Unbedingten und einem Bereich des Bedingten, des Relativen, des Endlichen. Ein Problem ergibt sich damit insofern, als ich nämlich dieses Unendliche dem Endlichen gegenüberstelle: Hier stehen sich zwei gegenüber, das eine und das andere. Aber ist das nicht eine äußere Relation? Und war nicht gerade die äußere Relation im kosmologischen Gottesbeweis ein Zeichen der Endlichkeit?
Mit dieser Frage muss sich die philosophische Theologie beschäftigen.
Nun haben wir gesehen, dass es in den Gottesbeweisen auch Ansätze zur Lösung dieser Antinomie gibt. Ein Ansatz liegt darin, dass nicht von einer Gegenüberstellung auf gleicher Ebene die Rede sein kann, da es sich um ein Begründungsverhältnis handelt. Es ist eine Beziehung radikaler Asymmetrie. Das Endliche gründet im Unendlichen, und dieses gründet nicht gleicher Weise in jenem. Die Begründung kann nur so gedacht werden, dass das Begründende das Begründete umfasst und in ihm präsent ist als dessen innerster Seinsgrund, d.h. auch als dessen Sein. Damit steht dann das Begründende dem Begründeten gegenüber aber auch wieder nicht, sondern es umfasst es gleichzeitig. Wir haben gesehen, dass die christliche Lehre eben diesen Umfassungs- und Präsenzgedanken besonders betont und damit auch von philosophischer Relevanz ist. Doch um diese Lösung in ihrem Gewicht richtig einschätzen zu können, müssen wir uns die Modelle genauer anschauen, in denen in der Geistesgeschichte das Verhältnis von Unendlichem und Endlichem, von Gott und Welt gedacht wurde.
Der Unendlichkeitsmonismus
Da gibt es zunächst einmal die Möglichkeit, das Verhältnis von Endlichem und Unendlichem so zu denken, dass es sich um eine Identität handelt, in der die eigentliche Wahrheit und Wirklichkeit das Unendliche ist. Was ist dann mit dem Endlichen? Das Endliche ist dann nur Schein. Man kann dieses Modell „Unendlichkeitsmonismus“ nennen. Monismus, vom griechischen monas, „allein“, bedeutet dann: Es gibt allein das Unendliche. Das Endliche ist nicht eigentlich wirklich. Es kommt uns nur so vor. In der abendländischen Geistesgeschichte ist Parmenides als Vertreter eines solchen Monismus zu nennen. Für ihn gibt es nur das reine Sein in seiner Einheit. Unsere Welt mit ihren Unterschieden ist nur Schein.
In die Nähe eines solchen Monismus kommt auch Spinoza, für den es nur eine einzige substantielle Wirklichkeit gibt, die Gottes.
In den östlichen Weisheitslehren ist vor allem die Vedanta-Philosophie zu nennen, deren prominentester Vertreter Shankara ist (9. Jahrhundert) in Indien. Seine Lehre ist die des Advaita, d.h. der Nicht-Zweiheit, also der reinen Identität. Die Vielfalt unserer Welt ist der Schein, der Schleier der Maya, der auf die Wahrheit des einen Seins hin zu durchdringen ist.
Was ist philosophisch zu diesem „Unendlichkeitsmonismus“ zu sagen? Die Kritik ist die, dass diese Sicht das Endliche nie ganz los wird. Auch wenn es zum Schein degradiert wird, ist es doch immer da. Das heißt, man muss das Endliche doch irgendwie gelten lassen und ernst nehmen. Es ist nicht ganz nichts. Der Schein ist auch etwas, sonst könnten wir nicht über ihn reden. Und wenn er schon ist, dann muss er ernst genommen werden. Und dieses „ernst nehmen“ ist dann eben ein Ernstnehmen des Endlichen. In der Tat ist es so, dass wir nicht umhinkommen es ernst zu nehmen. Wir müssten uns sonst selbst in unserer Endlichkeit vollkommen auslöschen. Doch das würde uns in unauflösliche Widersprüche führen. Es gibt also auch das Endliche, und sein Bereich muss ontologisch gewürdigt werden.
Der „Unendlichkeitsmonismus“ ist also zu kritisieren, weil er das Endliche nicht genügend erst nimmt. Nimmt er aber der Unendliche so ernst wie er vorgibt? Offenbar kann nach ihm das Unendliche nur bestehen, wenn das Endliche nicht existiert oder zumindest gegen Null geht. Hier wird also das Unendliche in einem Konkurrenzverhältnis zum Endlichen gedacht. Doch ist dies mit der Souveränität des Unendlichen vereinbar, dass es sich nur in Konkurrenz zum Endlichen behaupten kann? Ist es nicht insofern abhängig und bedingt von ihm? Wäre das Unendliche nicht souveräner gedacht, wenn es das Endliche gelten lassen könnte? Wenn es ihm Raum geben könnte? Wäre das nicht seiner Vollkommenheit mehr entsprechend? So lässt sich also auch die Frage stellen ob im „Unendlichkeitsmonismus“ das Unendliche in seiner wahren Größe gedacht wird.
Der Endlichkeitsmonismus
Das zweite Modell ist, spiegelbildlich zum „Unendlichkeitsmonismus“, der „Endlichkeitsmonismus“. Er besagt: Es existiert nur das Endliche. Das Unendliche ist nur ein Schein. Das wird von allen Systemen vertreten, die Welt als Zusammenhang des Endlichen für das einzige erklären, also alle Systeme des Naturalismus oder Materialismus. Zur Kritik kann auf den kosmologischen Gottesbeweis verwiesen werden, der zeigt, dass das Endliche nicht das einzige sein kann, da es nicht möglich ist, das Endliche als ein Durchsich-Sein zu denken. Das müßte es aber sein, wenn es das „ein und alles” wäre. Es kann nun aber auch, ähnlich wie beim „Unendlichkeitsmonismus“, auch gefragt werden, ob denn hier dasjenige, das so betont und als das Einzige hingestellt wird, wirklich ernstgenommen wird. Hier ist es das Endliche. Wird er hier wirklich in seiner Eigentümlichkeit aufgefasst?
Wenn man genauer hinsieht, dann wird das einzelne Endliche stets nur so erklärt, dass es in seiner Begründung auf anderes Endliches zurückgeführt wird, und zwar vollständig. Denn alles, was es ausmacht, ist endlich und begründungsbedürftig, und der Grund liegt immer in anderem Endlichen. So verschwindet das Endliche gleichsam im anderen Endlichen. Wenn aber alles einzelne in dieser Weise verschwindet, verschwindet alles, denn alles ist Endliches.
Wenn man nun sagt: Nein, es muss im Endlichen etwas geben, das sich diesem Verschwinden entzieht, denn sonst wäre es unmöglich an irgendeine Eigenwirksamkeit in der Welt oder der Welt im ganzen zu glauben, dann ist die Frage, worin diese Eigenwirklichkeit des Endlichen eigentlich begründet sein soll. Wenn sie nicht im anderen Endlichen begründet sein soll und auch nicht im Endlichen, denn das Endliche soll ja gerade begründungsbedürftig sein, so gibt es nur eine Möglichkeit: die Begründung durch das Unendliche.
Es zeigt sich hier das Überraschende, dass die Bewahrung der Eigenwirklichkeit des Endlichen, also seine Bewahrung vor dem Verschwinden, nur möglich ist, wenn das Unendliche als Grund ins Spiel kommt.
Nehmen wir unsere Freiheit. Wenn es sie gibt, dann muss sie eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber dem äußeren Kontext haben, sonst würde sie sich in Determinismus auflösen. Sie kann aber auch nicht schlechthin aus sich selbst sein. Dann wäre sie das Unendliche. Ihre Begründung muss aber im Unendlichen liegen. Nur dieses garantiert ihren Selbststand dem Kontext gegenüber und lässt sie zugleich begründet sein.
Der Dualismus
Logisch ergibt sich ein weiteres Modell, nämlich der vollkommene Auseinanderfall der beiden Seiten: Der Dualismus. Ein radikaler Dualismus wurde in der Geistesgeschichte selten vertreten. Am ehesten kann man hier die Gnosis des 2. Jahrhunderts nennen und den aus Persien kommenden Manichäismus, in den die gnostischen Systeme im 3. Jahrhundert mehr oder weniger aufgingen.
Es werden zwei Prinzipien angenommen: ein gutes und Böses, die gleichmächtig nebeneinander stehen und im Kampf liegen, meist verbunden mit dem Geistigen auf der einen, dem Materiellen auf der anderen Seite. Philosophisch gibt es Dualismen überall dort, wo zwei Seiten unvermittelt und unvermittelbar gegeneinander gestellt werden. Dies kann ontologisch, aber auch erkenntnistheoretisch geschehen, etwa wenn gesagt wird: Unsere Erkenntnis erreicht die Wirklichkeit in keiner Weise.
Die einfache Kritik an jeder Art von Dualismus ist folgende: Wie kann man überhaupt von zwei Seiten sprechen, wenn es keine Vermittlung gibt? Wenn ich von zwei Seiten spreche, dann denke ich immer eine Vermittlung mit. Es gibt keine Trennung ohne jede Gemeinsamkeit, sonst könnte ich vom Gegenüber gar nicht reden. Dieses Dritte verlangt aber dann nach Explikation, und die wird im Dualismus nicht gegeben.
Der Pantheismus
Pantheismus, dieses Wort ist in der Aufklärungszeit in Verbindung mit den Deisten entstanden. Das sind diejenigen, die einen Schöpfergott vertraten – der ohne jeden Bezug zu Bibel nur von der Vernunft zu konzipieren wäre. Dieser Deismus kam nach den Religionskriegen auf, als man nach einer Begründung der Religion unabhängig von der immer strittigen Bibel suchte. Diesen Deisten wurde dann der Vorwurf gemacht, sie würden Gott nicht genügend von der Welt unterscheiden, sondern beide als ununterscheidbare Gesamtheit begreifen, und so nannte man sie Pantheisten. Z. B. dem Deisten John Toland wurde dieser Vorwurf gemacht und damit der Begriff des Pantheismus geprägt.
Dann aber verselbständigte sich der Begriff und wird bis heute angewendet auf Systeme, die eine Einheit von Welt und Gott behaupten, ohne dass klar wird, welche Seite nun in welcher aufgeht.
Wenn man Beispiele in der Geistesgeschichte sucht, so könnte man wohl am ehesten an Spinoza denken. Denn bei ihm ist es in der Tat nicht klar, ob die eine göttliche Substanz nun eher nach der geistigen oder der materiellen Seite zu deuten ist. Spinoza wurde auch nach beiden Seiten hin ausgelegt. So wurde er etwa von Holbach materialistisch, von Herder theistisch ausgelegt.
Diese Ambivalenz liegt im Begriff des Pantheismus. Man kann die in ihm ausgesagte Identität einmal so formulieren: Alles ist Gott, oder so: Gott ist alles. Wenn im Satz das Prädikat die Bedeutung des Subjektes angibt, dann heißt dies im ersten Fall: Das noch unbestimmte Subjekt Gott bekommt die Bedeutung: “alles”, d.h. die Gesamtheit der Weltdinge, und darin besteht dann das Ganze. Wir haben damit den „Endlichkeitsmonismus“. Im zweiten Fall liegt die Bedeutungsangabe im Begriff “Gott”. Damit ist er die eigentliche Wirklichkeit. D.h. wir haben den „Unendlichkeitsmonismus“. Es zeigt sich also: Der Pantheismus ist ein schillerndes System.
Meist wurde und wird er auch eher einem poetisch formulierten Weltgefühl zugeschrieben. Oft wird Goethe pantheistisch interpretiert. Doch Goethe hat seine Weltanschauung einmal (etwas änigmatisch) so formuliert: “Als Poet bin ich Polytheist, als Naturbetrachter Pantheist, als sittlicher Mensch Theist”. In seiner Dichtung bringt Goethe eine tiefe Religiosität zum Ausdruck, die man oft einfach als pantheistisch etikettiert hat, die man aber ebenso gut theistisch interpretierten kann. Nur ein Beispiel, das Sie sicher kennen:
“Kein Wesen kann zu nichts zerfallen, das Ewige regt sich fort in allem. Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig, denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchen sich das All geschmückt”. Oder: “Was wär’ ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt’s die Welt im Innern zu bewegen. Natur in sich, sich in Natur zu hegen, so dass, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst”.
Dieses letzte Gedicht enthält eine Kritik an der Gotteslehre des Aristoteles, der vom “ersten Beweger” spricht. Wir haben allerdings gesehen, dass Aristoteles den ersten Beweger keineswegs in einem so äußerlichen Verhältnis zur Welt denkt. Man muss aber zugeben, dass er von den Scholastikern, und sie hat Goethe vor Augen, oft so konzipiert wurde.
Man kann Goethes Gedichte durchaus theistisch und christlich interpretieren. Man denke nur an Aussagen wie die von Paulus in Athen, wo er von Gott sagt: “In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir”. Auch die Bibel spricht also von einer Einheit von Welt und Gott, aber es ist eine Einheit, die die Unterschiedenheit enthält. Dem Pantheismus ist eigentlich nur seine begriffliche Unschärfe vorzuwerfen, die ihn einseitig interpretierbar macht.
Auf eine Variante des Pantheismus möchte ich noch verweisen, und zwar auf den “Panentheismus”. Die Wortprägung stammt von dem Schellingschüler Karl Christian Krause. Er wollte damit dem Anliegen des Pantheismus Rechnung tragen, die Einheit von Gott und Welt zu betonen, ohne in die Unbestimmtheit von dessen Identitätssicht zu geraten. Nicht alles ist Gott, sondern alles ist “in Gott”, wobei die Unterschiedenheit von Gott und Welt bleibt.
Krause hat das in seiner Gotteslehre sehr eindrucksvoll ausgeführt. Er ist damit seinen großen idealistischen Kollegen (Schelling und Hegel) durchaus ebenbürtig. Leider ist er bei uns fast völlig vergessen. Allerdings hatte er spanische Schüler, durch die der deutsche Idealismus in Spanien bekannt und heimisch wurde. Der Idealismus wird deshalb dort oft Crausismo genannt. Krause liegt auf dem Münchner Süd-Friedhof mit vielen Münchner Berühmtheiten zusammen begraben.
Die Schöpfungslehre
Als fünftes Modell soll nun die Schöpfungslehre betrachtet werden. Angesichts der Aporien, in welche die bisher betrachteten Modelle geraten sind, dürfte diese Lehre durchaus auch philosophisch interessant sein.
In der Antike gibt es einen interessanten Ansatz, eine Schöpfung der Welt philosophisch zu denken, und zwar in dem Dialog “Timaios” von Platon. Es ist in diesem Dialog von einem Gott die Rede, einem “Demiurgen” (Handwerker), der die Welt erschafft. Für Platon ist es zwar ein Mythos, weil der Sachverhalt sich seiner Ansicht nach einer streng wissenschaftlichen Darstellung...
Inhaltsverzeichnis
- Der Unendlichkeitsmonismus