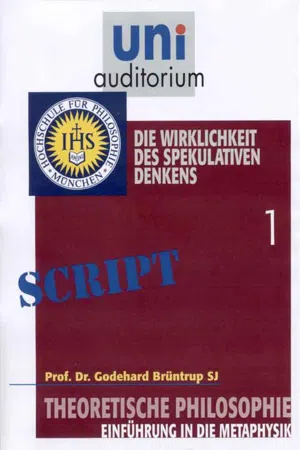
- 13 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Mit dem Wort "Philosophie" verbindet man gewöhnlich den Versuch, ein umfassendes Weltbild zu entwerfen und zu begründen. Die Metaphysik ist das Herzstück dieser theoretischen Unternehmung. Über den Bereich des naturwissenschaftlich Überprüfbaren hinaus versucht die Metaphysik letzte Grundfragen vor dem kritischen Auge der Vernunft zu prüfen: Gibt es Beständiges, oder ist alles im Fluss? Gibt es nur Materie oder auch Geist? Gibt es Freiheit, oder ist alles determiniert? Gibt es autonome Personen oder nur das biologische Lebewesen Mensch?
DIE WIRKLICHKEIT DES SPEKULATIVEN DENKENS
Kann ein rational begründetes Weltbild entworfen werden, das auf spekulativem Denken beruht? Was ist der Gegenstand und die Methode der Metaphysik?
Die Methode der am meisten verbreiteten Metaphysik wird dargestellt und von anderen Wissenschaften abgesetzt. Dabei geht es nicht um starre, dogmatische Thesen. Die im Prozess des spekulativen Denkens gestellten Fragen haben oft mehr als nur eine vernünftige Antwort. Die Metaphysik stellt damit sogar einen wesentlichen Bestandteil der kritischen Selbstvergewisserung eines intellektuell redlich gelebten Lebens dar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Theoretische Philosophie, Teil 1 von Godehard Br im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Geschichte & Theorie der Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Ich begrüße Sie zur ersten der sechs Vorlesungen mit dem Thema „Metaphysik“. Der Begriff Metaphysik ist vielen vermutlich unbekannt. Es ist kein Schulfach wie die Physik oder andere Fächer, die wir gemeinhin schon in jungen Jahren kennen lernen. Und man verbindet damit oft etwas Esoterisches, vielleicht sogar etwas Unwissenschaftliches. Aber das ist sicherlich nicht der Fall. Die Metaphysik ist der Versuch, auf die allgemeinsten und grundlegendsten Fragen über die Strukturen der Wirklichkeit mit wissenschaftlicher Strenge Antworten zu finden. Die Metaphysik liefert uns sogar Weltbilder, große zusammenhängende Bilder dessen, was überhaupt wirklich ist.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: Den Gegensatz zwischen einem „physikalistischen“ wie wir heute sagen, früher hätte man gesagt „materialistischen“ Weltbild, im Vergleich zu einem „idealistischen“ Weltbild. Beide beruhen auf metaphysischen Annahmen. Wir haben sie nicht direkt aus der Erfahrung gewonnen wie die Naturwissenschaften, sondern es ist eine spekulative Gesamtsicht der Wirklichkeit. Der „Materialist“ oder „Physikalist“ sagt, dass die Wirklichkeit letztendlich nur aus materiellen Partikeln oder Teilchen besteht. Und diese unterste Ebene der Materie legt alles andere, was es gibt, fest. Alles andere fährt sozusagen nur Huckepack auf der Verteilung der Teilchen. Dazu gehören auch die Lebewesen, die Personen, die sind nichts anderes als komplexe Anordnungen von solchen Teilchen. Es gibt in der Welt keinen Geist, es gibt keine objektiven Werte, es gibt keinen Sinn und kein Ziel. Die gesamte Wirklichkeit ist eigentlich nur die Bewegung von Teilchen in Raum und Zeit.
Ein idealistisches Weltbild wird dahingegen behaupten, dass die physikalischen Fakten nicht alle Fakten festlegen. Es wird behauptet, dass es nichtphysische und nichtmaterielle Entitäten, also Seiende, gibt und dass wir nicht alles, was es gibt, vor allen Dingen die geistigen Phänomene, auf rein Materielles zurückführen, also reduzieren können. Und es wird weiterhin in diesem Weltbild manchmal behauptet, dass es objektive Werte gibt, dass es Ziele gibt, dass es eine geistige Realität gibt, die wir mit unserer Vernunft erfassen können und die wir nicht direkt sinnlich wahrnehmen können.
Eine bekannte Variante einer solchen Weltsicht ist natürlich die religiöse Weltsicht, wo behauptet wird, dass jenseits des beobachtbaren Kosmos noch eine transzendente Realität existiert, die die Religionen „Gott“ nennen.
Jeder wird zugeben, dass diese Weise, die Welt zu interpretieren, zu den fundamentalsten geistigen Herausforderungen eines jeden intellektuell bewusst geführten Lebens gehört. Jeder Mensch wird sich im Laufe seines Lebens über diese Frage selbst vergewissern und sich fragen: Wie sehe ich das eigentlich? Habe ich eine materialistische Weltsicht oder keine materialistische Weltsicht? Halte ich es für vernünftig, an eine transzendente Realität zu glauben, halte ich das für unvernünftig?
Diese Fragen nach den allgemeinsten Strukturen der Wirklichkeit sind metaphysische Fragen. Und die These der Metaphysik ist es, dass diese Fragen keine reinen Geschmacksfragen sind, sondern dass man mit der großen Geschichte der Philosophie und auf ihr aufbauend Methoden hat und Methoden entwickelt hat, diese Fragen vernünftig und rational anzugehen.
Wir müssen diese Weise des Vorgehens der Metaphysik absetzen von den rein empirischen Fragen, wie wir sie in den Naturwissenschaften zunächst vorfinden.
Die Physik arbeitet mit dem Experiment, der Beobachtung: Die Natur wird befragt, indem ich sie im Experiment um eine Antwort bitte. Einen Test sozusagen durchführe. Die Metaphysik arbeitet nicht mit dieser Methode der Empirie. Ihr nächster Verwandter ist eine Wissenschaft, die Sie alle kennen, weil man in der Schule nicht darum herum kommt, nämlich die Mathematik.
Die Mathematik arbeitet nicht mit der Sinnenerfahrung, also, wie die Philosophen sagen, sie ist nicht a posteriori, sondern sie ist reine Begriffsanalyse oder wie die Philosophen sagen a priori. Ist die Metaphysik eine Geisteswissenschaft?
Das ist eine gute Frage. Oft sagt man, die Philosophie ist eine Geisteswissenschaft. Aber die Unterscheidung von Natur und Geisteswissenschaften macht bei der Philosophie in gewisser Weise wenig Sinn. Warum ist das so?
Die Geisteswissenschaften in ihrer bekannten Form untersuchen normalerweise Produkte des menschlichen Geistes, zum Beispiel die Literaturwissenschaft die Produkte menschlicher Vernunft in der Geschichte einer Kultur, einer Sprache untersucht. Die Philosophie, insbesondere die Metaphysik untersucht nicht einfach Produkte des menschlichen Geistes, das tut vielleicht die Philosophiegeschichte, aber die Philosophie selbst untersucht die Grundstrukturen der Wirklichkeit, auch der Natur. Insofern ist die Metaphysik auch eine Naturwissenschaft. Aber auf eine andere Weise als die Naturwissenschaften wie wir sie kennen, die empirisch arbeiten.
Sie stellt viel allgemeinere Fragen. Zum Beispiel: Welche Arten von Dingen, von Entitäten gibt es überhaupt in der Welt? Gibt es nur solche, die in Raum und Zeit existieren, also Elementarteilchen, Konglomerate aus Elementarteilchen, oder gibt es auch Entitäten, die nicht in Raum und Zeit existieren? Das könnte zum Beispiel der Gegenstand der Mathematik sein. Zahlen, die Idee des Dreiecks oder vielleicht auch Werte. Oder alle anderen Wissenschaften setzen voraus, dass Dinge, Einzeldinge Eigenschaften haben. Keine Wissenschaft, außer der Metaphysik, fragt: Was ist überhaupt eine Eigenschaft? Was ist überhaupt ein Einzelding? Damit werden wir uns in späteren Vorlesungen dieser Reihe noch beschäftigen müssen.
In vielen Wissenschaften spricht man von Möglichkeiten. Zum Beispiel: Etwas ist wasserlöslich. Unter bestimmten Bedingungen, wenn es in Wasser gegeben wird, löst es sich auf. Aber die Naturwissenschaften sagen uns nicht, was überhaupt eine Möglichkeit ist. Die Metaphysik beschäftigt sich damit.
Oder in den Naturwissenschaften beschreiben wir Veränderungen. Normalerweise mit Differentialgleichungen. Aber die Frage ist: Was ist überhaupt Veränderung? Denn wenn sich etwas verändert, muss es ja in bestimmter Weise dasselbe bleiben, sonst hätten wir nicht eine Veränderung, sondern das Auftauchen von etwas völlig Neuem. Und unter anderer Rücksicht muss es sich ändern, sonst haben wir eben einfach nur dasselbe. Wie ist dieses Zusammenspiel von Gleichbleiben, Identität bewahren und die Identität nicht bewahren, neue Eigenschaften zu bekommen, bei Veränderungen zu verstehen? Was ist überhaupt Veränderung? Das wär eine Frage, die die Metaphysik stellt.
Klassisch gesehen hat man neben dieser allgemeinen Metaphysik drei spezielle Metaphysiken unterschieden, oder neben der klassischen Metaphysik gab es diese drei Disziplinen der speziellen Metaphysik, nämlich Gott, Seele und Kosmos. Diejenige, die sich mit Gott beschäftigt, die Metaphysik des Absoluten oder die philosophische Gotteslehre fragt nach der Metaphysik des absolut notwendig Seienden. Die Metaphysik der Person oder der Seele fragt: Was heißt es überhaupt eine Person zu sein? Und dazu gehört auch – das ein eigener Gegenstand dieser Vorlesung– was ist das Verhältnis von Körper und Geist, das Leib-Seele-Problem. Und die Metaphysik des Kosmos ist die Frage nach den philosophischen Problemen, die sich aus der Kosmologie, aus der Astrophysik und verwandter Gebiete ergeben.
In dieser Vorlesung werde ich diese spezialen Metaphysiken wenig berühren, außer der Metaphysik der Person. Ich behandle hier primär die Frage: Was sind die allgemeinsten Strukturen der Wirklichkeit? Und ein wenig auch die Frage, was ist unser Platz als Mensch, als Menschen in dieser Wirklichkeit.
Eine eigene Vorlesung in dieser Reihe wird der Frage gewidmet sein: Gibt es Freiheit? Was ist der metaphysische Freiheitsbegriff?
Nun hatte ich Ihnen gesagt, dass die Metaphysik ihrer Methode nach der Mathematik verwandter ist als der Physik. Die Mathematik kann man ja betreiben, indem man die Augen schließt und zum Beispiel über den Begriff des Dreiecks oder den Begriff der Primzahlen nachdenkt. Und diesen Begriff analysiert. Die Methode der Mathematik ist von daher Begriffsanalyse. Die Metaphysik geht ebenso mit Begriffsanalyse vor. Nur dass die Begriffe, die sie analysiert, andere sind als die mathematischen. Die Metaphysik wird Begriffe analysieren wie zum Beispiel Freiheit, Seele, Substanz oder Möglichkeit. Ich will Ihnen das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Nämlich an dem Argument des René Descartes für die Nichtidentität von Körper und Geist. Oder an einem Argument im Geiste des Descartes. Es steht nicht ganz genauso bei Descartes, aber in ähnlicher Form. Das Argument läuft folgendermaßen: Es ist widerspruchsfrei denkbar, dass ich nur mit der Eigenschaft „ist-denkend“ existiere, aber ohne die Eigenschaft „ist-ausgedehnt“. Das heißt, spekuliert Descartes: Ich könnte mich darüber täuschen, dass mein Körper existiert. Nehmen wir an wie in dem Film Matrix, dass mir die ganze Außenwelt nur vorgespiegelt wird von einem bösen Geist, von einer bösen Maschine, dann habe ich vielleicht gar keinen Körper. Worüber ich mich aber nicht täuschen kann, ist, dass ich denke.
Denn selbst wenn ich mich täusche oder wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich täusche, bin ich immer am Denken. Deshalb: Das eine, worüber man sich letztlich nicht täuschen kann, ist, dass man denkt. Es ist also widerspruchsfrei denkbar, dass ich existiere nur mit der Eigenschaft „ist-denkend“, ohne aber die Eigenschaft ist-ausgedehnt zu haben. Oder mit anderen Worten: Meine körperlose Existenz ist kein logischer Widerspruch.
Der nächste Schritt in dem Argument ist, wenn ich mich ohne die Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ denken kann, dann kommt mir diese Eigenschaft nicht wesentlich, das heißt nicht notwendig zu. Wenn ich mir denken kann, ich könnte auch ein reiner Geist sein, der sich die Wirklichkeit nur träumt, die materielle Wirklichkeit, die räumliche Wirklichkeit nur vorstellt. Wenn ich mir das vorstellen kann, dann kommt mir diese Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ eben nicht notwendig zu.
Der dritte Schritt des Arguments ist der Folgende: Allen physischen Körpern kommt aber die Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ wesentlich zu. Also physische Körper sind notwendig im Raum ausgedehnt. Daraus ergibt sich Folgendes: Mir kommt die Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ nicht notwendig zu, physischen Körpern kommt die Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ notwendig zu. Also, schließt Descartes: Ich bin nicht mein Körper, denn mir kommen andere Eigenschaften notwendig zu als meinem Körper. Leib und Seele sind nicht identisch.
Das ist in ganz kurzer Form ein Argument in kartesischer Tradition für die Nichtidentität von Körper und Geist, und es ist ein typisches Beispiel für metaphysisches Denken. Es läuft eigentlich in einem Dreischritt ab. Diesen Dreischritt nenne ich epistemisch, modal, ontologisch. Von der Vorstellbarkeit zur Möglichkeit zur Seinsaussage. Das sind die drei fundamentalen Schritte in diesem Argument, die typisch sind für ein Argument in der Metaphysik. Ich kann mir vorstellen, es ist widerspruchsfrei denkbar, dass ich ohne einen Körper existiere. Das ist Vorstellbarkeit. Dann kommt mir die Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ nicht notwendig zu. Das ist die Ebene der Modalität – Notwendigkeit und Möglichkeit. Körpern, physischen Körpern kommt diese Eigenschaft „ist-ausgedehnt“ aber notwendig zu.
Jetzt kommt der dritte Schritt: Also folgt, ich bin nicht identisch mit meinem Körper. Das ist der dritte Schritt, eine ontologische oder metaphysische Konsequenz über die Natur von etwas in dieser Welt, nämlich ich als Person bin nicht identisch mit meinem Körper. Also epistemisch, modal, ontologisch, in diesem Dreischritt vollzieht hier Descartes ein Argument, um zu zeigen, dass die Person als, wie er es nennt, res cogitans, als denkendes Wesen, nicht identisch ist mit dem Gehirn oder dem Körper, der in Raum und Zeit existiert.
Eine solche begriffliche Analyse ist natürlich nicht aus der Erfahrung gewonnen, ähnlich wie die Mathematik, sondern a priori. Das Verständnis eines Begriffes verleiht uns die Fähigkeit, diesen Begriff sozusagen durch verschiedene Möglichkeiten, wie die Philosophen sagen durch verschiedene mögliche Welten, zu verfolgen, um zu sehen, wie er sich dort verhält. Und wenn er sich in allen möglichen Welten auf bestimmte Weise verhält, dann kommt ihm diese Eigenschaft notwendig zu. Man könnte sagen, dass diese Art des Denkens, diese Gedankenexperimente für den Metaphysiker das sind, was für den Naturwissenschaftler die Experimente sind, die er in seinem Labor unternimmt. Dieser Dreischritt, den ich Ihnen vorgestellt habe, ist ein Gedankenexperiment. Damit testet der Metaphysiker, die Metaphysikerin ihre Ideen. Auf der Suche nach Widersprüchen, wie weit reicht mein Denken.
Quantenmechanik
Ein weiterer wichtiger und im Folgenden immer wichtiger werdender Punkt ist allerdings, dass der Übergang von Naturwissenschaft und Metaphysik nicht strikt ist. Nehmen Sie eine oder die grundlegendste Theorie der Naturwissenschaft, über die wir überhaupt verfügen: die Quantenmechanik. Es gibt mindestens drei große Interpretationen der Paradoxien der Quantenmechanik. Darauf brauchen wir hier nicht eingehen, es gibt eigene Vorlesungen darüber (siehe uni-auditorium / Prof. Harald Lesch). Aber die Weltsicht, die sich aus den empirischen Ergebnissen und dem formalen mathematischen Formalismus der Quantenmechanik ergibt, ist zumindestens dreigestaltig. Die klassische und verbreitete Interpretation ist, dass der Beobachter mittels seines Geistes aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die die fundamentalen Gleichungen der Quantenmechanik vorsehen, eine auswählt, sozusagen als Kollaps. Der Kollaps des Wellenpaketes passiert dadurch, dass jemand hinschaut. Vorher sind viele Möglichkeiten der Welt überlagert. Erst durch das Hinschauen wird eine als real ausgewählt.
Das ist überraschend. Einstein hat gesagt, mein Bett springt doch nicht in eine bestimmte Position, wenn ich es anschaue. Und deshalb haben andere Interpreten der Quantenmechanik völlig andere Versuche unternommen. Zum Beispiel der Physiker David Bohm hat gesagt, nein, ich muss eine neue, ganz neue Art von Entitäten einführen, nämlich nichtmaterielle Informationsfelder, und diese informieren die Partikel, Elektronen, über ihre Position im Gesamt des Universums. Und weil die Elektronen über Informationswellen, über ihre Position im gesamten informiert werden, deshalb haben sie diese eigentümlichen Eigenschaften, die die Quantenmechanik entdeckt und die die klassische Mechanik nicht erklären kann.
Eine dritte Interpretation der Quantenmechanik sagt, dass sich zu jedem Zeitpunkt die Welt in viele Parallelwelten aufspaltet und alle Möglichkeiten, die die grundlegenden Gleichungen der Quantenmechanik erlauben, werden in Parallelwelten realisiert. Wenn wir uns also die Frage stellen, warum ist das real geworden, was ich gerade in dieser Welt erlebe unter all den Möglichkeiten, die von der Quantenmechanik her möglich gewesen wären, sagt dieser, man nennt sie die viele-Welten-Theoretiker. Da ist gar nichts Erstaunliches dabei, dass gerade diese Möglichkeit real geworden ist, denn alle anderen Möglichkeiten sind auch real geworden, nur in Parallel-Universen, in anderen Welten.
Sie sehen schon, diese drei Interpretationen der Quantenmechanik implizieren ein völlig verschiedenes Weltbild, wenn Sie so wollen. Im einen ist es der Geist des Beobachters, der auswählt. Im zweiten Fall haben wir eine neue nichtmaterialistische Sicht der Welt, in der es geistige Informationsfelder gibt, die die Teilchen auf ihrem Weg steuern. Und im dritten haben wir plötzlich ganz viele Parallel-Universen, um die Probleme der Quantenmechanik, die Paradoxien der Quantenmechanik, aufzulösen. Das frappierende ist nun, dass jede dieser drei Theorien mit den empirischen Daten und dem mathematischen Formalismus der Quantenmechanik völlig verträglich ist. Welche der drei Theorien nun ein Physiker für die richtige Interpretation der Quantenmechanik hält, ist kein rein naturwissenschaftliches Problem. Es ist eine Interpretation der empirischen Daten auf einer allgemeinen begrifflichen Ebene. Und der eine wird, wenn er zum Beispiel Freiheit betonen will und Spontanität, vielleicht eher zu der ersten Interpretation, wo der Geist des Beobachters so eine Rolle spielt und die Welt indeterministisch ist, mehr auf solch eine Position Wert legen, ein anderer, der eher deterministisch denkt, wird vielleicht eher an all diese Parallel-Universen denken. Wie wir die Quantenmechanik interpretieren, ist keine rein naturwissenschaftliche Frage mehr, sondern wir sind hier bereits in die Metaphysik langsam, vorsichtig jedenfalls hinübergestiegen. Wir machen eine ganz allgemeine begriffliche Interpretation der Wirklichkeit, die weit über das hinausgeht, was uns empirisch und sinnlich gegeben ist.
Also meine These: Der Übergang von Naturwissenschaft zur Ontologie oder Metaphysik ist fließend. Die zentralen Probleme der Metaphysik sind aber noch mal allgemeiner und begrifflicher als die eben vorgestellte Interpretation der Quantenmechanik.
Freiheitsbegriff
Ich möchte Ihnen das am Beispiel des Freiheitsbegriffes verdeutlichen. Die Welt, in der wir leben, ist entweder deterministisch oder sie ist nicht deterministisch, also indeterministisch. Wenn sie deterministisch ist, dann gibt es zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur eine mögliche Zukunft. Wenn sie nicht deterministisch ist, dann gibt es zu beliebigen Zeitpunkten mehr als eine mögliche Zukunft. Nun sagen manche, dass in einer deterministischen Welt, in der zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Zukunft bereits feststeht, weil es nur eine mögliche Zukunft gibt, keine Freiheit vorkommen kann, weil Freiheit bedeutet, dass man zwischen zwei Möglichkeiten auswählt, mindestens zweien. Und es ist noch nicht entschieden, ...
Inhaltsverzeichnis
- Quantenmechanik