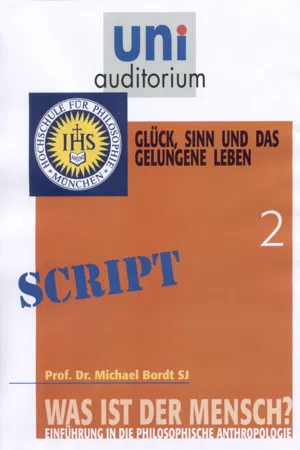
- 13 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Neben anderen Wissenschaften bemüht sich auch die Philosophie darum, den Menschen zu verstehen. Sie fragt, wie wir trotz aller Krisen zufrieden mit unserem Leben sein können. Nicht Gesundheit, Reichtum oder Erfolg sind dabei tatsächlich wichtig.
Auf zwei Dinge komm es an. Erstens, ob wir tiefe persönliche Beziehungen haben, Menschen lieben und geliebt werden. Und zweitens, ob wir etwas tun, das nicht nur für uns selbst sinnvoll, sondern auch für die Gemeinschaft und Schöpfung wertvoll ist.
GLÜCK, SINN UND DAS GELUNGENE LEBEN
Gibt es etwas, das alle Menschen wollen? Das Glück vielleicht? Worum geht es beim Glück? Oder ist es ein sinnvolles Leben, was alle Menschen wollen? Aber was ist der Sinn des Lebens? Eine dritte Antwort ist, dass alle Menschen ein Leben wollen, das ihren Wünschen und Interessen entspricht. Aber wissen die Menschen eigentlich so genau, was sie sich wirklich wünschen? Kennen sie ihre "wahren Interessen"? Wie sieht ein "gelungenes Leben" als letztes Ziel aus?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Was ist der Mensch? Teil 2 von Michael Bordt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Philosophy History & Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
PhilosophyMeine Damen und Herren,
ich habe Ihnen am Ende der ersten Vorlesungseinheit ein zugegebenermaßen sehr rudimentäres Modell des Menschen vorgestellt, mit dem wir aber erst mal ein wenig weiter arbeiten können. Ich habe, Sie erinnern sich, unterschieden zwischen zwei verschiedenen Ebenen.
Einmal der Ebene des gelebten Lebens. Das was passiert. Das was Sie sehen könnten, wenn Sie mich 24 Stunden am Tag begleiten würden, oder wenn ich mit einer Kamera begleitet würde. Aber das ist nicht alles, was das Leben des Menschen ausmacht, hatten wir gesagt.
Viel wichtiger ist die Perspektive, die der Mensch selbst auf sein Leben hat, auf das, was passiert, die Perspektive der ersten Person, das Innere des Menschen. Sie ist wesentlich dadurch bestimmt, wie der Mensch über sich selbst denkt, was er für richtig, für wichtig und was er für falsch hält, was er möchte und wie er sich emotional zu diesen Dingen verhält.
Wir haben gesehen, dass das alles noch etwas komplizierter ist, weil man sich fragen könnte, wie verhalte ich mich emotional zu dem, was ich denke, was in meinem Leben, auf der Ebene des gelebten Lebens, passieren soll. Aber von diesen komplexen Aspekten können wir erst einmal absehen.
Ich möchte jetzt mit Ihnen einen Schritt weiter in das Thema hinein tun. Diese zweite Vorlesungseinheit wird aus drei verschiedenen Untereinheiten bestehen. In einem ersten Punkt möchte ich etwas über teleologische Ordnungen sagen. Das klingt noch etwas fremd und kompliziert, aber es wird gleich deutlich werden, was damit gemeint ist. In einem zweiten Punkt möchte ich dann die Frage stellen, mit was für welchen Begriffen wir eigentlich sinnvollerweise arbeiten sollten, wenn wir das letzte Ziel des Menschen beschreiben wollen. Das letzte Ziel des Menschen ist ein Begriff, der innerhalb der teleologischen Ordnungen sehr wichtig und ein sehr zentraler Begriff sein wird. In einem dritten Punkt möchte ich dann etwas zum Problem der Patchwork Identity oder Bastelbiografie sagen. Dabei geht es um die Frage, wie wir unsere Identität finden können in einem Zeitalter, in dem Rollenverhalten, aber auch Arbeitsplätze zunehmend unsicher werden. Wie diese drei Einheiten miteinander zusammen hängen, das wird hoffentlich durch die Sache selber deutlich werden.
Aber bevor ich zur Teleologie komme, lassen Sie mich damit beginnen, dass ich Ihnen noch etwas deutlicher mache, worauf es mir in der gesamten Vorlesungsreihe eigentlich ankommt. Es kommt mir darauf an, dass ich für einen Begriffsrahmen argumentiere. Das heißt, dafür zu argumentieren, welche Begriffe Sie benutzen sollten, wenn Sie über Ihr eigenes Leben nachdenken. Was für Fragen sollte man eigentlich stellen und wie sollte man die Begriffe bestimmen, wenn wir mit diesen Begriffen arbeiten. Wesentliche Begriffe des Begriffsrahmens, für den ich argumentieren möchte, sind die Begriffe des letzten Ziels, des gelungenen Lebens, der menschlichen Liebe, der Beziehungen, der Arbeit usw. Das wird uns alles noch beschäftigen.
Die Frage, was das Wesen des Menschen ist, was der Mensch der Sache nach ist, ist dabei nicht unterschieden von der Bestimmung eines solchen Begriffsrahmens. Wir Philosophen fragen zwar nach Begriffen, aber damit meinen wir natürlich oft die Sache, auf die es uns ankommt. Wir wollen den Menschen bestimmen. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, was das gelungene Leben des Menschen ausmacht. Aber wir machen das auf die Art und Weise, dass wir uns eben überlegen, in welcher Sprache und wie wir über den Menschen nachdenken und sprechen wollen. Und wie diese Begriffe genau zu bestimmen sind, mit denen wir dann an unser Materialobjekt, dem Menschen und das menschliche Leben herangehen.
Theologische Ordnungen
Ein erster Schritt hinein in den Begriffsrahmen, für den ich argumentieren möchte, sind nun eben die teleologischen Ordnungen oder ist die teleologische Ordnung, in der der Mensch steht. Es ist ja so: Wenn Sie sich das gelebte Menschen anschauen, wenn Sie sich anschauen, was ein Mensch über die 24 Stunden eines Tages so macht, dann lässt sich das in einer zeitliche Reihenfolge, in einer zeitlichen Ordnung beschreiben. Der Mensch tut eine Sache nach der anderen. Er steht in der Frühe auf, er wäscht sich, er kocht sich einen Kaffee, er schaut vielleicht noch ein bisschen Frühstücksfernsehen, dann geht er zur Arbeit, von der Arbeit aus schreibt er einen SMS an einen Freund von ihm, um sich nach der Arbeit mit ihm zu treffen, dann macht er Mittagspause, dann arbeitet er wieder, dann geht er aus dem Büro heraus, trifft sich mit einem Freund, abends daheim angekommen, trinkt er vielleicht noch einen Schluck Wein, dann geht er ins Bett, und so geht es weiter. All das geschieht in einer zeitlichen Reihenfolge. Aber was aus der Perspektive der dritten Person tatsächlich eine zeitliche Reihenfolge ist, sieht aus der Perspektive der ersten Person, aus der eigenen Perspektive dieses Menschen, ganz anders aus. Denn wir tun die Dinge nicht nur hintereinander, sondern wir tun die Dinge um etwas anderes willen, um eines anderen Zieles willen. Und diese Art von Ordnungen, in denen unsere Handlungen stehen, die nennt man eben in der Philosophie teleologische Ordnungen. Dieses Wort kommt vom griechischen Wort telos und telos heißt Ziel. Wir tun Dinge, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wir stehen morgens auf, um zur Arbeit zu fahren, um dort zu arbeiten, um damit Geld zu verdienen. Wir trinken unseren Kaffee, um in der Arbeit fit zu sein. Wir schreiben eine SMS an einen Freund von uns, um uns abends mit ihm zu treffen. Und immer dann, wenn man so umgangssprachlich von „um … zu“ spricht oder „damit“, dann sind teleologische Ordnungen gemeint.
Nun findet es kaum einer einfach toll, morgens früh aufzustehen. Ich selbst gestehe freimütig, dass ich lieber lange im Bett bleibe. Aber natürlich stehe ich auf, um andere Dinge zu erreichen. Sie sehen an diesem Beispiel schon, dass teleologische Ordnungen u. U. in Spannung zueinander stehen können und dass es verschiedene teleologische Ordnungen geben kann, wenn wir unser Leben verstehen wollen. Sie stehen z. B. auf und trinken Kaffee, um im Büro zu arbeiten. Sie schreiben eine SMS, um sich abends mit Ihrem Freund zu treffen. Sie stehen jedoch nicht auf, um eine SMS zu schreiben. Sie fahren nicht zur Arbeit, um dort eine SMS an Ihren Freund zu schicken, sondern Sie schreiben die SMS, um Ihren Freund zu treffen und Sie stehen auf, um zu arbeiten. Wie sich diese verschiedenen teleologischen Ordnungen zueinander verhalten – die eine Ordnung, die darauf ausgerichtet ist, zur Arbeit zu gehen, Geld zu verdienen, eine Tätigkeit auszuführen, die uns vielleicht Spaß oder auch weniger Spaß macht und die andere teleologische Ordnung, die darauf ausgerichtet ist, sich mit Menschen zu treffen und Beziehungen zu leben – wie diese Ordnungen sich zueinander verhalten ist eine im Detail oft schwierige Frage. Lassen Sie mich Sie aber auch noch auf einen anderen Aspekt von teleologischen Ordnungen aufmerksam machen. Uns muss nicht immer bewusst sein, warum wir etwas um etwas anderes willen genau machen. Vieles tun wir vielleicht aus Reflex oder weil wir nicht genau nachdenken und gar nicht genau wissen, warum wir das eigentlich tun. Warum z. B. haben Sie sich dafür entschieden, jetzt diese Vorlesung sich anzuhören? Welche Ziele verfolgen Sie damit? Und wie ist das Ziel, das Sie dadurch erreichen, dass Sie diese Vorlesung jetzt hören, eingebettet in Ihr Leben als Ganzes. Auf solche Fragen Antwort zu geben, ist im Einzelfall oft sehr schwierig und kompliziert. Und das liegt auch daran, dass es schwer ist, uns als Menschen so zu verstehen, dass diese teleologischen Ordnungen, in denen wir Leben, wirklich klar sind. Sie können sich vorstellen, dass wir uns dann ganz verstehen würden, dass wir ein vollständiges Verständnis unseres Lebens und unserer Selbst hätten, wenn uns diese teleologischen Ordnungen ganz bewusst und klar wären.
Leider muss ich das Problem der teleologischen Ordnungen noch ein wenig verkomplizieren. Ich möchte Sie zuerst darauf aufmerksam machen, dass man nicht nur von Zielen sprechen kann – das Wort teleologische Ordnung, so hatten wir ja gesagt, kommt vom griechischen Wort telos, Ziel – sondern auch von Gütern. Und es ist dieser Sprachgebrauch, an dem ich mich im Folgenden im Wesentlichen orientieren werde.
Warum, mag man fragen, sind Ziele Güter. Nun, einfach deswegen, weil all das, was ein Ziel für Sie ist, auch gut für Sie ist. Sie müssen der Auffassung sein, wenn Sie ein Ziel anstreben wollen, dass dieses Ziel unter irgendeiner relevanten Hinsicht gut für Sie ist, und das heißt, dass es ein Gut für Sie ist. Deswegen sind Ziele Güter.
Natürlich können Sie sich irren und etwas für gut halten, was eigentlich gar nicht gut ist. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Bergtour, die Sonne scheint heiß, Sie sind knapp vorm Verdursten und sehen einen Tümpel mit Wasser. Sie stürzen sich darauf und trinken das Wasser, denn Sie denken, das Wasser zu trinken ist gut für Sie, weil Sie nicht verdursten werden. Sie können sich in diesem Urteil jedoch natürlich irren und etwas fälschlicherweise für ein Gut halten, was gar kein Gut ist. Stellen Sie sich vor, der Tümpel ist so verseucht, dass er voll von tödlichen Mikroorganismen ist. Diese führen dazu, dass Sie einen grauenvollen und langsamen, dahinsiechenden Tod erleben. Eine furchtbare Vorstellung. Insofern ist es ziemlich wichtig – und das werden wir in unserer Vorlesung auch noch in einer späteren Einheit tun – uns Gedanken darüber zu machen, was eigentlich Kriterien dafür sind, dass etwas wirklich ein Gut ist und nicht nur scheinbar ein Gut.
Aber diesem Problem müssen wir uns jetzt nicht nähern. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass ich, wenn ich von Gütern rede, nichts anderes damit meine, als das, was ich vorher Ziele genannt habe.
Nun können die Mittel, die wir einsetzen, um ein Ziel zu erreichen in einem unterschiedlichen Verhältnis zu diesem Ziel stehen, das wir anstreben. Z. B. können wir, wenn wir Kopfschmerzen haben, eine Tablette Aspirin nehmen, um die Kopfschmerzen weg zu bekommen. In diesem Fall ist das Aspirin ein Mittel dafür, die Kopfschmerzen weg zu bekommen. Kopfschmerzfrei zu sein ist also in diesem Fall das Ziel, das wir durch das Mittel anstreben. Nun nehme ich einmal an, dass keiner von uns Aspirin so lecker findet, dass er es einfach so trinken will. Aspirin ist ausschließlich ein Mittel, das wir um eines anderen Zieles willen einsetzen.
Anders ist dies jedoch z. B. beim Phänomen der Gesundheit. Zwar brauchen wir die Gesundheit als Voraussetzung, als Mittel, um andere Dinge zu erreichen; z. B. um weg zu fahren, um uns mit Freunden zu treffen, um zu arbeiten, um zu lesen usw. Gleichzeitig würden wir aber nicht sagen, dass die Gesundheit, so wie das Aspirin, ausschließlich ein Mittel ist, um andere Ziele zu erreichen, sondern Gesundheit ist etwas, was auch um seiner selbst willen geschätzt wird. Wenn wir zu wählen hätten, ob wir gesund sein wollen oder krank sein wollen, ist klar, dass wir alle gesund sein wählen würden. Insofern ist die Art und Weise, wie das Mittel mit dem Ziel verbunden ist, bei Gesundheit und den Dingen, die wir tun können, wenn wir gesund sind, eine andere, als die beim Aspirin und dem kopfschmerzfreien Leben.
Davon lässt sich noch eine dritte Mittel-Ziel-Relation unterscheiden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen gelungenen Jahresurlaub erleben und für Sie ist das, was einen gelungenen Jahresurlaub ausmacht, einfach in die Berge zu gehen, zu wandern und so viel wie möglich in der schönen Natur zu sein. Das regeneriert Ihre inneren Kräfte. Nun wäre es komisch zu sagen, dass das Wandern in den Bergen ein Mittel ist, um das Ziel zu erreichen, einen gelungenen Jahresurlaub zu verleben. Natürlich lässt sich unterscheiden zwischen dem Wandern selbst und dem Ziel des gelungenen Jahresurlaubs, aber das Mittel, das Wandern, ist integraler Bestandteil dessen, was es heißt, einen guten Jahresurlaub zu verleben. Das Wandern ist nicht einfach, wie die Gesundheit gegenüber den Dingen, die wir tun wollen, eine Voraussetzung dafür, dass wir einen gelungenen Jahresurlaub verleben, sondern das Wandern ist das, was es heißt, einen guten Jahresurlaub zu verleben.
Nehmen wir noch ein anderes Beispiel: Denken Sie an einen Komponisten, der ein neues Stück komponiert. Natürlich kann es Gründe dafür geben, dass der Komponist ein Stück komponiert, um damit etwas Anderes zu erreichen, z. B. um damit Geld zu verdienen und über die Runden zu kommen. Oder damit er berühmt wird, weitere Aufträge bekommt und endlich mal Stücke für ein großes Sinfonieorchester komponieren kann, was das ist, wovon er immer schon geträumt hat. Aber eigentlich denken wir doch über einen Künstler, einen Komponisten, anders. Er komponiert etwas, weil er in dem Akt des Komponierens etwas tut, was ihn als Person selbst ausmacht und selbst konstituiert. Das Komponieren ist nicht Mittel zum Ziel, auch wenn es auch Mittel zum Ziel sein kann, sondern es ist im Wesentlichen der Ausdruck der Person und dessen, was es für ihn heißt, sein Leben als Mensch zu leben.
Wir haben also drei verschiedene Mittel-Ziel-Relationen voneinander unterschieden. Einmal eine Mittel-Ziel-Relationen, in dem das Mittel nie selbst gewählt werden würde, wenn man das Ziel nicht vor Augen hätte, das Aspirin. Dann, zweitens, das Beispiel der Gesundheit, in dem das Mittel Voraussetzung dafür ist, ein anderes Ziel zu erreichen und drittens die beiden Beispiele des Komponierens und des Wanderurlaubs, wo das Mittel selbst integraler Bestandteil dessen ist, was es heißt, eine bestimmte Art von Leben zu leben.
Eine Frage, die die antike Philosophie schon beschäftigt hat, ist, ob es eigentlich, wenn wir anfangen teleologische Fragen zu stellen, bei diesen teleologischen Fragen irgendwann zu einem Endpunkt kommt. Sie stehen auf, um zur Arbeit zu gehen, Sie arbeiten, um Geld zu verdienen oder auch um einer Tätigkeit nach zu gehen, die für anderen Menschen von Bedeutung ist, die wichtig für Sie ist. Sie verdienen Geld, weil Sie eine Familie ernähren wollen oder weil Sie sich einen bestimmten Lebensstil leisten möchten.
Jetzt können Sie weiter fragen: Warum wollen Sie in einer Familie leben? Warum wollen Sie sich einen bestimmten Lebensstil leisten? Warum wollen Sie einer bestimmten Art von Tätigkeit nachgehen, die Ihnen Spaß macht? Sie sehen, solche Fragen sind schon schwieriger zu beantworten. Nicht immer können wir die Ziele noch mal hinterfragen und fragen: Warum machst Du das? Wir können also nicht immer von neuem die Ziele selbst wieder zu Mitteln machen, die wir anstreben, um anderer Ziele willen, sondern es scheint so, dass die Fragerei irgendwann an ein Ende kommt. Wir stehen auf, um zur Arbeit zu gehen, wir gehen zur Arbeit, um Geld zu verdienen, wir wollen Geld verdienen, um unsere Familie ernähren zu können, wir wollen unsere Familie ernähren können, weil wir in einer Familie leben wollen. Und dann? Warum das?
Es ist die Überzeugung der Philosophen, dass die Warum-Frage irgendwann an ein Ende kommt, wenn wir Sie auf teleologische Ordnungen anwenden, dass wir irgendwann zu so etwas wie einem letzten Ziel oder einem obersten Gut gelangen, das ausdrückt, was wir als Menschen eigentlich wollen, das ausdrückt, was das letzte Ziel oder das oberste Gut unseres Lebens ist. Und im nun folgenden zweiten Teil dieser Vorlesung möchte ich mit Ihnen der Frage nachgehen, wie wir dieses oberste Gut beschreiben können, was wir über dieses letzte Ziel, über das oberste Gut sagen können. Denn wir haben viele mögliche Begriffe, um dieses oberste Gut zu beschreiben. Wir können von einem glücklichen Leben sprechen. Z. B. können wir sagen: In einer Familie zu leben macht uns glücklich. Oder wir können davon sprechen, dass unser Leben sinnvoll sein soll. In einer Familie zu leben, gibt unserem Leben Sinn. Wir können davon sprechen, dass in einer Familie zu leben und Tätigkeiten nach zu gehen, die wir für wichtig halten, dass das etwas ist, was unser gutes Leben ausmacht, oder was unser Leben erfolgreich macht. Wir können vom gelungenen Leben sprechen, wir können vom geglückten Leben sprechen und meine Aufgabe soll es jetzt sein, Sie ein wenig durch diesen Dschungel der verschiedenen Begriffe zu führen.
Das glückliche Leben
Ich möchte dabei so vorgehen, dass ich zunächst etwas zum glücklichen Leben sage. Sollen wir das oberste Gut, das letzte Ziel des Menschen, so bestimmen, dass wir es als das glückliche Leben bestimmen? Oder sollen wir sagen, dass es das sinnvolle Leben des Menschen ist? Das wird der zweite Punkt im Folgenden sein. Sollen wir vom guten Leben – der dritte Kandidat – sprechen oder – und darauf werden meine Ausführungen hinauslaufen – sollen wir das oberste Gut, das letzte Ziel des Menschen als das gelungene Leben bezeichnen?
Zunächst also zum Glück. Wer von uns möchte nicht glücklich werden? Was spricht eigentlich dagegen oder was ist schwierig daran, das oberste Gut, das letzte Ziel des Menschen als das glückliche Leben zu beschreiben? Ich glaube Folgendes: Wenn wir vom glücklichen Leben des Menschen sprechen, dann meinen wir damit meistens zwei verschiedene Dinge. Glück ist so etwas wie eine emotionale Euphorie. In In Zeiten, in denen wir verliebt sind, sind wir glücklich. Glücklich zu sein ist ein Gefühl. Und wie es mit Gefühlen halt so ist, sie kommen und sie gehen und dieses Glücksgefühl der emotionalen Intensität ebbt irgendwann wieder ab.
Aber, so könnte man sofort fragen, ist denn das nicht die Vorstellung von unserem Leben, wie wir es eigentlich leben wollen? Dass wir uns immer in diesem emotionalen High, in diesem Glücksgefühl befinden? Der Philosoph Robert Nozick hat diesbezüglich ein interessantes Gedankenexperiment angestellt. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Jemand hätte eine Maschine erfunden, die Ihr Gehirn mit Elektroden versorgt und Sie ein Glücksgefühl nach dem anderen erleben lässt, immer, unaufhörlich. Ihr emotionales Leben ist also nicht so, dass es Ihnen mal gut geht, dass Sie hin und wieder Glücksgefühle haben und dann es wieder schwierige Phasen in Ihrem Leben gibt, sondern es ist ein Glücksmoment nach dem anderen. Würden Sie sich an diese Maschine anschließen lassen oder nicht? Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen zögern oder zaudern würden, oder sogar sagen: Um Gottes willen, ich würde mich doch nicht an eine Maschine anschließen lassen, selbst wenn sie mir diese Glücksgefühle gibt! Das zeigt, dass in diesem Gefühlszustand zu bleiben, nicht das oberste, das letzte Ziel unseres Lebens sein kann, denn wenn es dieses emotionale High wäre, was wir wollten, dann wäre es ganz merkwürdig, wenn wir nicht sofort die Intuition hätten, uns an diese Maschine anschließen lassen zu wollen.
Oder – etwas ernsthafter – denken Sie z. B. an einen so großen Wissenschaftler wie Siegmund Freud. Wir wissen, dass er vor allem in der zweiten Hälfte seines Lebens unter ganz enormen Schmerzen gelitten hat weil er sehr krank gewesen ist. Doch er hat sich geweigert, schmerzlindernde Mittel einzunehmen, einfach deshalb, weil er sein Leben so erleben wollte, wie es wirklich ist. Auch etwas, was wir überhaupt nicht verstehen könnten, wenn wir der Auffassung wären, das letzte Ziel unseres Lebens sei das emotionale High. Nein, wir wollen schon glücklich werden. Aber wir wollen um der richtigen Dinge willen glücklich werden. Wir wollen Dinge tun, die uns glücklich machen. Wir wollen so etwas wie berechtigterweise das emotionale High haben, glücklich sein.
Vom glücklichen Leben zu sprechen kann auch noch etwas anderes bedeuten und damit komme ich zur zweiten Bedeutung des Wortes Glück. Glück kann so etwas sein wie Schicksal, etwas, das wir passiv entgegen nehmen, was uns passiv widerfährt, an dem wir selber kaum etwas machen können. Wenn z. B. meine Studenten wenig in der Vorlesung waren und die Zeit der Prüfungsvorbereitung auch nur kurz gewesen ist, und dann ausgerechnet das von mir gefragt werden, was sie vorbereitet haben, dann haben sie halt Glück gehabt. Oder wenn Leute alle Sechse im Lotto samt der richtigen Zusatzzahl tippen, dann haben sie Glück gehabt.
Diese beiden Bedeutungen, von Glück als positivem Schicksal, was mir widerfährt und von Glück als positivem, intensivem Gefühlszustand, hängen natürlich eng miteinander zusammen. Denn das positive Schicksal, was mir widerfährt, macht mich glücklich. Aber wir haben ja schon miteinander bedacht, warum es schwierig ist, tatsächlich vom glücklichen Leben als letztem Ziel oder obersten Gut unseres Lebens zu sprechen. Wir können die Gefühlszustände nicht herbeirufen - in weiteres Problem – die uns glücklich machen. Wir können zwar, wenn wir z. B. auf eine schöne Bergwanderung gehen, alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir glücklich werden. Aber wir haben dieses Glück nicht in der Hand. Es kann sein, dass uns trotz einer grandiosen Natur die Sorgen des Alltags viel zu sehr beschäftigen, als dass wir offen sind und die Schönheit der Landschaft in uns hineinlassen können. Wir können das Glück nicht erzwingen.
Wenn ich im Folgenden nicht vom glücklichen Leben sprechen möchte, sondern vom gelungenen Leben des Menschen, dann scheint es mir dennoch wichtig, einen Aspekt des Glücks in den Begriff des gelungenen Lebens zu integrieren, nämlich, das was ich einmal die emotionale Helligkeit nennen möchte, die das Leben hat. Von keinem Menschen, der depressiv, melancholisch, traurig ist, wird man sagen, dass er das oberste Gut, das letzte Ziel seines Lebens leben kann. Wir sind davon überzeugt, dass so etwas wie eine Helligkeit, vielleicht auch eine Freude, die vielleicht augenblicklich nicht an der Oberfläche sein muss, die unser Leben aber dennoch ganz tief prägt, zu dem, wie wir unser Leben leben möchten hinzu gehört. Das sollten wir als Ergebnis festhalten.
Das sinnvolle Leben
Kommen wir zum nächsten Begriff, dem Begriff des sinnvollen Lebens. Ist das letzte Ziel unseres Lebens, das oberste Gut, zu beschreiben, als das sinnvolle Leben? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile eines solchen Begriffsgebrauchs? Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich Sie auf ein ganz merkwürdiges Phänomen hinweise, was der Philosoph Ludwig Wittgenstein herausgearbeitet hat. Er schreibt: „Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. (Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin der Sinn bestand?)“ Wittgenstein weist hier darauf hin, dass zwar viele Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen, wir diese Frage aber nicht verstehen können, wie eine Frage nach einer bestimmten Information.
Wenn eine Ihnen nahe stehende Person Sie fragt, was der Sinn des Lebens ist, dann ist ausgeschlossen, dass diese Person von Ihnen die Antwort erwartet, die Sie geben können und die Person dann sagt: Ah, vielen Dank! Das habe ich bisher noch nicht gewusst, jetzt ist mir diese Sache klar. Nein, wer nach dem Sinn des Lebens fragt, den treiben existentielle Fragen, die er gelöst wissen will. Und existentielle Fragen löst man nicht allein durch die Theorie, sondern existentielle Fragen muss man in der Praxis lösen. So wie Wittgenstein, durch eine Änderung des Lebens. Das Leben wird auf einmal sinnvoll, dann bekommt mein Leben Sinn und daran wird mir vielleicht etwas von dem Sinn des Lebens bewusst. Drei Fragen müssen wir im Folgenden sorgfältig auseinander halten. Die Frage danach, was der Sinn des Lebens ist, die Frage danach, was der Sinn meines Lebens ist und die Frage danach, wann mein Leben sinnvoll ist. Es wäre möglich, dass wir eine Antwort geben können auf die Frage, wann, in wel-chen Perioden, mein Leben sinnvoll ist und vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, was der Sinn meines Lebens ist. Aber damit haben wir noch nicht die Voraussetzungen geschaffen, die es uns erlauben, von dem Sinn des Lebens zu sprechen. Das muss ja ein Sinn sein, der für alle Menschen gilt. Fragen wir also zunächst, wann das Leben sinnvoll ist und was der Sinn meines Lebens sein kann bzw. fragen wir danach, wie wir diese Fragen gut verstehen können. Ich möchte dabei so vorgehen, dass ich zunächst etwas über die...
Inhaltsverzeichnis
- Theologische Ordnungen