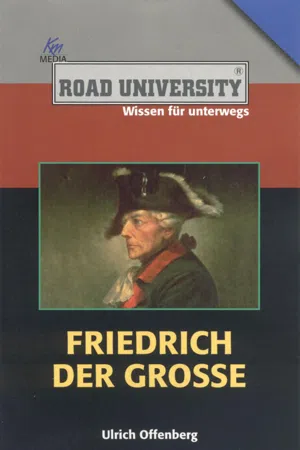
- 112 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Friedrich der Große
Über dieses Buch
Feldherr und Schöngeist, Aufklärer und Zuchtmeister - im Spannungsfeld seiner Persönlichkeit steht "Friedrich der Große" für Preußens Glorie.
Als der junge Mann in Berlin 1740 als "Friedrich II." den Königsthron besteigt, ist das für das barocke Europa eher ein unbedeutendes Randereignis. Der neue Herrscher des bettelarmen Preußens gilt als eine von seinem Vater gebrochene Figur, dem Ränkespiel der Großmächte Österreich, Russland, Frankreich und England hilflos ausgeliefert. Doch dann gelangt in Österreich Maria Theresia an die Macht und Friedrich nutzt seine Chance: Er entreißt der Königin die wertvolle Provinz Schlesien und trotzt ganz Europa in drei blutigen Kriegen. Schon zu Lebzeiten nennen ihn die Zeitgenossen den "Großen", bewundern sein militärisches Genie.
Vom Geiste der Aufklärung beseelt, von Voltaire beeinflusst, schafft er ein unabhängiges Rechtssystem und beendet die Leibeigenschaft. Er war der Architekt eines starken Preußens, der Keimzelle des künftigen Deutschen Reiches. Einsam, krank und verbittert, nur von seinen Windhunden umgeben, vergräbt er sich in seinen letzten Lebensjahren im Lustschlösschen Sanscoussi bei Potsdam und stirbt 1786.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Friedrich der Große von Ulrich Offenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Der 24. Januar 1712 war ein Sonntag, ein schneidend kalter Tag. Die beiden Flüsse, die Havel und die Spree waren zugefroren. Die Stadt Berlin, seit elf Jahren die Hauptstadt des jungen Königreiches Preußen, war aber trotz der bitteren Kälte voller Leben. Die Menschen standen aufgeregt in den Straßen und Plätzen und blickten immer wieder erwartungsvoll auf das düstere Schloss der Hohenzollern. Endlich, gegen Mittag, war es so weit: Die Kanonen feuerten von den Festungswällen 101 Schuss. Damit wurde den Berlinern und allen Preußen kund getan, dass ihrem Königshaus, der Familie Hohenzollern, ein männlicher Thronerbe geboren worden war.
Der junge Vater, der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm, ist schier außer sich vor Freude. In den Jahren zuvor sind zwei Söhne schon bald nach der Geburt gestorben. Diesmal scheint der Knabe gesund und munter zu sein. Friedrich Wilhelm drückt und herzt den Säugling ohne Unterlass. Er hält ihn dicht vors Kaminfeuer, um sein Gesicht besser sehen zu können. Da wird es den Kammerfrauen zu viel, sie entreißen ihm das Bündel, und legen es wieder behutsam in die Arme der erschöpften Mutter, der Kronprinzessin Sophie Dorothea.
Am 31. Januar 1712, um 16 Uhr, findet die Taufe des Kleinen in der königlichen Schlosskapelle statt, alles ganz standesgemäß – bei Kerzenbeleuchtung. Das Baby ist in ein silberdurchwirktes, mit Brillanten besetztes Batistkleid gehüllt, dessen Schärpe sechs Gräfinnen tragen. Der König hat angeordnet, dass der Enkel seinen Vornamen Friedrich bekommen soll, der dem Hohenzollernhause bisher immer so glükkbringend gewesen ist. Und während der Monarch den winzigen Prinzen über das Becken hält, waltet Berlins Bischof Ursinus seines Amtes und tauft den Neugeborenen auf die Vornamen Friedrich Karl.
Damit hat Europa einen neuen Prinzen, der vielleicht eines Tages sogar König werden kann. Ein Staatsereignis für das junge Preußen, und dementsprechend lädt man ganz Europa zur Taufe. Der deutsche Kaiser Karl VI., der in Wien residiert, und Zar Peter I. von Russland, der gerade seine neue Hauptstadt St. Petersburg aus den Sümpfen im Norden des Landes stampft, werden zu Paten des kleinen Hohenzollern ernannt. Doch die beiden Königshäupter haben Besseres zu tun und schicken nur Gesandte mit freundlichen Handschreiben. Zu gering schätzen sie diese preußischen Emporkömmlinge, die zu dieser Zeit lediglich über in ganz Deutschland verteilte Landfetzen gebieten. Kaum mehr als zwei Millionen Seelen zählt der Staat, auch „Streusandbüchse“ des Reiches genannt, und bitterarm ist er noch dazu. Lediglich die protestantischen Generalstaaten der Niederlande erweisen sich als spendable Gäste: Sie verehren dem königlichen Prinzen zwei goldene Becher und eine goldene Kassette mit einem Leibrentenbrief, der auf 4.000 holländische Gulden lautet.
Der kleine Fritz, wie ihn bald alle nennen, entwickelt sich in den nächsten Monaten prächtig. „Er ist recht fett und frisch“, berichtet der glückliche Großvater, „er sauget brav an seiner Amme.“ Am 30. August, der Kleine ist kaum sieben Monate alt, schreibt Friedrich I. in einem Brief nach Hannover, „daß Fritz nunmehr 6 Zähne hat, und dies ohne die geringste Incommodität.“ Als der Großvater am 26. Februar 1713 an Lungenschwindsucht stirbt, lässt er sich den einjährigen Enkel ans Sterbelager bringen und betrachtet ihn lange gerührt, bis der Kleine, krebsrot im Gesicht, zu brüllen beginnt.
Des kleinen Friedrichs Vater, bisher Kronprinz, wird nun König. Er führt den Namen Friedrich Wilhelm I. und hat große Pläne. Während seiner Kronprinzenzeit ist er schon in die Regierungsgeschäfte seines Vaters eingeführt worden. Diese Zeit hat ihn vor allem eines gelehrt: nie mehr Geld auszugeben, als die Einnahmen erlauben. Denn gerade an dieser Einsicht hat es dem ersten König von Preußen zuweilen all zu sehr gemangelt. Kronprinzessin Sophie Dorothea etwa hat oft bangen müssen, ob sie wohl ihre Bezüge vom Hofrentenamt ausbezahlt bekommt. Die königlichen Kassen sind nur allzu oft leer gewesen.
Friedrich Wilhelm I. schafft nun einen grundlegenden Wandel. Seine Sparsamkeit, der neue knappe Zuschnitt der Hofhaltung sowie seine glänzenden organisatorischen Fähigkeiten schaffen den Umschwung. Schon bald wird Preußen geradezu wohlhabend. Das allerdings wird nach außen nicht gezeigt. Aber in den Gewölben der Schlosskeller, in den Magazinen des Schatzamtes, mehren sich die Fässer mit harten Talern, die Friedrichs Vater für schlechte Zeiten anspart.
Der junge Prinz
Die Erziehung des kleinen Friedrich wird sofort nach seiner Geburt einer Gouvernante anvertraut, die das höchste Vertrauen von Friedrichs Eltern genießt: Marthe von Roucoulle, geborene du Val, in erster Ehe einst mit einem Herrn von Montbail verheiratet gewesen. Madame de Roucoulle hat in ihren jungen Jahren schon den König-Vater aufgezogen. Die charaktervolle, milde und gerecht denkende Frau wird Friedrich gleichsam zur zweiten Mutter. Sie lebt bis 1741, wird also sogar noch die Thronbesteigung ihres zweiten Pflegebefohlenen miterleben können…
Marthe von Roucoulle spricht niemals ein Wort Deutsch, sie hat es ihr Leben lang nie gelernt. Von ihr lernt Fritz sprechen, sie liest ihm die ersten Geschichten vor, sie singt mit ihm, immer in ihrer französischen Muttersprache. Jede Freude, jeder kindliche Schmerz, alles wird französisch kommentiert. Das Kind lernt, dass es auf dieser Welt nichts Erstrebenswerteres gibt, als gut französisch zu sprechen. Das Deutsche ist dagegen höchstens im Verkehr mit den Lakaien und Kammerfrauen zu gebrauchen. Der einzige, der mit dem Kinde deutsch spricht, ist der königliche Vater, der immer wieder beteuert, er sei ein „teutscher Fürst“ und die „französischen Firlefanzereien“ taugten nichts.
Am 2. Mai 1717 feuern die Geschütze wieder von den Festungswällen des Berliner Schlosses. Ein weiterer Sohn wird geboren, Wilhelm wird er genannt. Mit den drei Töchtern Wilhelmine, Friederike und der 1716 geborenen Charlotte hat König Friedrich Wilhelm nunmehr drei Töchter und zwei Söhne. Er ist’s zufrieden. Denn nun steht die Thronfolge „auf zwei Augen“, wie er sich ausdrückt. Aber Prinz Wilhelm sollte nur zwei Jahre zu leben haben. Fritz ist wieder der einzige Sohn.
So wächst der kleine Thronprinz mit drei Schwestern auf. Seine drei Jahre ältere Schwester Wilhelmine berichtet in ihren Memoiren, dass der Prinz eine eher finstere Gemütsart hat. Beim Lernen sei er sehr langsam gewesen, habe lange nachgedacht, bevor er eine Antwort gegeben habe, aber dafür sei diese richtig gewesen. Seine Auffassungsgabe scheint beschränkt. Wilhelmine dagegen ist lebhaft und von rascher Auffassungsgabe.
Schon aus diesen Kinderjahren erinnert sich Wilhelmine, dass der Vater den Kronprinzen nicht habe leiden können. Er habe ihn malträtiert, wo immer er seiner habhaft wurde. So habe der Vater dem Kind eine unüberwindliche Furcht eingejagt, die er Zeit seines Lebens nie ablegen konnte.
Die Flöte zu spielen dagegen fällt Fritz leicht, Fritz lernt das spielerisch. Die Faszination des Flötenspiels sollte ihn nie mehr los lassen. Er will vor allem aber auch nicht hinter seiner älteren Schwester zurückstehen, denn Wilhelmine kann sehr hübsch Laute spielen. Gerne musizieren sie auch gemeinsam.
Harte Erziehung
Aber in wie kurze Erholungspausen müssen diese musikalischen Übungen gepresst werden! Das Leben des kleinen Kronprinzen wird von 1718 an in einer Weise reglementiert, wie es heute unvorstellbar erscheint. Der König befindet, es sei jetzt Zeit, die bisherige Gouvernante Frau von Roucoulle durch männliche Erzieher zu ersetzen. Sofort entspinnt sich am Hof im Geheimen ein erbitterter Kampf, wer wohl diesen ehrenvollen und begehrten Posten des Erziehers erhalten solle.
Schließlich setzen sich sowohl die Königin mit ihrem Kandidaten General Finck von Finckenstein als auch der König mit dem Obersten Kalckstein durch. Der König brütet tagelang über einer neuen Fassung jener Instruktionen, die einst schon sein Vater zu seiner eigenen Erziehung aufgestellt hat. Viele Streichungen erfolgen, aber auch einiges mehr wird hinzugefügt. Das liest sich dann so:
„Was die lateinische Sprache anlangt, so soll mein Sohn solche nicht lernen. (…) Ich will auch nicht, daß mir einer davon sprechen soll.(…) Man solle dahin sehen, daß er sowohl im Französischen als Teutschen eine elegante und kurze Schreibart sich angewöhne. Mein Sohn soll anständige Sitten und Gebehrden, wie auch einen guten, manierlichen, aber nicht pedantischen Umgang haben. So hat sowohl der Oberhofmeister als auch der Sousgouverneur darauf mit vor allen Dingen Acht zu haben, daß liederlicher Umgang verhütet werde, widrigenfalls sie Mir beide mit ihren Köpfen dafür haften…“
Der König schreibt seinem kleinen Sohn bis ins Kleinste vor, wann er aufstehen und schlafen, waschen, essen, sich frisieren lassen, singen, beten und arbeiten solle. Der Historiker Lavisse hat aus diesen umfänglichen Vorschriften Auszüge gemacht. Daher wissen wir ganz genau, wie es an Wochenund Sonntagen beim Kronprinzen zuging:
„Wecken um sechs Uhr. Der Prinz darf sich im Bett nicht nochmals umwenden. Er muß hurtig und sogleich aufstehen, alsdann niederknien, sein Morgengebet sprechen, sich dann geschwind ankleiden, Gesicht und Hände waschen, aber nicht mit Seife, seinen Frisiermantel anlegen und sich frisieren lassen, aber ohne Puder. Während des Frisierens soll er Tee und Frühstück einnehmen. Um 6 Uhr 30 tritt der Lehrer und die Dienerschaft ein. Verlesung des großen Gebetes und eines Kapitels aus der Bibel, Gesang eines Kirchenliedes. Von sieben bis halb elf Uhr Unterricht.
Darauf wäscht der Prinz sich geschwinde Gesicht und Hände, nur diese mit Seife, läßt sich pudern, zieht seinen Rock an und geht zum König, bei dem er von elf bis zwei Uhr bleibt. Dann nehmen die Stunden ihren Fortgang bis fünf Uhr. Bis zum Schlafengehen hat der Prinz frei und kann tun, was er will, wenn es nur nicht gegen Gott ist. Die Instruktion schließt mit einer letzten Mahnung, hurtig in die Kleider zu kommen und proper und reinlich zu werden.“
Der König verbietet, Fritz das Gefühl der Furcht vor ihm einzuflößen. Zweifellos soll sein Sohn gehorsam, aber nicht sklavisch sein. Sein Sohn soll Angst vor der Mutter haben, aber nie vor ihm.
Am Sonntag muss der Prinz „erst“ um sieben Uhr aufstehen. Dann aber geht es wieder im Minutentakt. Sobald er die Pantoffeln anhat, muss er vor seinem Bett auf die Knie fallen und laut ein Gebet zu sprechen. Danach muss er sich geschwind waschen, pudern und ankleiden. Für Gebet und Toilette ist nur eine geschlagene Viertelstunde gewährt. Das Frühstück danach ist in sieben Minuten zu schaffen.
Dann treten der Lehrer und die ganze Dienerschaft ein. Gemeinsam knien sie nieder, um das große Gebet zu sprechen, hören dann einen Abschnitt aus der Bibel und singen ein Kirchenlied. Das alles in 23 Minuten. Daraufhin liest der Lehrer das Evangelium des Sonntags vor, legt es kurz aus und lässt den Prinzen den Katechismus aufsagen.
Danach geht es zum König, mit dem er die Kirche besucht und zu Mittag isst. Erst dann hat der Prinz den Rest des Sonntags frei. Um halb zehn Uhr abends sagt er seinem Vater gute Nacht, kehrt in sein Zimmer zurück, kleidet sich sehr geschwind aus, wäscht sich die Hände. Der Lehrer liest ein Gebet und singt ein Kirchenlied, wobei die ganze Dienerschaft wieder zugegen ist. Um halb elf muss der Prinz im Bett liegen.
Fritz bekommt ein Taschengeld von 360 Talern im Jahr, für jeden Tag also einen. Der Vater verlangt im Gegenzug eine korrekte Buchführung von seinem Kind. So, wie er einst seine Dukaten Stück für Stück in ein Buch eingetragen hat, so soll es jetzt auch sein Sohn machen.
Königin Sophie Dorothee missfällt das strenge Regiment ihres Gatten. Sie lässt die Kinder heimlich zu sich kommen, und wenn plötzlich die Sporen des Königs auf dem Gange klirren, werden sie versteckt. Einmal schläft der Vater im Lehnstuhl bei der Königin ein, und stundenlang liegt Wilhelmine im zerquetschten Reifrock platt unter dem niedrigen Bett während der Kronprinz die ganze Zeit über auf der Toilette der Königin hocken muss.
Ehe in der Krise
Die Ehe zwischen Friedrich Wilhelm und der Welfin Sophie Dorothee steht von Anfang an unter keinem guten Stern. In ihren Adern fließt das Blut der Welfen und der Stuarts. Die Welfen galten gemeinhin als hochmütig, die Stuarts als Abenteurer. Wie kann nur diese schwierige Frau an diesen rauen, von Minderwertigkeitskomplexen geplagten, ost-elbischen Prinzen geraten sein? Das ist wohl ein einziges, großes Missverständnis gewesen.
Schon nach ein paar Monaten droht Friedrich Wilhelm mit Scheidung, weil ihm die Gattin zu hochmütig, zu verschwenderisch erscheint. Sie lebt ihr eigenes Leben, macht Schulden am Spieltisch und liebt das Theater. Dinge, die der König aus tiefster Seele verachtet. Schon um sie zu kränken, wird er immer grobschlächtiger zu ihr.
Zum Entsetzen der Königin beschimpft er alle Literaten und Wissenschaftler, isst am liebsten Erbsenbrei und Pökelfleisch und wenn die Gemahlin von Politik sprechen will, verweist er sie auf ihr Nähzeug. Nur kurz, als Sophie Dorothee von ihrer Mutter, der Prinzessin von Ahlden, drei Millionen Taler erbt, flammt seine Liebe für sie noch einmal auf. Aber der Schwager Georg in Hannover rückt das Geld nicht heraus und schon kehrt der König wieder den alten Wüterich heraus.
Der Vater spürt, dass der Sohn ihn verachtet. Bei einem Essen des Kriegsministers von Grumbkow – Fritz ist gerade zwölf Jahre alt geworden – hält er seinem Sohn eine lange Mahnrede. Als er zu sprechen beginnt, gibt er dem Prinzen ein paar Klapse auf die Wangen. Aber je länger er spricht, desto mehr überwältigt ihn die Wut über seinen Erbfolger. Schließlich hageln richtige Ohrfeigen auf den Knaben ein. Nicht genug damit: Plötzlich greift der König nach den Tellern und zerschmettert einen nach dem andern an der Wand. Zum Glück rettet der Kriegsminister die Lage: Er stellt sich betrunken, packt selbst sein Tafelgeschirr und schlägt die kostbaren Fayencen ein Stück nach dem anderen in Trümmer. Leichenblass steht der junge Kronprinz im Kreis der verlegenen Minister und Generäle.
Schwere Jahre
Dabei ist dieser Kronprinz ein ganz anderer Mensch, als sein Vater glaubt. Er ist nicht das Instrument seiner Mutter, ist nicht verweichlicht, nicht weltfremd, nicht faul und er ist vor allem nicht sentimental. Er ist nur vollständig wurzellos. Er kennt keine Bindung an seine Familie. Den Vater verachtet, die Mutter belächelt er. Er hat wenig Wissen, denn sein Schulunterricht ist kurz und schlecht gewesen. Er beherrscht keine Sprache richtig, weder Deutsch noch Französisch. Er hat keinen Glauben, denn viel zu früh hat er die Luft der französischen Aufklärung geschnuppert.
In seiner verzweifelten Lage kann er sich nur durch Verstellung und Berechnung behaupten, durch ein kunstvolles Spiel mit den unterschiedlichen Parteien und Cliquen. In diesem Knaben ist nicht eine Spur von Naivität, Ursprünglichkeit oder Gemüt. Er spielt die Flöte, ein rationales, klares Instrument, nicht die gefühlvolle Geige. Der Vierzehnjährige fängt an, mit den Gesandten Frankreichs und Englands ganz unverfroren über die Frage zu verhandeln, was geschehen solle, wenn der König stirbt. Die Gesandten schreiben an ihre Regierungen, sie können dem Papier nicht anvertrauen, was der Kronprinz ihnen gesagt habe. Rechnet er damit, dass sein Vater wahnsinnig wird? Oder will er ihn stürzen?
Von all dem ahnt der König nichts. Aber er verspürt eine tiefe Abneigung gegen den Knaben. Fritz ist kein richtiger Mann, kein richtiger Soldat, kein richtiger Christ. Instinktlos, wie der preußische Herrscher von Natur aus ist, verlässt er sich ausschließlich auf das Instrumentarium von Befehl und Überwachung. Und dann tut er das Törichtste, was er in dieser Situation tun kann: Er nimmt seinen Sohn Fritz mit nach Dresden, an den berühmt-berüchtigten Hof Augusts des Starken, des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen.
Hier begegnet dem pubertierenden Knaben eine völlig andere Welt. Hier werden andere Feste gefeiert als in der Berliner Provinz: Tausende von Kerzen erleuchten die endlosen Säle, ein Meer von Spiegeln verzehnfacht ihren Glanz. Von allen Galerien pfeifen, trommeln und geigen unermüdliche Musikanten, wohlriechende arabische Hölzer glimmen in kostbaren Urnen, in den Gärten sprühen Kaskaden von fließendem Feuer. Monde und Kometen schimmern über den Bäumen, marmorne Götterbilder glänzen durch das Dunkel, und silbergekleidete Mohren schwingen riesige Fackeln über ihren Häuptern.
Des Prinzen Pubertät
Und vor allem: Frauen über Frauen. Schöne, verführerische, zugängliche Frauen. Sie verwöhnen und berauschen den jungen Königssohn. Er, der zuhause nur verhöhnt und verprügelt wird, darf Flöte vorspielen und die Damen klatschen entzückt Beifall. Er verstreut philosophische Bemerkungen und erntet Bewunderung. Der Kronprinz versinkt in einen Taumel von Sinnlichkeit und Luxus. Wie schön etwa ist die junge Gräfin Orczelska, die des Sachsenkönigs Tochter und zugleich Geliebte ist. Entrüstet durchschreitet Friedrich Wilhelm die taghell erleuchteten Säle.
Eines Abends, als der Polenkönig aus Sachsen mit seinen Besuchern durch die Gemächer wandelt, fällt plötzlich eine Tapetenwand und dahinter, in dem Glanz herrlichster Nacktheit, präsentiert sich die Gräfin Formera, Friedrich Augusts schönste Geliebte. Mit einem Ruck reißt der Preußenkönig den Hut vom Kopf und hält ihn seinem Sohn vors Gesicht.
Aber es ist schon zu spät. Die Formera wird, so berichtet zumindest Wilhelmine, Friedrichs erste Geliebte. Die Schwester behauptet in ihren Erinnerungen sogar, der 16-jährige Kronprinz habe sich aus Dresden eine Geschlechtskrankheit mitgebracht, die von den preußischen Ärzten derart stümperhaft behandelt worden ist, dass der berühmteste Hohenzoller fortan mit Frauen nichts mehr anfangen konnte.
Wörtlich schreibt Wilhelmine: „Seit seiner Rückkehr von Dresden war er in düsterer Melancholie verfallen. Seine Gesundheit wurde dadurch angegriffen, er magerte zusehends ab, wurde häufiger von Schwächezuständen befallen, die befürchten ließen, dass er schwindsüchtig würde. Ich liebte ihn leidenschaftlich und wenn ich ihn nach der Ursache seines Kummers fragte, gab er stets die schlechte Behandlung des Königs an.
Ich suchte ihn zu trösten, so gut ich konnte, doch war alle Mühe vergebens. Sein Übel verschlimmerte sich so sehr, dass man den König benachrichtigen musste. Dieser beauftragte den Generalarzt, ihn zu untersuchen und seine Gesundheit zu überwachen. Über den Bericht, den dieser Mann über den Zustand meines Bruders erstattete, war der König sehr bestürzt; der Kronprinz wäre sehr krank und von einem schleichenden Fieber befallen, das in Schwindsucht ausarten könnte, wenn er sich nicht schonen und in Behandlung begeben würde.
Der König hatte im Grunde ein gutes Herz, obwohl Grumbkow ihm eine große Abneigung gegen den armen Prinzen eingeflößt hatte und trotz der gerechtfertigten Beschwerden, die er gegen ihn zu haben glaubte, überwog jetzt doch die Stimme der Natur. Er machte sich Vorwürfe, den traurigen Zustand des Prinzen durch den Kummer, den er ihm zugefügt, verursacht zu haben. Er sucht das Vergangene gutzumachen, indem er ihn mit Liebesbeweisen überschüttete, doch all dies nutzte nicht, und man war weit entfernt, die Ursache seines Leidens zu erraten.
Endlich entdeckte man, dass es durch nichts anderes als die Liebe entstanden war. Er hatte sich in Dresden ein ausschweifendes Leben angewöhnt, dem er sich hier nicht länger ergeben konnte, weil ihm die Freiheit mangelt. Aber sein Temperament konnte die Entbehrung nicht ertragen. Mehrere Leute setzten in bester Absicht den König davon in Kenntnis und rieten ihm, ihn zu verheiraten, sonst liefe er Gefahr, zu sterben oder Ausschweifungen zu verfallen, die seine Gesundheit zugrunde richten würden.
Hierüber äußerte der König in Gegenwart mehrerer junger Offiziere, dass er hundert Dukaten demjenigen geben würde, der ihm die Nachricht brächte, sein Sohn sei von einem hässlichen Übel behaftet. Den Liebesbeweisen und Wohltaten, die er ihm erwiesen hatte, folgten nun Vorwürfe und Schelte. Graf Finck und Herr von Kalckstein erhielten Befehl, mehr denn je seinen Wandel zu überwachen...“
Königliche Heiratspläne
Diese Krankheit muss dem König wirklich zu schaffen gemacht haben. Seine Besorgnis ist zweifellos echt. Und so hält er es an der Zeit, seinen Sohn zu verheiraten. England schlägt für Friedrich und Wilhelmine eine Doppelhochzeit mit dem englischen Thronfolger und dessen Schwester vor. Leider begeht der englische Brautwerber den Fehler, zugleich gegen den Kaiser zu intrigieren, was Friedrich Wilhelm höchst despektierlich findet. Er packte den Gesandten an der Brust und wirft ihn aus dem Kabinett. Der König misstraute den hochmütigen Engländern zutiefst. Georg II. nennt er wegen der roten englischen Uniform verächtlich „Rotkohl“. Was er sich für seinen Sohn wünscht, ist eine anständige, gehorsame, möglichst dümmliche Prinzessin, die er leicht in die Schranken weisen kann.
Aber dann besinnt er sich doch, will ganz Europa beweisen, welch geschickter Diplomat er sei. Fritz sollt eine englische Prinzessin heiraten, aber nicht bevor er 28 Jahre ist – jetzt ist er gerade 18. In London empfindet man ein Versprechen mit 10-jähriger Laufzeit als höfliche Abweisung: König Georg lehnt die Bedingungen seines Schwagers ab. Friedrichs letzte Hoffnung, der englische Heiratsplan, ist also gescheitert. Jetzt hat er keine Wahl mehr. Soll er, 18-jähriger Prinz des preußischen Königshauses, Oberst der preußischen Armee, sich weiter vor aller Augen misshandeln lassen?
Wie sehr sich die Situation am Hofe zugespitzt hat, beweist dieser Brief Friedrichs an seine königliche Mutter: „Ich bin in größter Verzweiflung. Was ich immer befürchtete, ist mir endlich soeben widerfahren. Der König hat gänzlich verges-sen, dass ich sein Sohn bin, und mich wie den niedrigsten aller Menschen behandelt. Ich trat heute Morgen wie gewöhnlich in sein Zimmer. Kaum hatte er mich erblickt, als er mich am Kragen packte und in der grausamsten Weise mit seinem Stocke auf mich losschlug. Ich suchte vergeblich, mich zu wehren; er war in einem so schrecklichen Zorn, dass er sich nicht mehr beherrschte, und er hielt erst inne, als sein Arm vor Müdigkeit erlahmte. Ich habe zu viel Ehrgefühl, um derartige Behandlun...
Inhaltsverzeichnis
- Geschichts-Daten
- Inhaltsverzeichnis
- Der junge Prinz
- Harte Erziehung