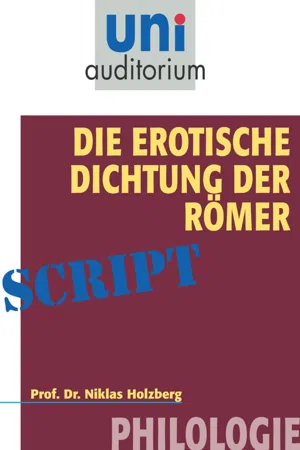
- 16 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
AMOR IN ROMA
Die für das Sexualleben im antiken Rom gültige Ordnung ist dem Liebesgott eher feindlich gesinnt, weshalb die Verfasser erotischer Poesie eine Gegenwelt errichten.
CATULL (UM 55 V. CHR.)
Berühmt ist das Wechselbad seiner Gefühle in den Lesbia-Gedichten ("Ich hasse und liebe"). Als Spott- und Schmähdichter schreckt er vor Obszönitäten nicht zurück.
HORAZ (65 - 8 V. CHR.)
In der Rolle des Liebenden versucht er, Leidenschaft durch epikureische Seelenruhe auszugleichen, oder er spricht in der souveränen Haltung des erotisch Erfahrenen.
DIE ELEGIKER
Properz (2. Hälfte 1. Jh. v. Chr.), Tibull (gest. 18 v. Chr.) und Ovid (43 v. - um 17 n. Chr.) leben ganz für die Liebe, Ovid besonders für die damit verbundenen Freuden.
MARTIAL (40 - 104 N. CHR.)
In seinen Epigrammen verspottet er derb-obszön Abweichungen von der sexuellen Norm, spricht aber auch als Verliebter.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die erotische Dichtung der Römer von Niklas Holzberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Sprachwissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
Sprachwissenschaft
Das Wissen dieser Welt aus den Hörsälen der Universitäten.
Fachbereich
PHILOLOGIE
Die erotische Dichtung der Römer
Von Prof. Dr. Niklas Holzberg
Liebe – eine Bedrohung für den Staat
Es ist keineswegs selbstverständlich, dass das antike Rom überhaupt Liebesdichtung hervorgebracht hat. Diese beeinflusste dann aber die gesamte erotische Poesie des Abendlandes nachhaltig – im Mittelalter wie auch in der Neuzeit.
Der lateinische Name der ewigen Hauptstadt „Roma“ ergibt – rückwärts gelesen - das Wort „Amor“ was sowohl „Liebe“ bedeutet, als auch der Name des römischen Liebesgottes ist.
Roms Senatoren stammten hauptsächlich aus alteingesessenen Patrizierfamilien. Sie sahen in der Liebe und dem Gott „Amor“ eine Bedrohung für die bürgerliche Ordnung, ja sogar für den Staat selbst.
Der gesellschaftliche Nutzen der Ehe
Ein junger, heranwachsender Römer aus der Oberschicht - entweder aus Senatorenstand oder Ritterschaft - sollte nach Meinung der sittenstrengen römischen Väter sein Leben nicht mit der Liebe vertun, sondern zielstrebig an seiner Karriere arbeiten. Als erstrebenswert galten der Ruhm eines Politikers oder Soldaten, das Ansehen eines Juristen, der auf dem „Forum“ seine Reden hält, oder auch der Reichtum eines Kaufmanns.
Das Liebesleben des Hoffnungsträgers wurde durch die Eltern geregelt, die eine Partnerin für ihn aussuchten. Dabei achteten sie darauf, dass die Frau eine möglichst große Mitgift mitbrachte und durch die Verbindung mit ihrer Familie auch politisch und gesellschaftlich nützliche Beziehungen hergestellt wurden. Eine Ehe wurde vor allen Dingen unter solchen Gesichtspunkten geschlossen. Wenn die Verbindung nicht mehr nützlich war, wurde sie auch rasch wieder geschieden. Ein gutes Beispiel für eine Ehe, die aus rein politischen Gründen geschlossen wurde, ist die Verbindung zwischen Caesar’s Tochter Julia und Pompeius, mit dem Caesar zu der Zeit politisch eng verbunden war.
Sex in der Ehe war Mittel zum Zweck. Von der Ehefrau wurde lediglich erwartet, dass sie ihrem Mann möglichst viele Kinder gebar und dass sie sich um den Haushalt kümmerte. Symbolisch dafür war das Spinnen der Wolle – die Frau am Spinnrad. Uns ist ein Grabstein einer Ehefrau überliefert, auf dem steht: lanam fecit – sie produzierte Wolle.
Für Ehebruch der Frau drohte Verbannung
Sex hatte also eine rein praktische Funktion. Der wohl sittenstrengste Römer Marcus Porcius Cato soll - so wird über ihn berichtet - seine Frau nur umarmt haben, wenn es draußen donnerte und blitzte. Was immer in diesem Fall „umarmen“ geheißen haben mag. Wahrscheinlich, damit es niemand von den Nachbarn mitbekam.
Wenn ein Mann Verlangen nach Sex hatte, konnte er dieses außerehelich befriedigen. Eine lockere Verbindung mit einer ehemaligen Sklavin, also einer Freigelassenen, oder auch ein schnelles Vergnügen entweder mit einer Sklavin oder einem Sklavenknaben im Hause. Auch Prostituierte gab es schon zu dieser Zeit.
Wie zu erwarten, hatten Frauen solche Möglichkeiten überhaupt nicht. Im Falle eines außerehelichen Abenteuers drohte ihnen vor einem Schwurgerichtshof angeklagt zu werden. Es erwartete sie eine hohe Strafe wie die Verbannung. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Delinquentin natürlich an einen anderen Ort geschickt wurde, als der Mann mit dem sie Ehebruch begangen hatte. Dieser wurde ebenfalls verbannt. Das alte Rom war eines der wenigen Reiche der Antike, die Ehebruch unter Strafe gestellt haben.
Angesichts dieser Situation liegt es nahe, dass Liebesdichtung eine Ausweichmöglichkeit darstellte und sich eine eigene Welt schuf. Eine Art Subkultur, in der Amor eben doch herrschen durfte und Macht über Roma ausübte. Eine Gegenwelt, wie sie alle uns erhaltenen Gedichte römischer Autoren, die sich mit Erotik auseinandersetzen, aufzeigen.
Ich möchte mich heute nur mit denjenigen Dichtern beschäftigen, die Werke verfasst haben, in denen sie selbst die Rolle des liebenden Mannes spielen. Solche Gedichte können ganze Sammlungen umfassen. Das ist im Wesentlichen der Fall bei den drei Verfassern elegischer Liebesgedichte, Properz, Tibull und Ovid.
Außerdem sind drei Dichter zu nennen, die Gedichtsammlungen hinterlassen haben, in denen mehrere Themen behandelt werden, in denen aber auch die Liebe – erlebt von dem Ich-sagenden der Gedichte – eine wichtige Rolle spielt, das sind Catull, Horaz und Martial.
Die römische Sexualordnung
Besonders die drei Elegiker stellen die Sexualordnung, die im antiken Rom galt, geradezu auf den Kopf. Wie sah diese Sexualordnung aus? Ganz grob skizziert wie folgt:
Der Mann – erfolgreich und mächtig
Wer Mann und wer Frau war, wurde nicht primär nach biologischen Kriterien entschieden. Ein Mann musste ohnehin erst zum Mann werden, vorausgesetzt er war ein freier Römer. Wenn er die erste Bartschur hinter sich hatte - also erwachsen wurde, erwartete man von ihm, dass er – wie vorhin schon erwähnt –eine Karriere als Politiker, Jurist, Soldat oder Kaufmann. In seinem Auftreten sollte er Stärke zeigen und seine Leistungsfähigkeit sowie seien Beherrschtheit unter Beweis stellen. Man kann das alles unter dem Begriff „Machtausübung“ zusammenfassen.
Ein richtiger „Mann“ war also nur: der Aktive, der Machtausübende. Ein Knabe war kein Mann. Und deshalb wurde er – das ist für unser heutiges Verständnis nicht ganz leicht nachzuvollziehen – der Kategorie „weiblich“ zugeordnet.
Frau – schwach und unbeherrscht
„Weiblich“ stand für passiv, für schwach, für weich. Es steht auch – das ist ganz typisch für die Antike – für unbeherrscht.
In diese Kategorie fielen zum Beispiel auch Männer, die nach der Bartschur, wenn sie also erwachsen waren, in einer Sexualbeziehung zwischen Männern den passiven Part übernahmen. Auch ältere und kranke Männer zählten zur Kategorie „unmännlich“ und wurden als „weiblich“ angesehen. Sklaven, gleich welchen Geschlechts fielen ebenfalls unter diese Kategorie. Auch Männer, die Ehebruch begingen. Sie konnten sich nicht beherrschen und Macht über sich ausüben.
Die ganze Gruppe derer, die ich unter der Kategorie „unmännlich = mehr oder weniger weiblich“ zusammengefasst habe - außer den Frauen und Mädchen eben auch diese unmännlichen Männer - war dazu da, penetriert zu werden, während penetrieren nur einem richtigen Mann zustand.
Knabenliebe – ein Teil des Systems
Aus diesem System ergeben sich Konsequenzen, die vom heutigen Standpunkt aus fast paradox wirken.
Knabenliebe war nichts Ungewöhnliches. In Griechenland vollkommen selbstverständlich, war sie in Rom nur dahingehend eingeschränkt, dass es verpönt, ja verboten war, erotische Beziehungen zu Knaben aus der Oberschicht einzugehen. Falls es denn doch einmal geschah und jemand dabei erwischt wurde, kam er mit einer relativ geringen Geldstrafe davon.
Wenn man das mit dem heute heiß diskutierten Thema „Unzucht mit Minderjährigen“ vergleicht, dann ist der Unterschied zur Antike gewaltig. Strafen, wie sie heutzutage Leute verdienterweise bekommen, die Minderjährige verführen, wurden im antiken Rom für Ehebrecher angewandt, die – wie ich vorhin schon sagte – sogar mit der Höchststrafe, der Verbannung rechnen mussten.
Verkehrte Rollen im Liebesgedicht
Soweit das System. Wie sah nun die Gegenwelt aus? Ganz einfach: Der Ich-sagende Liebhaber, also der Dichter, ist bei Licht besehen in seinen erotischen Gedichten kein richtiger Mann, weil er sich nicht aktiv, sondern eher passiv und weich gibt. Die Rolle des Mannes spielt vielmehr dessen Geliebte. Er ordnet sich ihr unter und lässt sich auch allerlei von ihr gefallen.
Er nimmt es hin, dass sie sexuell aktiv ist, was einer Frau in Rom eigentlich nicht zustand, denn sie musste ja passiv sein. Sie betrügt ihn mit anderen Männern, zeigt auch da entsprechende Aktivität. Gelegentlich verlangt sie sogar Geschenke oder Geld von ihm. Das alles nimmt er hin.
Viele dieser Gedichte bestehen einzig aus Klagen darüber, wie unmöglich die Geliebte sich verhält. Sie wird beschworen, sie solle doch ihn allein erhören und mit ihm eine richtige Liebesverbindung eingehen.
Nun ist es so, dass Liebesdichtung im Grunde nur funktionieren kann, wenn der Liebe Hindernisse in den Weg gelegt sind. Man kennt das aus der Komödie. Am Anfang lieben sich zwei. Dann gibt es Tausende von Hindernissen und am Schluss finden die Richtigen dann doch zusammen.
Zyklen aus mehreren Gedichten formen einen Liebesroman
Der Aufbau vieler dieser Gedichtsammlungen ähnelt vor allen Dingen den Werken der Elegiker. Sie bestehen aus mehreren „Büchern“, bzw. Papyrusrollen, die etwa 800 Verse umfassen, das sind zwischen 15, 20, manchmal sogar 30 Gedichte.
Die Gedichte sind innerhalb des Buches und der Sammlung so angeordnet, dass sie fortlaufend gelesen, eine Art Geschichte, einen Liebesroman ergeben. Eigentlich konnte man in der Antike auch nur fortlaufend lesen, weil der Papyrus gerollt wurde und man deshalb Schwierigkeiten gehabt hätte, eine Stelle zu suchen, die man im modernen Buch durch Blättern sofort findet.
Wie war nun die Handlung einer solchen Geschichte?
In den frühen Gedichten erfahren wir davon, wie der Mann seine Geliebte oder den von ihm geliebten Knaben kennen lernt. Erste Werbungsversuche, bald darauf ergibt es sich, dass sich der oder die Geliebte ablehnend verhält. Danach erzählt uns der Liebende von seinen Erfahrungen, von seinen Bemühungen, doch noch irgendwie an sein Objekt der Begierde heranzukommen. Zumeist erfolglos und je nachdem, ob er dazu bereit ist, nimmt er dann Abschied von der Liebe – und der Liebesroman ist zu Ende. Der Verlauf ist also ganz anders als in der Komödie oder in einem richtigen Liebesroman: Kein Friede – Freude – Eierkuchen am Ende, sondern es gibt in der Regel eine Trennung. Kein „Happy End“.
Denselben Aufbau finden wir leicht variiert bei Properz und Ovid. Bei Tibull insofern, als dass er drei einzelne Liebesromane schrieb, während die anderen drei Dichter die Liebesgedichte in den größeren Kontext ihrer anderen Gedichte einbauten. Darin folgen sie insofern vergleichbaren Strukturen, als dass sie die einzelnen Liebesgedichte, die sich zwischen den anderen Gedichten finden, thematisch miteinander verbinden. Man spricht dann von „Zyklen“, die hintereinander gelesen so etwas wie einen Liebesroman ergeben.
Ich möchte nun im Folgenden die sechs Dichter, deren Namen ich bereits genannt habe, chronologisch vorstellen und dabei Beispiele ihrer Gedichte geben.
Gaius Valerius Catullus
Der erste dem ich mich zuwende – neben Ovid vielleicht der beliebteste - ist Gaius Valerius Catullus, den wir in Deutschland einfach Catull nennen. Wann genau er geboren wurde und starb, wissen wir nicht. Er lebte Mitte des 1. Jahrhunderts, vor der Zeitenwende, kam in Verona zur Welt, verbrachte aber wohl die meiste Zeit seines Lebens in Rom.
Um 55 v. Chr. erscheint seine Gedichtsammlung, wahrscheinlich sein einziges Werk. Sie ist uns vollständig überliefert. Da sie aber drei verschiedene Teile aufweist, geht man davon aus – das ist in der Forschung umstritten –, dass er die Gedichtsammlung ursprünglich in drei Bücher einteilte.
Für uns interessant sind die Teile 1 und 3, die wohl die Bücher 1 und 3 waren. Sie enthalten kurze Gedichte, die man als „Epigramme“ bezeichnen kann. Besonders diejenigen des dritten Teils sind im traditionellen Metrum des Epigramms abgefasst. Das „elegische Distichon“, wechselt Hexameter und Pentameter miteinander ab. Ich werde gleich ein Beispiel geben.
Der erste Teil weist verschiedene Metren auf, wobei teils lyrische Metren vorkommen, der sogenannte Elfsilbler, teils aber auch jambische, die an sich Sprechverse sind, mit der Abfolge kurz-lang oder deren Variationen.
In der Tradition der griechischen Spott- und Schmähdichtung
Inhaltlich knüpft Catull an eine literarische Tradition an, die bis ins 7. Jahrhundert v. Chr., in die frühe griechische Literatur, zurückgeht: Die Tradition der Spott- und Schmähdichtung. Catull bezeichnete sich selbst als Spott- und Schmähdichter, als Jambiker. Dieses ist nicht nur metrisch, sondern vor allem inhaltlich zu verstehen.
Wen verspottet, wen schmäht er? Man höre und staune: Personen des öffentlichen Lebens! Nicht ausschließlich, wohl aber einige von ihnen. Offenbar bot die Republik zu seiner Zeit diese Freiheit. So werden Prominente wie Gaius Julius Caesar oder Cicero in seiner Dichtung erwähnt. Es ist die Morgendämmerung zur Epoche der Alleinherrscher.
Zum Teil werden diese Schmähungen durch Gedichte ausgeglichen, die er an Freunde richtet, mit denen er sehr eng in Verbindung stand, ja sogar in Liebe zugetan war, darunter Kollegen, die ähnliche Gedichte verfassten wie er.
Besonders entflammt ist er aber – und dafür ist er berühmt geworden – für eine Frau namens Lesbia. Diesen Gedichten wenden wir uns nun zu.
Catull und Lesbia – Blume und Feldherr
Um wen es sich bei Lesbia handelt, geht aus den Gedichten nicht eindeutig hervor und es wäre auch müßig nachzuforschen, ob diese Frau wirklich existiert hat. Sie ist deutlich in das offizielle römische Gesellschafts-System eingebunden und dan...
Inhaltsverzeichnis
- Liebe – eine Bedrohung für den Staat