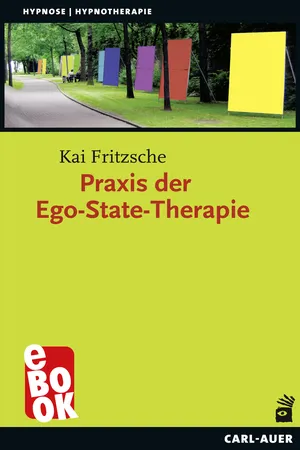![]() Teil II: Praxis der Ego-State-Therapie
Teil II: Praxis der Ego-State-Therapie![]()
8Die Vorbereitung und die Ausrüstung
Will man einen psychotherapeutischen Prozess beschreiben, bieten sich verschiedene Metaphern an. Ich nutze häufig den Vergleich mit einer Expedition. Eine Psychotherapie ist wie eine Expedition. Sie erfordert eine gründliche Vorbereitung, eine angemessene Ausrüstung, eine kompetente Leitung, gute Ortskenntnisse, eine stabile physische Verfassung, Stresstoleranz, möglichst reichhaltige Erfahrungen, eine realistische Selbsteinschätzung, hohes Verantwortungsbewusstsein und eine hohe Motivation. Die Motivation kann beispielsweise aus Neugier und Begeisterungsfähigkeit gespeist sein. Sie kann ungeahnte Kräfte freisetzen und die Überwindung von scheinbar unüberwindbaren Schwierigkeiten ermöglichen. Es gibt vieles zu entdecken. Häufig sind darunter auch unverhoffte und mitunter ungeliebte Dinge, wie die eigenen Grenzen, die Erfahrung, dass es keine einhundertprozentige Kontrolle gibt, die Reaktionen in Gefahrensituationen sowie etwa der Umgang damit, vor dem Gipfel umkehren zu müssen. Zu den Dingen, die es bei einer Expedition zu entdecken gibt, gehört ebenfalls die Wertschätzung der gegenseitigen Unterstützung in einem gut funktionierenden Team.
Ich erinnere mich an eine Reportage über eine Besteigung des Mount Everest. An sich ist dies nichts Besonderes mehr. Um Superlative am Mount Everest vorweisen zu können, muss man heutzutage ziemlich viel bieten, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad aus Stockholm anzureisen, den Berg zu besteigen und auch wieder nach Hause zu radeln. In einer Reportage wurde der Gipfelerfolg des bis dahin jüngsten Menschen auf dem Mount Everest dokumentiert. Jordan Romero erreichte am 22. Mai 2010 im Alter von 13 Jahren mit seinen Eltern den Gipfel. Über die Entwicklungen beim Bergsteigen und das Aufstellen neuer und zum Teil immer fragwürdigerer Rekorde ließe sich viel schreiben.
Für mich war jedoch in der Reportage die Geschichte eines Bergsteigers viel interessanter, der nur eine Nebenrolle spielte und zufällig in der gleichen Zeit wie Jordan Romero am Berg war. Es war ein ehemaliger Elitesoldat aus dem Irak-Krieg. Er hatte im Kriegseinsatz einen spektakulären Hubschrauberabsturz überlebt, bei dem fast alle Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen waren. Der Hubschrauber hatte sich beim Landeanflug auf einen Flugzugträger an den Sicherheitsnetzen verfangen und war daraufhin ins Meer gestürzt. Der ehemalige Elitesoldat wollte mithilfe der Besteigung des Mount Everest dieses Trauma verarbeiten. Er trainierte extrem hart und hatte eine unglaubliche Motivation für sein Projekt. Er erfüllte alle Kriterien für das Bild: ein Mann, ein Berg, ein Ziel. Glücklicherweise gelang ihm auch der Gipfelerfolg.
Zu der Reportage gehörte ein Interview kurz nach seiner Rückkehr ins Basislager. Die Aufnahmen zeigten einen tief beeindruckten Menschen, der gerade dabei war, die Ereignisse der letzten Tage zu verarbeiten. Er wurde natürlich gefragt, ob er denn nun glücklich über den Gipfelerfolg sei. Seine Antwort war sehr interessant. Er sagte, dass er glücklich sei, aber dass er nicht die Erfahrung gemacht habe, die er gesucht habe. Er habe eine für ihn neue Erfahrung gemacht, die ihn noch sichtlich irritierte. Er hatte Mühe, diese Erfahrung für sich zu formulieren. Es ging darum, dass ihm durch den Aufstieg zum Mount Everest und insbesondere in der Todeszone, also in einer Höhe über 8000 m, klar wurde, dass er den Gipfel nur erreichen konnte, indem er die Hilfe seines Sherpas in Anspruch nahm. Ihm wurde klar, dass er den Gipfel ohne fremde Hilfe nicht erreicht hätte. Die fremde Hilfe bestand nicht darin, dass er getragen oder gezogen worden wäre. Aber ohne die Hinweise seines Sherpas, ohne dessen Sorgfalt und ohne dessen Unterstützung wäre er sicher gescheitert. Und sehr stockend, als müsse er diese Sichtweise erst noch richtig realisieren, sprach er weiter davon, dass ihm dort oben klar geworden sei, dass es gar nicht darum gehe, allein und ohne fremde Hilfe auf dem höchsten Berg der Welt zu stehen, sondern darum, die Erfahrung zu machen, in einer Extremsituation auf kompetente und zuverlässige Hilfe rechnen zu können, sozusagen auf bedingungslose Hilfe. Sein Einzelkämpferweltbild schien ins Wanken geraten zu sein, und die Zuschauer wurden Zeugen einer bedeutsamen inneren Veränderung, einer emotional korrigierenden Erfahrung, wie Helen und John Watkins sagen würden. Glücklicherweise wurde er von dem Reporter respektvoll behandelt und nicht weiterinterviewt.
Ich möchte Sie nun bitten, sich die Zeit zu nehmen, einmal die Perspektiven zu wechseln. Stellen Sie sich vor, Sie wären der Sherpa, der den Elitesoldaten auf den Gipfel begleitet. Stellen Sie sich vor, Sie hätten bereits viele Menschen zuvor auf den Gipfel begleitet. Es ist ihr Beruf. Sie kennen den Berg und seine Gefahren. Sie verfügen über langjährige Erfahrungen unter unterschiedlichsten Bedingungen. Sie können auf ein großes Repertoire an Werkzeugen zurückgreifen, die Sie für die Führungen benötigen. Stellen Sie sich vor, Sie würden gefragt werden, was einen erfolgreichen Bergführer ausmacht.
Als wichtigsten Punkt würden Sie ihre Erfahrungswerte anführen. Zu Ihrer Erfahrung gehören ebenfalls Wissen und Intuition. Manche Entscheidungen könnten Sie aufgrund Ihres fundierten Wissens, andere aufgrund ihrer Intuition, Ihres Gespürs für den Berg, das Wetter, die Verfassung der Expeditionsteilnehmer und die gegenwärtige Situation treffen.
Außer von den Erfahrungen würden Sie von verschiedenen Werkzeugen sprechen, zu denen u. a. Ausdauer, Kraft, Klettertechnik, die richtige Ausrüstung, Kenntnisse der kritischen Passagen des Aufstiegs sowie Fertigkeiten im Umgang mit Gefahren gehören. Sie würden darüber sprechen, wie Sie diese Werkzeuge im Expeditionsverlauf einsetzen.
Weiterhin würden Sie darüber sprechen, wie wichtig die Begegnung mit den Gipfelanwärterinnen und Gipfelanwärtern ist. Jeder sei individuell, habe seine eigene Persönlichkeit, würden Sie sagen. Jeder reagiere auf seine eigene Art und brauche eine eigene Form der Unterstützung. Manche würden von fortlaufenden Motivierungen profitieren. Sie würden sie fast permanent anfeuern. Andere würden lieber für sich sein und Sie eher im Hintergrund wissen wollen. Manche würden sich durch Humor aufmuntern lassen, andere brauchten nüchterne, kurze und klare Einschätzungen der Lage.
Als vierten Punkt würden Sie die Fähigkeit, persönlichkeits- und situationsgemäß das richtige Beziehungsangebot und das richtige Werkzeug auszuwählen, anführen. Wer benötigt in welcher Situation welche Form der Unterstützung? Sie würden das Bergführen zusammenfassend vielleicht als eine Herausforderung beschreiben. Die Herausforderung, zu verstehen, wie die Gipfelanwärter am Berg funktionieren, wie Sie als Bergführer die richtigen Angebote daraus ableiten und wie Sie die Expeditionsteilnehmer am besten zum Gipfelerfolg führen können.
Dieses kleine Interview mit Ihnen ließe sich nun ohne großes Umarbeiten auf den Bereich der Psychotherapie übertragen. Als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut könnten Sie die gleichen vier Punkte anführen. Vielleicht würden Sie sie durch weitere Aspekte erweitern. Es besteht hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Doch diese vier Punkte gehören zu einem psychotherapeutischen Prozess. Es geht um unsere Erfahrungen, um die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, es geht darum, wie wir unseren Patientinnen und Patienten begegnen, und es geht um die Fähigkeit, die Herausforderung zu verstehen, vor der unsere Patienten stehen, und entsprechend ihrer Persönlichkeit und der gegenwärtigen therapeutischen Situation das richtige Beziehungs- und Interventionsangebot auszuwählen.
Letztlich verhalf der Sherpa dem Elitesoldaten zu einer neuen menschlichen Erfahrung, die darin bestand, dass es nicht nur auf den Gipfelerfolg, sondern auch auf die besondere Beziehungserfahrung ankommt. Ebenso, wie man sich fragen könnte, was der Sherpa für seine Arbeit mitbringt und was er daraus in der jeweiligen Expedition macht, können wir uns dies für uns als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen fragen:
1. Was sollten wir für unsere Arbeit mitbringen?
2. Was sollten wir in der Begegnung mit unseren Patientinnen realisieren?
3. Welche Schlussfolgerungen sollten wir daraus für die Psychotherapie ziehen?
Die Antworten auf diese drei Fragen könnten ein eigenes Buch füllen. Es ist unmöglich, sie an dieser Stelle erschöpfend zu behandeln. Ich möchte Ihnen gerne einige Anregungen geben und Sie ermuntern, die Fragen für sich zu beantworten, weiterzuverfolgen, zu ergänzen und immer wieder zu aktualisieren.
1) Von den vielen Dingen, die wir für unseren Beruf mitbringen sollten, möchte ich hier zwei hervorheben. Das erste ist das Interesse an Geschichten. Wir hören und erleben täglich die Geschichten unserer Patientinnen. Wir lesen sie in Büchern und Zeitschriften. Wir versuchen, sie zu verstehen, ihnen einen Sinn zu geben, Verläufe und Entwicklungen zu erklären, und wir beginnen, mit den Patientinnen diese Geschichten zu gestalten. Wir arbeiten mit ihnen. Wir greifen sie auf. Wir stellen Bezüge her, bauen Brücken. Wir bewegen uns in den Geschichten und helfen dabei, sie umzuschreiben, neue Kapitel zu konstruieren. Wir unterstützen und begleiten einen kreativen Veränderungsprozess. Dafür ist Interesse an Geschichten extrem hilfreich. Möglicherweise erscheint es anspruchsvoll, dieses Interesse zu behalten, da die Geschichten häufig sehr belastend und erschreckend sind, hilflos machen und uns auch unsere Grenzen verdeutlichen. Wir erleben die Geschichten in einem Beziehungsgeschehen. Wir werden ein Teil der Geschichte. Wir sind mit den impliziten Botschaften, der oft sehr schwierigen Beziehungsgestaltung und unseren Reaktionen darauf konfrontiert. Doch ohne das Interesse an Geschichten kann ich mir die Arbeit nicht vorstellen. Der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, ist die Freude an Begegnung. Vielleicht klingt es selbstverständlich. Immerhin begegnen wir tagtäglich anderen Menschen; nicht nur innerhalb unseres Berufes. Andererseits übt die Art, wie wir unseren Patienten begegnen, einen enormen Einfluss auf die therapeutische Beziehung und den Therapieprozess aus. Zu der Art und Weise, in Beziehung zu unseren Patienten zu gehen, gehören viele Aspekte, wie zum Beispiel die ausführlich beschriebenen und viel untersuchten sogenannten Basisvariablen der therapeutischen Beziehung. Es gehören Fragen der Kongruenz und der Würde dazu. Es geht um Kreativität, um Humor, um die gleiche Augenhöhe und darum, Fehler eingestehen zu können, mit der Begegnung und Beziehungsgestaltung arbeiten zu könn...