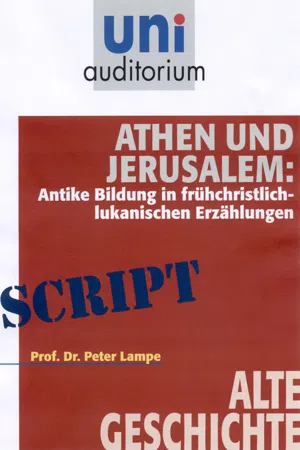
- 14 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Ende des 1. Jahrhunderts: In den frühchristlichen Hausgemeinden fanden sich auch Gebildetere und sozial Arriviertere ein. Denen erzählt Lukas in seinem Evangelium und der Apostelgeschichte die judeo-christliche Tradition neu, indem er zahlreiche Reminiszenzen an hellenistische Bildung einstreut, um besseren Kreisen seiner Zeit den christlichen Glauben attraktiv erscheinen zu lassen. Paulus wird so unterschwellig zum zweiten Sokrates, die Erhöhung des auferstandenen Jesus zur Apotheose.
Jesus und Paulus propagieren Spruchgut, das sich auch bei Thukydides findet, und im urchristlichen Zusammenleben erfüllen sich sozialutopische Träume griechisch-hellenistischer Literaten. Selbst bei der Weihnachtsgeschichte vermögen hellenistische Leser die politisch gefärbte Hirtendichtung der Zeit zu assoziieren. Lässt Lukas die athenische Eule im Kreuz nisten? Und handelt er sich damit Probleme ein?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Athen und Jerusalem von Peter Lampe im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Bildung & Geschichte unterrichten. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
BildungAbstract
Gegen Ende des 1. Jahrhunderts fanden sich auch Gebildetere und sozial Arriviertere in den früh christlichen Hausgemeinden ein. Denen erzählt Lukas in seinem Evangelium und der Apostelgeschichte die judeo-christliche Tradition neu, indem er zahlreiche Reminiszenzen an hellenistische Bildung einstreut, um Gebildeten seiner Zeit den christlichen Glauben attraktiv erscheinen zu lassen.
Paulus erweist sich so unterschwellig als zweiter Sokrates. Die Erhöhung des auferstandenen Jesus wird griechischrömischen Apotheosen nachempfunden. Jesus und Paulus propagieren Spruchgut, das sich auch bei Thukydides findet, und im urchristlichen Zusammenleben erfüllen sich sozialutopische Träume griechisch-hellenistischer Literaten. Selbst bei der Weihnachtsgeschichte vermögen hellenistische Leser die politisch gefärbte Hirtendichtung der Zeit zu assoziieren. Lässt Lukas die athenische Eule im Kreuz nisten? Handelt er sich damit Probleme ein? Büßt er – trotz kritisch-politischer Untertöne in den Himmelfahrts- und Weihnachtsgeschichten – ein Stückweit seiner Kritikfähigkeit gegenüber der ihn umgebenden Kultur ein?
Abschaffen wollen etliche ihn, den Himmelfahrtstag; anstatt eines staubigen Mythos die herausgeputzten Naturwissenschaften an diesem Tag feiern. Was seines Sinnes entleert – und einen Teil der Bevölkerung mit Bierflaschen im Wald seiner Sinne beraubt –, müsse nicht weiter gepflegt werden. Lukas sei eh der einzige Autor im Neuen Testament, der den Himmelfahrtstag kenne.
Ob die Rede von Christi Himmelfahrt heute so sinnentleert ist, werden wir fragen müssen – zu verstehen suchen, was Lukas mit dieser und anderen Vorstellungen im Schilde führte.
Einführung in die historische Situation
Lukas, der Autor eines Doppelwerkes, des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte, schreibt im letzten Quartal des ersten Jahrhunderts irgendwo außerhalb Palästinas in einer Stadt des kaiserzeitlichen Mittelmeerraums, vielleicht im kleinasiatischen Ephesus. Die Christen sehen sich an verschiedenen Stellen des Reiches wiederholt übler Nachrede ausgesetzt.1 Missgünstige Nachbarn tuscheln über allerlei Untaten, gar Mord und Veruntreuen von Geldern, über den schädlichen Aberglauben der Christen, auch über mangelnde Loyalität gegenüber dem Staat. Ihnen geht der monotheistische Absolutheitsanspruch auf die Nerven. Heidnische Mitbürger, daran gewöhnt, sich in verschiedene Mysterien einweihen zu lassen,2 schütteln den Kopf, wenn da Leute auftreten, die behaupten, den „allein wahren“ Glauben zu vertreten, der mit anderen Religionspraktiken nicht zu vereinbaren sei. Der Heide Celsus vergleicht im zweiten Jahrhundert die Christen mit „Fröschen, die um einen Sumpf herum Sitzung halten“ und quaken: „Wir sind es, denen Gott zuerst alles offenbart… Es gibt einen Gott, nach ihm kommen dann wir“!3 Exklusivität und Absolutheitsanspruch ziehen soziale Isolation nach sich. Diese wiederum gebiert Misstrauen, Verdächtigungen. Die Nachbarn reagieren: „Die Christen mögen uns nicht.“ Odium humani generis, Hass auf die Menschen,4 werfen sie ihnen vor – wie den Juden.
Lukas kennt die hasserfüllte Atmosphäre zwischen Christen und heidnischen Nachbarn. In Lukas 6,22-23 zum Beispiel bearbeitet er einen ihm schriftlich vorgegebenen Text. Die Vorlage redete davon, dass Juden einst die Christen gehasst und aus der Synagoge geworfen hätten. Was macht Lukas? Er tauscht jüdische Widersacher verallgemeinernd gegen „die Menschen“ aus und schon heißt es: „Selig, so euch die Menschen hassen.“
Wie begegnen die Christen der Antipathie der Umwelt? Abseits des nervenden Monotheismus, abseits einer gewissen sozialen Zurückgezogenheit – sie machen nicht alles mit, nehmen nicht an paganen Opferfesten teil,5 nicht am Kaiserkult oder zögern, öffentliche Ämter anzunehmen,6 die sie mit heidnischem Kult in Berührung brächten – abseits dieser Charakteristika kann ihnen nichts nachgewiesen werden. Auch Tacitus glaubt nicht, dass die Christen im Jahre 64 die Stadt Rom anzündeten, wie Nero anklagte. 7
Eine erste apologetische Strategie ist die des bürgerlichen Wohlverhaltens. Die christlichen Quellen lukanischer Zeit empfehlen eindringlich, ein moralisch tadelloses Leben an den Tag zu legen, durch bürgerliche Wohlanständigkeit und Loyalität gegenüber dem Staat zu glänzen.8 Jeder Christ möge geregelter Arbeit nachgehen, auf keinen Fall als Müßiggänger ins Gerede kommen.9 Junge Witwen sollen lieber heiraten, um anderen „keinen Anlass zu geben, das Maul sich zu verreißen“.10 Vor allem ein christlicher Amtsträger muss, so heißt es in den Pastoralbriefen, „ein schönes Zeugnis haben vor denen draußen, damit er nicht beschimpft werde“.11 Allen Christen wird geraten, gegenüber Heiden freundlich und ehrerbietig sich zu zeigen.12 Apologie durch die Tat könnten wir dies nennen.
Ein zweiter Weg war, durch Wort und Schrift ein besseres Bild von den Christen zu zeichnen. Lukas begibt sich als erster auf den Weg der literarischen Imagepflege. Im zweiten Jahrhundert werden die sogenannten Apologeten folgen, Justin und andere.
In wiederum zwei Richtungen entfaltet Lukas seine literarische Apologie. Auf einer Linie versucht er zu zeigen, dass das Christentum in der Vergangenheit stets politisch loyal sich verhielt.13 Seine Apostelgeschichte malt das Verhältnis zwischen Christentum und Staat in freundlichen Farben: Der erste bekehrte Heide war ein römischer Armeeangehöriger, ein Offizier (Kapitel 10-11). Seinen ersten missionarischen Erfolg erzielte der Apostel Paulus bei einem römischen Prokonsul (13,4-12). In Athen gesellte sich ein hoher Beamter zu den Bekehrten (17,34). Höchste Würdenträger in Ephesus waren mit Paulus befreundet (19,31). Der „Erste“ der Insel Malta bewirtete ihn freundlich (28,7-10). Name dropping nennen wir auf Neudeutsch, was Lukas mit dem Aufzählen christenfreundlicher Prominenter treibt.
Kam es doch einmal zu Christenprozessen, so verhielt sich die Obrigkeit in seinem Geschichtsgemälde zumeist korrekt bis wohlwollend.14 Der Prozess gegen Paulus tat kund, dass das Christentum nicht den Staat gefährdete, sondern die Herrschenden sogar interessierte.15 Bereits beim Jesus-Prozess kehrt Lukas deutlicher als seine Vorlage Jesu Gegensatz zum Aufrührertum (Lukas 23,25) hervor. Noch deutlicher als seine Quellen unterstreicht Lukas, dass der Römer Pilatus Jesus für politisch unschuldig erklärte – und eigentlich, wenn auch nicht sehr mutig, die Kreuzigung zu verhindern suchte (23,4.14-15.22).
Loyale Bürger sind die Christen! „Ungehindert“, so das letzte Wort in der Apostelgeschichte, nimmt das Evangelium seinen Lauf (28,31). Denn die römischen Behörden, so lässt Lukas sie selbst erklären, sind nicht zuständig in religiösen Fragen.16
Es ist klar, dass Lukas hier ein tendenziöses Idealbild zeichnet. Dass die Wirklichkeit zu Lukas’ eigenen Zeiten sich rauer ausnahm, beobachteten wir bereits.17 So ungetrübt wie Lukas Idealbild könnte das Einvernehmen zwischen Christen und Staat sich gestalten, wenn die Behörden nur wollten und es den „vorbildlichen“ Beamten Festus und Gallio in den Gerichtsverhandlungen gegen Paulus gleichtäten. Der eine wies die Anklage gegen Paulus ab und billigte, dass der Mob den Ankläger verprügelte (Apostelgeschichte 18,14-17). Der andere sprach Paulus quasi frei (siehe die vorige Anmerkung). So könnte es sein: An der Kirche und ihrer Loyalität soll es nicht liegen. Nur an einem Punkt wird Lukas die politische Loyalität der Christen begrenzen. Wir werden in der Himmelfahrts- und der Weihnachtsgeschichte auf diese Grenze stoßen.
Die zweite literarisch-apologetische Spur wird für unser Thema noch wichtiger als die erste sich ausnehmen. Auf dieser zweiten Linie bemüht sich Lukas nach Kräften zu beweisen, dass das Christentum kein ungebildetes Geschwätz sei, wie die Umwelt behauptet.18 Vielmehr sei es auch nach paganen Maßstäben etwas Gebildetes; etwas in der hellenistischen Kulturwelt „Gesellschaftsfähiges,“ ein Kulturgut sogar welt geschichtlicher Bedeutung: Das Christusgeschehen sei mitnichten im „Winkel“ geschehen, behauptet er.19 Diesem zweiten literarisch-apologetischen Strang werden wir nachgehen. Doch zunächst steht zu fragen, wen Lukas mit seiner literarischen Imagepflege erreichen will. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts sitzen auch Gebildetere und sozial Arriviertere in den frühchristlichen Hausgemeinden, unter ihnen jener Theophilus, dem Lukas sein Doppelwerk widmet. An sie richtet sich Lukas – und allenfalls an pagane Sympathisanten aus dem Dunstkreis der Christengemeinden und Synagogen: allesamt Leute, die sich bereits mit dem alttestamentlichen oder christlichen Erbe beschäftigten und nun weite...
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die historische Situation