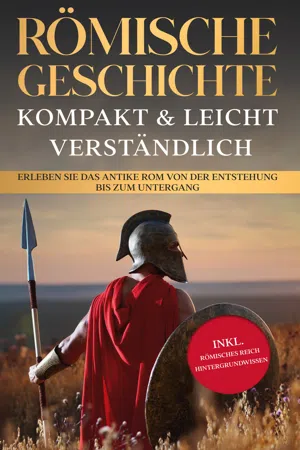![]()
Die Republik
DIE ENTSTEHUNG DER
REPUBLIKANISCHEN VERWALTUNG
Die Phase zwischen dem Ende der Königsherrschaft und der Errichtung der Kaiserherrschaft in Form des Prinzipats wird auf Deutsch als Römische Republik bezeichnet. Das ist die Übersetzung von lat. res publica, was schlicht öffentliche Angelegenheit bedeutet. Öffentlich war für die Römer eine Angelegenheit, wenn sie alle Menschen betraf. Unter Politik verstanden sie also die Regelung von Fragen, die alle betrafen, und in Form der Volksversammlung konnten sich tatsächlich relativ viele Männer daran beteiligen.
Nach der Vertreibung des letzten Königs wurden seine Funktionen auf mehrere Amtsträger verteilt. Über die Frühzeit des republikanischen Systems ist wenig bekannt; erst ab dem 4. Jahrhundert wird das Bild insgesamt klarer. Die Ämterlaufbahn existierte aber wohl nicht von Anfang an in der später bekannten Form.
Zuerst dürfte der Senat entstanden sein. Ursprünglich war er die Versammlung der grundbesitzenden Familien, später bekamen alle Männer in ihm einen lebenslangen Sitz, die einmal ein öffentliches Amt bekleidet hatten. Aus dieser Konzentration der gesamten zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Erfahrung in der Verwaltung speiste sich die Autorität des Senats, die so groß war, dass die Volksversammlung nur in Ausnahmefällen gegen seine Beschlüsse stimmte.
Die Volksversammlung entstand im 5. Jahrhundert aus einer älteren Heeresversammlung und zerfiel in mehrere Unterorganisationen. Die gesamte Volksversammlung wählte die Amtsträger (Magistrate), verabschiedete Gesetze und entschied über Krieg oder Frieden. Alle volljährigen männlichen Bürger durften Magistrate wählen und selbst zur Wahl antreten. Da die Stimmberechtigten aber in Rom anwesend sein mussten, um ihr Wahlrecht wahrnehmen zu können, partizipierte nur ein geringer Teil der Bürger tatsächlich am politischen Leben. Was das passive Wahlrecht angeht, war das Wahlsystem so gestaltet, dass vermögende Bürger bessere Chancen hatten, Magistrate zu werden.
Alle Magistrate waren zunächst nur lose um den Senat gruppiert und hatten noch keine festen Aufgaben. Die klassische Ämterlaufbahn (lat. cursus honorum) bildete sich wohl erst im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. heraus. 367 entstand das Konsulat, das höchste Amt, in seiner bekannten Form. Die umfassenden Befugnisse der Konsuln (im zivilen Bereich potestas genannt, im militärischen imperium) entwickelten sich aber erst später. In der Römischen Republik zählten jene Familien zum Adel (lat. nobilitas), aus denen mindestens ein Konsul hervorgegangen war.
Die übrigen öffentlichen Ämter waren die des Ädils, des Quästors und des Prätors. Die Ädilen waren, kurz gesagt, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig, die Quästoren für die Staatskasse und die Prätoren für die Rechtsprechung. Die Ämter bauten aufeinander auf, d. h., wer Quästor werden wollte, musste bereits Ädil gewesen sein, wer Prätor werden wollte, musste Quästor gewesen sein, und so weiter.
Diese drei Ämter und das Konsulat wurden doppelt besetzt (Prinzip der Kollegialität) und immer nur für ein Jahr vergeben (Prinzip der Annuität), um auf der einen Seite einen Mechanismus zur wechselseitigen Kontrolle zu schaffen und auf der anderen Seite eine königsähnliche Machtkonzentration zu vermeiden. Während die Zahl der Konsuln seit dem Jahr 367 durchgehend bei zwei blieb, wurde die Anzahl der übrigen Magistrate immer wieder erhöht. Zudem konnte einem Einzelnen zusätzlich zu den eigentlichen Amtsträgern für spezielle Aufgaben die Amtsgewalt eines Prätors (Proprätur) oder eines Konsuls (Prokonsulat) verliehen werden.
DIE STÄNDEKÄMPFE
Eine direkte Folge des Endes der Königsherrschaft waren die sogenannten Ständekämpfe zwischen Patriziern und Plebejern. Die Patrizier waren vermutlich die Nachkommen einflussreicher Familien, die schon unter den Königen an den Hebeln der Macht gesessen waren. Als Plebejer wurden in der Frühzeit alle Römer bezeichnet, die weder Patrizier waren noch zu einem Patrizier in einem Klientelverhältnis standen. Später bedeutete Plebejer einfach „Nicht-Patrizier“. Diese Gruppe war sehr groß und sozial heterogen; zu ihr gehörten keineswegs nur Habenichtse, wie es unser heutiger Wortgebrauch suggerieren würde. Zur Zeit der Königsherrschaft hatte wohl der König selbst die Interessen der Plebejer vertreten; durch deren Ende kam ihnen ihr Fürsprecher abhanden, aber die Patrizier gestanden ihnen auch keine andere Vertretung zu.
Über mehrere Jahrhunderte hinweg gelang es den Plebejern, sich politische Vertretung und politisches Mitspracherecht, also die Gleichstellung mit den Patriziern, zu erstreiten. Ihr Erfolg ist nicht zuletzt damit zu erklären, dass die Republik nicht auf sie verzichten konnte. Im Kriegsfall stellten die Patrizier die Kavallerie, die Plebejer die Infanterie. Nur die Kavallerie hätte niemals ausgereicht, um gegen einen Gegner zu bestehen, sodass die Patrizier froh sein mussten, wenn die Plebejer weiterhin zu den Waffen griffen und sich letztlich nicht auf Dauer ihren Forderungen verschließen konnten.
Der erste Erfolg der Plebejer war die Schaffung des Amts des Volkstribunen, die traditionell auf das Jahr 495 datiert wird. Die Tribunen sollten die Interessen der plebs in Volksversammlung und Senat vertreten. Dazu machten die Plebejer sie unantastbar (sakrosankt), d. h., wer immer versucht hätte, einem Volkstribun körperlich zu schaden, hätte damit rechnen müssen, von Plebejern getötet zu werden. Den vollen Umfang ihrer Befugnisse erreichten die Volkstribunen mit dem Veto-Recht; nunmehr mussten sie nur mehr veto (ich widerspreche) sagen, um einen Beschluss in Senat oder Volksversammlung zu stoppen. Wie von den übrigen Magistraten gab es wahrscheinlich ursprünglich zwei Volkstribunen, deren Zahl schrittweise erhöht wurde. Das Amt des Volkstribunen war nicht in die Ämterlaufbahn integriert, bot aber einen guten Ausgangspunkt, um diese erfolgreich einzuschlagen.
367 erreichten die Plebejer, zu allen Ämtern zugelassen zu werden. Seit diesem Jahr gab es zwei Konsuln, weil fortan je ein Patrizier und ein Plebejer in das höchste Amt gewählt werden sollte. 287 wurde das Hortensische Gesetz verabschiedet, mit dem die Beschlüsse der Versammlung der Plebejer für die gesamte Volksversammlung bindend wurden. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts war die Spaltung zwischen Patriziern und Plebejern ausgeräumt.
Die zuvor über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg köchelnden Spannungen waren immer wieder so groß geworden, dass sie die Republik vor eine Zerreißprobe stellten. Dass die Republik diese Zeit nicht nur unbeschadet überstand, sondern sogar gestärkt aus ihr hervorging, dürfte wesentlich mit der parallel erfolgten Expansion zusammenhängen. Solange es äußere Gegner gab, die besiegt werden mussten, gab es ein Ziel, auf das sich Patrizier und Plebejer ungeachtet aller Spannungen verständigen und mit dem sie sich identifizieren konnten. Auch die Kriegsbeute kam allen gleichermaßen zugute, weil beide Gruppen einen Teil des Heeres stellten.
DIE RÖMISCHE EXPANSION
Während der Königsherrschaft und in der Frühzeit der Republik beherrschten die Römer ein vergleichsweise kleines Gebiet in der Umgebung der Stadt. Im 5. Jahrhundert dürften sie noch vorrangig Krieg geführt haben, um sich gegen ihre Nachbarn zu erwehren, die im Normalfall mächtiger und größer waren.
Da sie dabei erfolgreich waren, konnten sie bald territoriale Zugewinne verbuchen, die wiederum ihre militärische Schlagkraft erhöhten. In neu hinzugewonnen Gebieten errichteten die Römer Kolonien, die selbst für ihre Verteidigung sorgen mussten. Mit ihren unterworfenen Nachbarn schlossen sie Bündnisse, die diese dazu verpflichteten, im Kriegsfall Truppen zu stellen. Beides war die Voraussetzung dafür, dass Rom irgendwann begann, Kriege nicht mehr aus politischer Notwendigkeit zu führen, sondern aus Machtstreben. Wann genau dieser Wendepunkt anzusetzen ist, ist umstritten, aber er könnte bereits im 4. Jahrhundert eingetreten sein.
Im 3. Jahrhundert beschleunigte sich dann die Expansion enorm. In der ersten Jahrhunderthälfte erlangte Rom endgültig die Hegemonie über die Apenninen-Halbinsel. Dami...