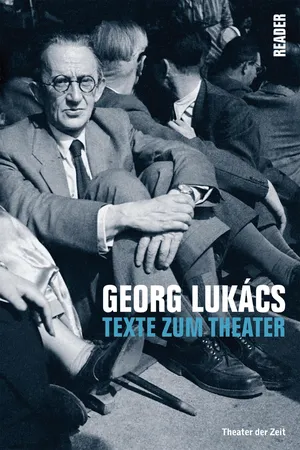![]() THEATERGESCHICHTE
THEATERGESCHICHTE![]()
Erik Zielke
Georg Lukács als Theaterhistoriker
»Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker« – so lautet der Titel eines Buches von Georg Lukács von 1948. Schon der oberflächliche Blick auf diese eher randständige Publikation im umfangreichen Gesamtwerk von Lukács gibt eine Ahnung davon, wie eine Literatur- und damit auch eine Theatergeschichte des ungarischen Philosophen angelegt sein könnte. Dass Marx und Engels als Bezugspunkte auftreten, überrascht kaum. Sie sind die Stützen seiner gesamten Philosophie. Die Geschichte von Literatur und Theater lassen sich genauso wenig von der Gesellschaft, aus der sie hervorgehen, trennen wie irgendeine andere Form der Geschichtsschreibung. Liest man die Kapitelüberschrift »Tragödie und Tragikomödie des Künstlertums im Kapitalismus« aus dem Buch, wird schnell klar, dass Lukács nicht den Versuch unternimmt, die Entwicklung literarischer Strömungen, den Weg von einem Kunstwerk zu einem folgenden oder bloße rezeptionsgeschichtliche Fährten nachzuzeichnen. Er interessiert sich für die Bedingungen, unter denen Dramatik entstehen kann, und er zeigt, wie gesellschaftliche Realität in Literatur ihr Abbild gefunden hat. Nirgends geht es um einen mikroskopischen, rein hermeneutisch-interpretatorischen Ansatz, der auch nicht seinem Horizont entsprechen würde.
Lukács’ Theatergeschichte ist voraussetzungsreich – aber nicht in dem Sinne, dass sie unzugänglich wäre. Zur Voraussetzung hat sie seine Ästhetik. Eine Theatergeschichte ohne eine ihr zugrunde liegende Ästhetik liefe Gefahr, ihren Gegenstand aus dem Fokus zu verlieren. Zum Verständnis der theatergeschichtlichen Einzeldarstellungen hilft des Weiteren die Auseinandersetzung mit Lukács’ Realismusbegriff. Mit seinen Überlegungen zu einem künstlerischen Realismus formuliert er einerseits ein Ideal und verweist andererseits auf die literarischen Traditionslinien, etwa zum bürgerlichen Realismus, die bereits als eigene literaturgeschichtliche Darstellungen gelten können.
Nur als ein Teil innerhalb seines gesamten literaturgeschichtlichen Werks sind Lukács’ theaterhistorische Darlegungen zu verstehen. Damit stehen sie in krassem Gegensatz zu einer zeitgenössischen Theaterwissenschaft, die in ihrem Abgrenzungsdogma zu den Philologien und in ihrer nun schon Jahrzehnte währenden Feier des performative turn vergisst, dass es seit zweieinhalbtausend Jahren die Dramenliteratur ist, die die Grundlage der szenischen Künste in Europa bildet. Lukács schreibt seinen Teil der Theatergeschichte als Geschichte der Literatur des Theaters.
Das Schaffen von Lukács zerfällt recht deutlich in zwei Teile: in sein reifes Werk, das einer Erneuerung des Marxismus verpflichtet ist, und in seine frühen Schriften, die noch in der Tradition des deutschen Idealismus stehen. Hat Lukács sich zwar in aller Deutlichkeit von Letzteren distanziert, sollte man den frühen Aufsatz »Zur Theorie der Literaturgeschichte« von 1910 zur Hand nehmen, wenn man sich Klarheit verschaffen will, was man von einer Theater- und Literaturgeschichtsschreibung aus Lukács’ Feder erwarten kann. Es sind insbesondere zwei Gedanken, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie auch für sein Wirken ab Mitte der 1920er Jahre noch Gültigkeit besitzen.
»Literaturgeschichte hat zu den Erscheinungen und deren Wirkungen (historischen, ökonomischen usw.) – durch die ganze Konstruktion des inneren und äußeren Lebens des Menschen bedingt – dasselbe Verhältnis wie alle anderen Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen. Reine Literaturgeschichte, das ist eine nicht ausführbare, nicht in Praxis umzusetzende Abstraktion«, heißt es in dem Text. Nichts liegt Lukács ferner, als eine Geschichte der Literatur zu verfassen, ohne auch die Gesellschaft zu untersuchen, in der sie entstanden ist.
Weiter ist zu lesen: »Eine nicht gewertete, eine vom Werten unabhängige Literatur existiert nicht, ist unvorstellbar.« Lukács ist kein Chronist, der literarische Werke wie historische Ereignisse niederschreibt. Er setzt sie zueinander in Beziehung, beschreibt ihre Entwicklung und macht sie in ihrem Kontext erst plausibel. Ästhetisches Urteil und Kunstwerk bedingen einander. Die Gesamtschau der Wertungen, das Nebeneinander der literaturhistorischen Einzeldarstellungen erzeugt eine eigentliche Literaturgeschichte. (Philisterhaft ist es, heute in Lukács’ Wertungen Fehler nachweisen zu wollen wie etwa diejenigen, die glauben, Franz Kafka gegen Lukács verteidigen zu müssen, als wäre das nötig.)
Wie nun aber hat Georg Lukács sich den Ruf eines unnachgiebigen Polemikers eingehandelt? Sein ganzes publizistisches Schaffen war kein Selbstzweck, sondern der Autor verfolgte zielsicher bestimmte Wirkungsabsichten. Dass ein beträchtlicher Teil seines Werks auch unabhängig davon und darüber hinaus ein Schlüssel zum Kunstverständnis geworden ist, steht nicht im Widerspruch zu diesem Umstand, sondern ist lediglich ein Kennzeichen gedanklicher Tiefe. Um gewisse argumentative und sprachliche Schärfen und den kämpferischen Charakter einiger Texte zu verstehen, ist der Blick auf ihre Wirkungsabsichten, auf die jeweiligen Kontexte, in denen sie erschienen sind, ergiebig. Deutlich wird das etwa, wenn man die Abhandlungen der Klassiker der deutschen Literatur, die Lukács in den 1930er Jahren abgefasst hat, betrachtet. Diese Texte sind eng mit ihrem zeithistorischen Hintergrund, also dem brutalen deutschen Faschismus, verknüpft. Lukács’ »Faust-Studien« sind die profunde Gegenstimme zur nationalsozialistischen Klassikeraneignung. Sein Aufsatz über Georg Büchner ist eine Korrektur eines zur Unkenntlichkeit verzerrten Bildes des Vormärz-Autors durch die Nazis, die sich – mag es auch absurd erscheinen – selbst dieses widerständigen Geistes annahmen und ihn zu vereinnahmen suchten. Ihm unterläuft allerdings nicht der Fehler einer weitaus primitiver gelagerten sozialistischen Literaturwissenschaft, die noch in den entlegensten Ecken der klassischen Literatur bereits die übernächsten Entwicklungssprünge der Menschheit vorweggenommen sehen wollte. Seine Lektüre ist durch Exaktheit gekennzeichnet und so sieht er in Goethes »Faust. Der Tragödie zweiter Teil« zwar die Widersprüche des Kapitalismus sichtbar gemacht, aber in Goethe doch nicht den Überwinder des Kapitalismus. Er erkennt in Büchner den Stimmengeber der sozial Unterdrückten, ohne sein revolutionäres Pathos als hinreichenden Ersatz für eine umfassende Gesellschaftsanalyse zu nehmen. Lukács trifft damit kein oberlehrerhaftes Negativurteil über diese Werke – im Gegenteil –, aber er verliert den historischen Hintergrund ihrer Entstehung nicht aus den Augen und kann so auch klarsichtig zeigen, wo sie tatsächlich über ihre Zeit hinaus wirken und wo sie die Zukunft in literarischen Ahnungen greifbar machen.
Anders gelagert ist der Fall bei Heinrich von Kleist, mit dem Lukács hart ins Gericht geht. Im Gegensatz zu Goethe und Büchner muss Kleist nicht erst zum Vordenker der Nazis umgedeutet werden, sondern in seinen Texten ist bereits ein starkes reaktionäres Moment angelegt. Lukács benennt klar die Niederschläge des militanten Preußentums in seinem Werk, wobei selbst bei solchen scharfen Abrechnungen der Mut zur Differenzierung nicht verloren geht. Das Talent Kleists wird also genauso wenig geleugnet wie die wenigen herausstechenden Arbeiten, die nicht Zeugnis von der Kleistschen Rückschrittlichkeit geben, sondern sogar mit Einschränkungen einer humanistischen Literatur zuzurechnen sind.
Heiner Müllers oft zitiertes Diktum »Der Text ist klüger als sein Autor« droht, in seiner Allgemeinheit zu einer Banalität zu werden. Lukács besitzt das analytische Handwerkszeug, um genau vorzuführen, wo Texte an der mangelnden Einsicht ihrer Autoren scheitern müssen, wo ein gesellschaftlicher Entwicklungsstand noch eine fortschrittliche Literatur verhindert und wo – welch glücklicher Fall! – kluge Texte entstehen, manchmal der individuellen Konstitution des Autors oder der gesellschaftlichen Verfasstheit zum Trotz. (Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass eine Vielzahl von Theatertexten, unabhängig von ihren Autoren, alles andere als klug ist.)
Lukács’ Konzentration auf das klassische literarische Erbe erfolgt parallel zu einer anderen mit schweren Geschützen ausgefochtenen Auseinandersetzung, ohne die beide publizistischen Komplexe unverständlich bleiben. Unter den antifaschistischen Schriftstellern entbrennt in den 1930er Jahren, vorrangig in der literarischen Exilzeitschrift »Das Wort« ausgetragen, ein Streit um den Expressionismus. Als zentraler Akteur in dieser Debatte ergreift Lukács Partei für eine realistische Literatur und verurteilt die sogenannte Avantgarde. Der sozialistisch-realistischen Literatur, die ihre Wurzeln im bürgerlichen Realismus nicht leugnet, sondern sie zu vervollkommnen sucht, gibt er den Vorzug gegenüber einer subjektivistischen Wortkunst, die auf die Widersprüche der Gegenwart nur mit Formspielen und Nabelschau zu reagieren weiß. In dieser Frage – auch angesichts der Zeitumstände – scheinen Kompromisse nicht möglich und die Debatte wird erbittert geführt. (Schon dieser Umstand zeigt die Bedeutung, die der Kunst – nicht nur von Lukács – beigemessen wurde.) Lukács’ oben angeführte Untersuchungen zu den Vorläufern der realistischen Literatur – Johann Wolfgang von Goethe und Georg Büchner – sind entsprechend auch die Verteidigung einer Traditionslinie, deren Folge in seine Zeit reicht und in die er eine wirkungsvolle antifaschistische Literatur verortet wissen will.
Damit also zum schwierigen Verhältnis zwischen Bertolt Brecht und Georg Lukács. Schwieriges Verhältnis? Es ist vor allem ein komplexes Verhältnis. Befragt man die einschlägigen Referenzen der Brecht-Forschung, wird eine Eindeutigkeit in der Beziehung zwischen dem herausragenden Theoretiker und dem herausragenden Theaterpraktiker des 20. Jahrhunderts behauptet, wofür es keine hinreichende Grundlage gibt. Die Rede geht von Lukács als einem »Gegner seines [d. i. Brechts] Theaters« (Ernst Schumacher) und als Wiederkäuer von »geistig arme[n] Leitlinien«, die »in Moskau produziert wurden« (Stephen Parker). Parker macht in seiner jüngst erschienenen Brecht-Biografie Lukács zu einem blutleeren Prediger des real existierenden sozialistisch-realistischen Romans, was dessen differenzierte Betrachtungen und hohen Ansprüche an die Gegenwartsliteratur seiner Zeit ausblendet, die vor der Kunstproduktion in den sozialistischen Staaten gerade nicht Halt machten, sondern sie im Kern trafen. Von den Einlassungen im Feuilleton ganz zu schweigen, dem Lukács schon mal als »Kunstpapst des Stalinismus« (Hellmuth Karasek) erschien.
Zu einer weniger schematischen Einsicht gelangt Werner Mittenzwei, der sich wohl wie kein anderer mit Brecht und den verschiedenen Realismuskontroversen auseinandergesetzt hat. Aber auch er macht bei Brecht und Lukács zwei gegenläufige Denkentwicklungen aus, die sich allerdings an denselben Problemlagen abarbeiten.
Kurz vor seinem Tod gibt Lukács in seinen unter dem Titel »Gelebtes Denken« veröffentlichten Erinnerungen zu Protokoll: »Ich hielt Brecht damals in Berlin [vor dem Exil, E. Z.] für sektiererisch, und zweifellos besitzen Brechts erste Stücke, seine Lehrstücke, einen sehr starken sektiererischen Charakter. Folglich habe ich der Brechtschen Richtung gegenüber eine gewisse kritische Haltung eingenommen, die sich dann sehr zugespitzt hat.« Es fällt nicht schwer zu glauben, dass Lukács mit dem Lehrstück nichts anzufangen wusste. Ob er die noch unter starkem Einfluss des Expressionismus stehenden Bühnenwerke von »Baal« bis »Im Dickicht der Städte« – also die tatsächlich ersten Stücke Brechts – hier bewusst nicht einmal erwähnt, bleibt offen. Lukács räumt ein, dass die Haltungen der zwei Exilanten während der Expressionismusdebatte in der Sowjetunion in den 1930er Jahren durchaus konträr waren. »Es steht außer Zweifel, dass Brecht eher mit den Expressionisten sympathisiert hat als mit mir«, heißt es bei ihm. Dann fährt Lukács – fast im anekdotischen Plauderton – über eine Moskauer Begegnung mit Brecht fort: In einem Kaffeehaus habe dieser zu verstehen gegeben, dass eine Menge Leute ihn gegen Lukács aufhetzen wollten, und äußerte die Vermutung, dass es sich umgekehrt sicher genauso verhalte. Dem Beschluss, diesen Bestrebungen nicht nachzugeben, habe die Verabredung zu einem Treffen nach Kriegsende und ein freundschaftlicher Abschied gefolgt. Dass dergleichen möglich war, zeigt, auf welchem Niveau Richtungsstreits in der Literatur unter den damaligen Voraussetzungen ausgetragen wurden und dass Vorurteile und Kleingeistigkeit dabei keinen Raum hatten – ein gänzlich anderer Eindruck, als sich aus einigen aus der Rückschau verfassten Dokumentationen ergeben will.
Dass umfassende Darlegungen von Lukács zum Brechtschen Spätwerk fehlen, leistet der noch immer kolportierten schemenhaften Behauptung von einer ewigwährenden Feindschaft Vorschub. Diese Fehlstelle in seinen Beiträgen zu einer Theatergeschichte erklärt Lukács selbstkritisch:
»Aber ich habe mir ein literarisches Versäumnis zuschulden kommen lassen, was darauf zurückzuführen ist, dass mich die ungarischen Angelegenheiten zu stark in Anspruch genommen haben: Nachdem mir die große Bedeutung Brechts letzter Periode klar geworden war, habe ich darüber keinen Artikel geschrieben. Hätte ich das getan, wäre es heute sehr deutlich, welche Meinung ich von dieser Periode Brechts hatte. Tatsache ist, dass ich in jener Zeit bei jedem meiner Berlinbesuche Brecht aufgesucht habe und dass wir oft zusammen waren. Ich teilte ihm meine Meinung mit, wir diskutierten auch darüber. Und man kann sagen, es entwickelte sich zwischen uns ein ausgesprochen gutes Verhältnis, was auch dadurch illustriert wird, dass ich auf Bitten von Brechts Frau zu jenen gehörte, die unmittelbar nach seinem Tod über ihn in Berlin gesprochen haben.«
An dieser Stelle wird – wie auch andernorts – ein versöhnlicher Lukács hörbar, dem offensichtlich an der Feststellung gelegen ist, dass sein Verhältnis zu dem großen Theaterneuerer Brecht keineswegs von Verachtung gezeichnet war. Unangemessen wäre es sicher, die Trennlinie zwischen den entschiedenen Positionen in der Expressionismusdebatte – die auch bei erneuter Lektüre drängende Fragen an die Künste der Gegenwart aufwerfen – einfach zu verwischen. Auch Lukács’ späte Klassifizierung Brechts als großer Aristoteliker gehört schon fast in den Bereich der Verklärung. Dabei wäre es vor allem wichtig, die tatsächlichen Gemeinsamkeiten im Denken beider hervorzuheben: Das reale Potenzial der Kunst muss erkannt und genutzt werden sowie mit ihren Mitteln gesellschaftliche Realität offengelegt werden.
In einem Würdigungstext für Hanns Eisler schreibt Lukács mit Blick auf die Moskauer Zeit von falscher Gegnerschaft und falschen Fronten, was kein Abrücken von zuvor eingenommenen Positionen bedeutet. Vielmehr ergibt sich dieses Bild aus der verspäteten Erkenntnis, dass er sowie Eisler und Brecht »den Tunnel von zwei Seiten anbohren und unweigerlich uns in der Mitte treffen würden«. Wer ein aufrichtiges Interesse an der Theatergeschichtsschreibung des 20. Jahrhundert hat, darf den Blick in den Tunnel nicht scheuen. Hier warten die Impulse – weit über eine bloß akademische Beschäftigung hinausgehend – für eine relevante Theaterkunst der Zukunft.
![]() Georg Lukács
Georg Lukács![]()
Faust-Studien
Puschkin nennt den »Faust« eine Ilias des modernen Lebens. Das ist ausgezeichnet gesagt, es bedarf zur richtigen Konkretisierung nur der Unterstreichung des Wortes »modern«. Denn im Leben der Gegenwart ist es nicht mehr wie in der Antike möglich, alle Bestimmungen des Gedankens und der dichterischen Gestaltung unmittelbar vom Menschen aus zu entwickeln. Gedankliche Tiefe, Totalität der gesellschaftlich-menschlichen Kategorien und künstlerische Vollkommenheit sind hier nicht mit naiver Selbstverständlichkeit vereinigt, sie ringen vielmehr heftig miteinander. Aus der Goetheschen Vereinigung dieser widerstrebenden Tendenzen ist ein im wahrsten Sinne des Wortes einzigartiges Gebilde entstanden. Goethe selbst nennt es eine »inkommensurable Produktion«.
Gestaltet wird das Schicksal eines Menschen, und doch ist der Inhalt des Gedichts das Geschick der ganzen Menschheit. Die wichtigsten philosophischen Probleme einer großen Übergangsepoche werden vor uns gestellt, aber nicht bloß gedanklich, sondern unzertrennbar vereinigt mit sinnlich packenden (oder zumindest leuchtend dekorativen) Gestaltungen letzter menschlicher Beziehungen. Diese Beziehungen werden nun in steigendem Maß problematisch. Eine ungebrochene sinnlich-geistige Einheit kann nur im ersten Teil vorwalten. Gedankengehalt, Aufdeckung gesellschaftlich-geschichtlicher und naturphilosophischer Zusammenhänge belasten, ja sprengen immer stärker die sinnliche Einheit der Formen und der Gestalten. Das ist der allgemeine Prozess der Entwicklung der Literatur im 19. Jahrhundert, der die Geschlossenheit und Schönheit der Formenwelt zerstört, sie der Unerbittlichkeit des neuen großen Realismus opfert und damit das »Ende der Kunstperiode« herbeiführt.
Es ist kein Zufall, dass die Vollendung des zweiten Teils des »Faust« fast gleichzeitig mit dem Erscheinen von Balzacs »Das Chagrinleder« e...