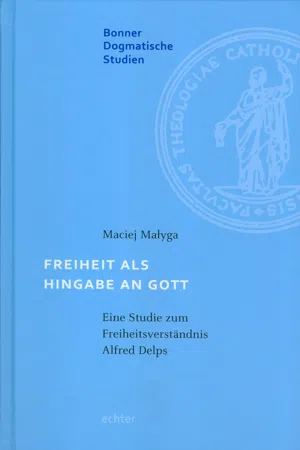![]() II. Delps Kritik am Freiheitsverständnis der Moderne
II. Delps Kritik am Freiheitsverständnis der Moderne![]()
A. Der Bezugspunkt von Delps Kritik – Martin Heideggers Sein und Zeit
1. „Sein und Zeit“ an sich vor den Fragen Delps
Der tief in der theologischen Tradition verwurzelte Delp denkt die Freiheit im Anschluss an die Gegenwart und gestaltet ihr Verständnis vor allem in der Auseinandersetzung mit Heideggers Sein und Zeit, das er kritisch zu rezipieren versucht.1 Aus diesem Grund ist es für ein angemessenes Begreifen von Delps Vision notwendig, zuerst einen Blick auf den Inhalt des Werkes des Freiburger Philosophen zu werfen. Es handelt sich dabei jedoch um eine Lektüre von Sein und Zeit allein aus sich selbst heraus, d.h. ohne den ständigen Blick auf die Delp’sche Kritik an ihm, wohl aber vor dem Hintergrund der durch Tragische Existenz gestellten Fragen. In seiner Schrift zielt Delp auf das ganze Unternehmen Heideggers, das die Frage nach dem Sein überhaupt thematisiert. Das uns interessierende Problem der Freiheit kommt in der Auseinandersetzung zwar zur Sprache, bleibt aber eher zweitrangig.2 Vielmehr kritisiert Delp unter Bezugnahme auf das Denken Heideggers einige Prämissen des Freiheitsverständnisses der Moderne; er beabsichtigt dabei weniger eine Auseinandersetzung mit dem Freiheitsverständnis des Freiburger Philosophen. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit einer präzisen Reformulierung von Delps Fragen an die Heideggersche Philosophie.
Mit Delp kann man in Sein und Zeit die Grundlage eines modernen Freiheitsverständnisses entdecken und unter diesem Blickwinkel wollen wir jetzt das Werk Heideggers lesen – und damit Delps Deutung nachvollziehen. Die Auseinandersetzung mit Sein und Zeit wird darum unter drei Fragen geführt, die, so Delp, den Prämissen des Freiheitsverständnisses, das heißt dem Menschenbild, der Gottesfrage sowie dem Autonomiebegriff entsprechen:
1.) Entwickelt Sein und Zeit eine bestimmte Anthropologie?
2.) Welchen Platz hat der Gottesbegriff in Sein und Zeit?
3.) Was bedeutet der Heidegger’sche Begriff der Entschlossenheit?
Das Ergebnis lässt uns den Grund von Delps Kritik am modernen Freiheitsverständnis und infolgedessen auch den Grund seines Versuchs, ein eigenes Freiheitsdenken zu konzipieren, verstehen.
Die Problematik der Delp’schen Auseinandersetzung mit Sein und Zeit ist kompliziert. Man muss Delp mindestens zugestehen, dass er sich auf das von Heidegger Verfasste im aufrichtigen Suche nach einem Verstehen bezieht. Um seine Kritik selbst wiederum richtig zu verstehen, gilt es aber zu berücksichtigen, dass Delp dieses Werk auf der Grundlage einer bestimmten Hermeneutik liest: Er sieht darin das Selbstverständnis des Menschen seiner Zeit denkerisch zum Ausdruck gebracht, so dass sich seine Kritik an Sein und Zeit im Wesentlichen auch als kritische Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist verstehen lässt. Um der Sache gerecht zu werden, müssen wir deshalb nach der Lektüre von Sein und Zeit in einem nächsten Schritt die geistesgeschichtliche Situation in Deutschland in den Jahren 1931-1935 betrachten. Es handelt sich dabei um das, was Delp als Mensch der Epoche wahrnimmt, was ihn in seiner Auseinandersetzung lenkt oder abstößt, was er einbezieht und wogegen er sich wendet. Erst dadurch gewinnen wir einen Blick auf die Grundlagen von Delps Freiheitsverständnis.
Die Schwierigkeiten, auf die Delp stößt, die jene gerade angeklungenen Komplikationen seiner Auseinandersetzung ausmachen, gründen darin, dass das Werk Heideggers fragmentarisch bleibt. Einerseits verlangt es einen zweiten Teil, andererseits distanziert sich der spätere Heidegger selbst von seinem Werk. Der Philosoph gibt zu, er habe sich an Sein und Zeit vielleicht „zu früh“ gewagt3 und es
wäre … gut, man ließe endlich Sein und Zeit, das Buch und die Sache, für eine unbestimmte Zukunft auf sich beruhen4.
Die Frage der letzten Seite von Sein und Zeit: „Hierzu allein ist die vorliegende Untersuchung unterwegs. Wo steht sie?“5 wird von Delp aufgenommen und kritisch beantwortet. Bald nach der Veröffentlichung von Sein und Zeit bezeichnet Heidegger seinen Denkweg als einen „Holzweg“, „der [ihn] irgendwohin führte, dieser Weg [ist] aber jetzt nicht mehr begangen u. schon verwachsen“6. Er zieht sich langsam von den Begriffen der Fundamentalontologie des Daseins, der Entschlossenheit und der Welt zurück, so dass man seinen Anspruch, seine späteren Deutungen hätten gleichermaßen dem Anliegen von Sein und Zeit entsprochen, als unhaltbar ansehen muss.7
Dieser Umstand der durchaus selbstkritischen Entwicklung der Heidegger’schen Gedanken ist für die Beurteilung der Auseinandersetzung Delps mit dem Werk durchaus relevant, doch muss zunächst beachtet werden, dass wir uns ausschließlich auf die für den Jesuiten zugänglichen Quellen beschränken. In Anbetracht des Problems, dass Sein und Zeit an sich kein Werk ist, das von sich aus über sich selbst ganz sprechen kann, dass es kein fertiges System, sondern ein Denken „unterwegs“ ist, ergibt sich für Delp die Notwendigkeit, ein Interpretament zu finden, mit dessen Hilfe das relevante Nicht-zu-Ende-Gesagte des Buches durchleuchtet werden kann. Während das Werk den heutigen Lesern in den schon veröffentlichten Vorlesungen und weiteren Aussagen sowie Auslegungen Heideggers zugänglich ist, verfügte Delp nur über wenige weitere Möglichkeiten zur Erschließung des Inhalts von Sein und Zeit, nämlich die öffentliche Tätigkeit Heideggers in den Jahren 1931-1935 einerseits und die faktische Wirkung seines Denkens in der Gesellschaft andererseits. Die aus diesen „Quellen“ resultierende Hermeneutik Delps ist zum einen nachteilig, insofern sie dem ureigenen Anliegen Heideggers nicht ganz gerecht werden kann; zum anderen aber spiegelt sie in ihrer Nähe eine „faktischere“ Auseinandersetzung mit dem Zuerst-Gesagten (Sein und Zeit) ziemlich unmittelbar wider, was übrigens das Interessante am Delp’schen Denken ausmacht.
a) Die Ontologie aus der Perspektive der Daseinsanalytik
Die von Delp geübte Kritik an Sein und Zeit und auch die Beurteilung seines eigenen Werkes Tragische Existenz durch spätere katholische Denker hängen davon ab, inwiefern der Interpret Sein und Zeit anthropologische Züge zuspricht – oder auch nicht. Ist das Werk Heideggers „bloß“ eine Ontologie oder durchbricht es (auch) diese Grenze und entwickelt gleichermaßen eine Anthropologie? Diese Frage ist für das gesamte Werk sowohl Heideggers als auch Delps entscheidend, denn nicht nur seine Gottesfrage sondern auch der Begriff der Entschlossenheit müssen je nach der Antwort auf diese Frage anders und neu verstanden werden.
Dass Heidegger in Sein und Zeit nicht auf die Erklärung eines Menschenbildes hin abzielt, sondern zunächst eine Ontologie entwickeln will, formuliert er eindeutig schon auf den ersten Seiten des Werkes. Die Aufgabe seines Denkens bestehe darin, so Heidegger, die vergessene Frage nach dem Sein überhaupt wieder zu stellen.8 Insofern ist der Anspruch auf eine Anthropologie nicht vorhanden. Doch den Zugang zum Sein findet der Philosoph nur dann, wenn er den Menschen, also das Dasein befragt, weil das menschliche Dasein das einzige Seiende sei, dem es „in seinem Sein um dieses Sein selbst geht“, das also „zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat“9. Heidegger betrachtet das Sein aus der Perspektive des Daseins und mithilfe der Daseinsanalytik will er die Seinsfrage beantworten: „Daher muß die Fundamentalontologie, aus der alle anderen [Ontologien] erst entspringen können, in der existenzialen Analytik des Daseins gesucht werden.“10
Mit dieser Methode ist es nun notwendig, eine klare Distinktion zu bewahren, worauf Heidegger selbst immer wieder aufmerksam macht:
Die Herausstellung der Seinsverfassung des Daseins bleibt aber gleichwohl nur ein Weg. Das Ziel ist die Ausarbeitung der Seinsfrage überhaupt.11
Die Frage nach dem Sein überhaupt, obwohl nur aus der Analyse des Daseins zu erreichen, geht jedem Fragen nach dem Seienden – mithin auch nach dem Menschen – voraus: „Die existenziale Analytik des Dasein liegt vor jeder Psychologie, Anthropologie und erst recht Biologie.“12 Das Sein ist ein Gefragtes, das Seiende des Daseins ein Befragtes,...