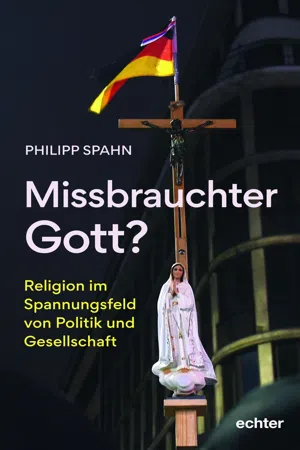![]()
III. Kirche
Am 16. Januar 2019 druckte die FAZ unter der Rubrik ‚Wichtiges in Kürze‘ folgende Meldung: „Kirche will Tempo 130“. Was ironisch anmutet, ist bitterer Ernst. „Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland strebt ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen an.“ Es ist schwer zu sagen, was die Verantwortlichen dabei geritten hat. Der Landeskirchenrat begründete seine Entscheidung, eine entsprechende Petition auf den Weg zu bringen, „mit der möglichen Einsparung von zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich, weniger Unfallopfern, Stau und Reifenabrieb“. Einen draufgesetzt hat nur noch die Landesbischöfin Ilse Junkermann, die darin ein „Bekenntnis zur Schöpfung“ sehen will. Halleluja!
Bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland muss etwas ganz gehörig in Schieflage geraten sein, anders ist die spirituelle Überhöhung konkreter politischer Forderungen, die mit dem christlichen Glauben wenig bis nichts zu tun haben, nicht zu verstehen. Davon abgesehen hat der Beschluss mit seiner tragischen Komik aber auch etwas Gutes: Die komplexe Frage, ob beziehungsweise unter welchen Umständen und in welcher Art und Weise kirchliche Entscheidungsträger in die Tagespolitik eingreifen dürfen, tritt überaus deutlich zutage. Es handelt sich dabei um eine der Kernfragen christlicher Existenz, die in der Geschichte der Kirche fortwährend virulent war und ist. Eine eindeutige und einfache Antwort gibt es nicht und kann es nicht geben.
Das Christentum: Eine Botschaft für die Welt
Zumindest dass die christliche Botschaft nicht nur für den privaten oder binnenkirchlichen Gebrauch gedacht ist, scheint einigermaßen eindeutig zu sein. Jesus forderte seine Jünger auf, „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ (Mt 5,13.14) zu sein. Das Christentum genügt sich nicht selbst, die Kirche hat eine Sendung. Dennoch erwehrte sich Jesus zeitlebens aller politischen Vereinnahmung. Ein König zu sein, das bestritt er zwar nicht, nur dass sein „Reich von dieser Welt“ sei (Joh 18,36.37), wies er zurück. Deshalb ist auch dem „Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Mt 22,21). Die Evangelien, sie zeichnen ein widersprüchliches Bild von der politischen Dimension des Christentums.
Hinzu kommt der berühmte Vers der praktischen Ethik, den wahrscheinlich jedes Kind kennt, weil Eltern ihn zankenden Geschwistern oder Spielkameraden oft einbläuen. „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Dieser Spruch ist nicht nur in Kinderstuben weit verbreitet, sondern ebenfalls in antiken und neuzeitlichen Philosophien, darüber hinaus in nahezu allen Religionen aus Nah- und Fernost. Hinduisten und Buddhisten, Juden und Muslime, auch viele kleine Religionsgemeinschaften zählen diese Weisheit zum Kernbestand ihrer Ethik. Im Buch Tobit (4,15) des Alten Testaments lautet das Gebot: „Was du hasst, das tu niemand anderem an.“
Im Christentum ist dieser Vers als Goldene Regel bekannt, die Jesus seinen Jüngern auftrug: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen.“ Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Formulierung von der im Alten Testament nur unwesentlich. Erst beim zweiten Hinsehen wird deutlich, wie anders Jesu Wort ist. Die Formulierung im Alten Testament und im Kinderspruch, die ein Unterlassen fordert, findet im Neuen Testament – und nur dort – ihr Pendant, das zu aktivem Tun auffordert. Das heißt, dass es für Christen nicht ausreichend ist, das, was ein anderer nicht will, zu unterlassen. Vielmehr ist es geboten, aktiv zu werden. Diese Form der Regel im Christentum unterscheidet sich von den Formen anderer Religionen also deutlich. Eine heile christliche Sonntagswelt zu pflegen ist eben nicht ausreichend. Die Diakonia, der Dienst am Nächsten, ist einer der vier Grundvollzüge der katholischen Kirche. Steckten Christen die Hände in die Taschen, versicherten sich gegenseitig ihres rechten Glaubens und ließen die Welt um sich herum im Chaos versinken, dann missachteten sie die Goldene Regel.
So kommt es, dass Christen in unterschiedlicher Weise gesellschaftlich und politisch aktiv sind. Zwar verbietet das Kirchenrecht Klerikern der katholischen Kirche, politische Ämter auszuüben. Besonders eindrücklich ist das Beispiel Fernando Lugos aus Paraguay. Als Bischof lenkte er von 1994 bis 2005 die Geschicke der Diözese San Pedro, bevor er zwecks eines politischen Amtes darum bat, aus dem Klerikerstand entlassen zu werden. Von 2008 bis 2012 bekleidete er dann das Amt des paraguayischen Staatspräsidenten. Wer Kleriker ist, kann demnach kein politisches Amt ausüben. Abgesehen vom Bischof von Urgell in Spanien, der gerade aufgrund seines Bischofsamtes gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Frankreich einer der beiden Ko-Fürsten von Andorra ist. Und natürlich dem Papst selbst. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
Neben dem Klerus machen den weitaus größeren Teil der Kirche aber die Laien aus. Und zahlreiche katholische, ebenso natürlich evangelische Christen (denen die Unterscheidung von Klerus und Laien aber fremd ist und die stattdessen Amt und Gemeinde unterscheiden) sind politisch aktiv, nicht trotz, sondern gerade aufgrund ihres Glaubens. Um es bei einigen prominenten Beispielen bewenden zu lassen: der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der bereits in seiner Zeit als evangelischer Pfarrer in der DDR alles andere als unpolitisch war; Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in dem Buch ‚Daran glaube ich‘ Einblicke in die Motivation für ihre politische Arbeit gibt und das den Untertitel ‚Christliche Standpunkte‘ trägt; Thomas Sternberg, der nicht nur auf Kommunal- und Landesebene Mandatsträger der CDU war, sondern immer auch aktiver Verbandskatholik, derzeit gar in höchster Verantwortung als Präsident des ZdK. Ohnehin ist das Zentralkomitee ein buntes Potpourri aus Politikern aller Parteien. Im Mitgliederverzeichnis des ZdK finden sich Namen, die bis hinauf zu den höchsten Ebenen der Landes- und Bundespolitik reichen. So zählt das Zentralkomitee unter anderem die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner sowie den Grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, zu seinen Mitgliedern. Und auch die Teilerbin Angela Merkels, Annegret Kramp-Karrenbauer, die bereits signalisiert hat, dass der normative Anspruch der christlichen Soziallehre in der CDU wieder ins Werk gesetzt werden könnte, ist Mitglied des ZdK.
Die genannten Namen machen bereits deutlich, dass sich christliche Politiker, katholische wie evangelische, nicht nur in einer Partei wiederfinden, anders als das in den Glanzzeiten der Zentrumspartei tendenziell der Fall war, zumindest unter den deutschen Katholiken. Seit es kein katholisches Milieu mehr gibt, gelingt es auch keiner Partei, diese Klientel zu bündeln. Damit ist es auch dem Klerus kaum noch möglich, politischen Einfluss auf die Laien auszuüben. Und auch die unseligen Zeiten, als von den Kanzeln als Frohbotschaft getarnte Wahlempfehlungen, die sogenannten Wahlhirtenbriefe, verlesen wurden, sind glücklicherweise vorbei. Es ist uneindeutig, für welche politischen Positionen Christen heutzutage einstehen und welches Parteiprogramm sie unterstützen. Eindeutig aber ist, dass sich Christen aufgrund ihres Glaubens, aufgrund der verinnerlichten Goldenen Regel, in Gesellschaft und Politik einbringen.
Zumindest am Rande erwähnt werden muss, dass die sogenannte Amtskirche (so als ob diese von der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen verschieden wäre) dennoch politischen Einfluss ausübt, sowohl die katholische als auch die evangelische. Besonders über die Katholischen und Evangelischen Büros, die sich nicht nur in der Bundes-, sondern auch in den Landeshauptstädten meist in unmittelbarer Nähe zu den Schaltstellen politischer Macht finden, wird Lobbyarbeit betrieben. Und warum auch nicht? Jeder Autobauer, die Tabakindustrie, Gewerkschaften und Versicherungsfirmen haben ihre Lobbyisten. Und Kaninchenzüchter, Kleingärtner und Windkraftgegner schließen sich mal langfristig als Interessengemeinschaft, mal temporär als Bürgerinitiative zusammen, um auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene für gemeinsame Anliegen einzutreten. Dass auch die Kirchen die ihnen zustehenden Möglichkeiten nutzen, ist nicht verwerflich.
Auch die Politik profitiert davon, sind Ansprechpartner aufseiten der Kirchen klar benannt. Besonders deutlich wurde das bei dem Versuch, konfessionellen islamischen Religionsunterricht an hessischen Schulen einzuführen. Da der Religionsunterricht von der jeweiligen Religionsgemeinschaft inhaltlich mitverantwortet wird, sind die Kultusministerien der Länder auf Kooperationspartner aus den Religionsgemeinschaften angewiesen. Während das bei den Kirchen unproblematisch ist, zeigt die in Hessen getroffene Auswahl der Kooperationspartner, welche Probleme dabei entstehen können. Neben der Ahmadiyya-Gemeinschaft wurde dort auch der muslimische Verband Ditib ins Boot geholt, dessen Unabhängigkeit vom türkischen Staat seit den politischen Umwälzungen in der Türkei in Zweifel steht. Noch ist die Zukunft der Kooperation offen, bis Ende 2019 will der hessische Kultusminister R. Alexander Lorz eine Entscheidung herbeiführen. Das zeigt, dass nicht nur die Kirchen ein berechtigtes Interesse daran haben, den sprichwörtlichen kurzen Draht in die höchsten Zirkel der Politik zu wahren, sondern dass auch die Arbeit der Politiker erleichtert wird, sind Ansprech- und Kooperationspartner aus den Religionsgemeinschaften klar benannt.
Das Christentum: Doch keine Botschaft für die Welt?
Der Status quo lässt sich so zusammenfassen: Auf der einen Seite gibt es zahlreiche aufgrund ihres Glaubens gesellschaftlich und politisch engagierte Christen, sei es mit politischem Amt oder Ehrenamt. Auf der anderen Seite stehen die beiden großen Kirchen, deren amtliche Vertreter sich nicht nur zu Glaubensfragen äußern, sondern die auch in vielfältiger Weise politischen Einfluss ausüben, und zwar als Vertreter einer Institution, die ihrerseits mit dem Staat verschränkt ist und die gegenüber anderen Religionsgemeinschaften faktisch viele Privilegien genießt.
Wendete sich Papst Benedikt XVI., als er im Jahr 2011 seine Heimat Deutschland besuchte und im Freiburger Konzerthaus eine berühmt-berüchtigt gewordene Rede hielt, gegen diesen Zustand? Jedenfalls erweckte seine Ansprache vordergründig diesen Eindruck, weshalb die Worte ein Erdbeben in katholischen Kreisen in Deutschland auslösten. „Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen“, meinte der Papst, „muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von dieser ihrer Verweltlichung zu lösen und offen auf Gott hin zu werden.“ Um aber „die wahre Entweltlichung zu finden“, muss „die Weltlichkeit der Kirche beherzt“ abgelegt werden.
Viele haben diese Rede so verstanden, als sei es die Absicht des Papstes gewesen, gesellschaftlicher und politischer Teilhabe der Kirche in Deutschland einen Riegel vorzuschieben (und vielleicht wollten einige den ungeliebten Professorenkollegen von damals auch bewusst missverstehen, ihn abermals diskreditieren). Als der Sturm der Entrüstung abgeflaut war, zeigte die sich anschließende Debatte aber, dass die Intention des Papstes zwar unterschiedlich verstanden wurde, es aber zumindest schwierig ist, das Verhältnis von Kirche und Welt recht zu bestimmen.
Jedenfalls ist es unwahrscheinlich, dass Papst Benedikt eine von der Welt hermetisch abgeriegelte Kirche im Sinn hatte, unwahrscheinlich auch, dass er sich mit seinen Worten auf das gesellschaftliche und politische Engagement der anwesenden Laien bezog. Denn die Konstitution des Zweiten Vatikanums ‚Lumen Gentium‘ vom 21. November 1964, ebenso das nachsynodale Schreiben ‚Christifideles laici‘ Papst Johannes Pauls II. vom 30. Dezember 1988 sprechen vom „Weltcharakter“ der Laien. Als Teil der kirchlichen Sendung ist es deren besondere Aufgabe, die Welt zu gestalten. Es ist unwahrscheinlich, dass Papst Benedikt XVI. sich entgegen der Aussagen in den beiden lehramtlichen Dokumenten positionieren wollte. Damit stellt sich aber die Frage, ob sich die Botschaft des Papstes an den anwesenden Klerus richtete und sie sich damit auf die institutionellen Strukturen der Kirche in Deutschland bezog.
In diese Richtung weist zumindest auch eine Ansprache seines Nachfolgers Franziskus, die der Botschaft Benedikts überaus ähnlich ist. In der Votivmesse für die Kirche am 14. März 2013 richtete Papst Franziskus in der Sixtinischen Kapelle das Wort an die 114 Kardinäle, die ihn am Vortag zum Papst gewählt hatten: „Wenn wir ohne das Kreuz voranschreiten, wenn wir ohne das Kreuz aufbauen und wenn wir uns zu einem Christus ohne Kreuz bekennen, dann sind wir keine Jünger des Herrn: wir sind weltlich.“ Und „wenn wir uns nicht zu Jesus Christus bekennen, dann funktioniert das nicht. Wir werden eine fromme Nichtregierungsorganisation, aber nicht die Kirche“. Anders als bei Benedikt sind die Adressaten der Worte von Papst Franziskus klar: Es sind die Wahlmänner des Konklaves, also die höchsten Repräsentanten der katholischen Kirche, an die der Papst seine Worte richtete.
Die Kirche ist, so ließen sich die Worte von Papst Franziskus zusammenfassen, mehr als eine reine Wohlfahrtsorganisation oder ein Wertelieferant. Die Kirche ist zuallererst eine Glaubensgemeinschaft und muss das auch bleiben. Stets geerdet sollte sie zwar sein, um mit Bodenhaftung ihre Sendung in der und für die Welt wahrzunehmen, zugleich muss sie aber auch gehimmelt bleiben, das Reich Gottes kündend, unersetzbar, nicht einfach irgendeine NGO. Das scheint der Kern der Botschaft sowohl des emeritierten als auch des gegenwärtigen Pontifex zu sein. Mit keinem Wort ist das eine Absage an tätige Nächstenliebe, gesellschaftliches Engagement, sichtbar und außerhalb der vier Kirchenwände gelebtes Christentum im Geist der Goldenen Regel.
Kirchliche Verkündigung zwischen Gesinnung und Verantwortung
Aber selbst wenn die institutionellen Strukturen der Kirche in Deutschland und ihre Verschränkung mit dem Staat ausgeblendet werden, stellt sich immer noch die Frage, was es für die kirchliche Verkündigung heißt, „offen auf Gott hin zu werden“ (Benedikt XVI.), um nicht eine „fromme Nichtregierungsorganisation“ (Franziskus) zu sein. Darf die Kirche, dürfen ihre Vertreter über die Verkündigung in gesellschaftliche und politische Debatten eingreifen?
Der derzeitige Gesundheitsminister Jens Spahn hat diese Praxis anlässlich der Flüchtlingsdebatte mehrfach kritisiert. In einem Gastbeitrag in der Tageszeitung Die Welt Ende November 2018 vertrat Spahn unter der Überschrift „Glaube und Moral sind nicht dasselbe“ die These, dass „sich Religion und Moral vermengen und auf dieser Grundlage politischer Druck ausgeübt wird“. So passiere es, dass „ein religiös inspirierter oder kirchlich unterstützter Moralismus um sich greift und von der Gesellschaft wie der Politik fordert, seiner engen Gesinnungsethik Folge zu leisten“. Mit dem Theologen Friedrich Wilhelm Graf meinte Spahn, die Kirchen hätten „im politischen System der Bundesrepublik viel Moralmacht“, zu viel gar, nur um mit Friedrich Schleiermacher nachzulegen und zu behaupten, das Evangelium werde verfälscht, würde der „Erlösungsglauben mit Moral“ gleichgesetzt.
Inwieweit ist es also legitim, dass sich die Kirche in die Tagespolitik einmischt? Nur solange die Politik sich davon einen Nutzen verspricht, etwa um den Religionsunterricht zu gestalten, oder solange die politischen Vorhaben des derzeitigen Gesundheitsministers gutgeheißen werden? Oder ist der Vorwurf von Jens Spahn nicht etwa doch berechtigt? Müsste zugespitzt formuliert nicht gar von einer verfälschenden Verweltlichung des Evangeliums gesprochen werden, von einem instrumentalisierten Glauben, wenn Kirchenvertreter ihre „Moralmacht“ ausspielen und als Moralagenten auftreten? Nur liegt die moralische Beurteilung tagespolitischer Probleme nicht ohnehin außerhalb des kirchlichen Kompetenzbereichs?
Ein Beispiel aus dem Jahr 2017 zeigt, wie schwierig sich diese Fragen in der Praxis darstellen und nicht nur Politiker, sondern auch Kirchenbesucher umtreiben. Ulf Poschardt, Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, hat an Heiligabend 2017 mit einer Twitternachricht eine Debatte losgetreten. Vorausgegangen war dem Tweet, den Poschardt nach der Christmette seinem mobilen Endgerät anvertraute, sein verspätetes Halloweenerlebnis. „Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?“ Ein kalter Schauer muss Poschardt über den Rücken gelaufen sein, nicht etwa, weil die Kirchenfinanzen es nicht erlaubt haben, in der Berliner Nikolasseekirche vernünftig zu heizen, sondern weil der Pastor den Gottesdienstbesuchern in Poschardts Augen ein linksgrünes Evangelium von der Kanzel verkündet hat.
Die Debatte über diesen Tweet ist Geschichte. Nicht so die Anfrage an die Predigtkultur und die kirchliche Verkündigung schlechthin. Nicht nur, weil Weihnachten alle Jahre wied...