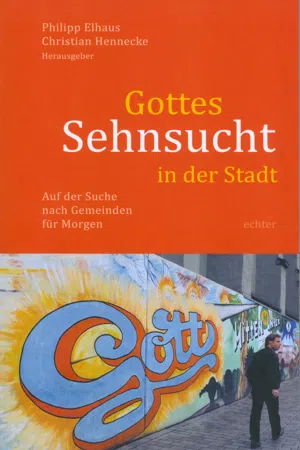
eBook - ePub
Gottes Sehnsucht in der Stadt
Auf der Suche nach Gemeinden für Morgen
- 288 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Gottes Sehnsucht in der Stadt
Auf der Suche nach Gemeinden für Morgen
Über dieses Buch
Was kommt nach der Milieukirche?Die volkskirchliche Sozialgestalt der Pfarrgemeinde wird in Zukunft wohl eine wichtige, aber nicht mehr die einzige Ausdrucksform des Kircheseins sein. Seit Jahren zeichnet sich ein Aufbruch ab: Dort, wo Menschen neu zum Glauben kommen, entstehen neue Formen. In den vergangenen Jahren haben das Bistum Hildesheim und die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover gemeinsam diese neuen Erfahrungen in den Blick genommen, unterschiedliche Projekte gestartet und theologisch über die neuen Wege einer missionarischen Kirche reflektiert.In diesem Buch wird ein Weg der Hoffnung und des Mutes sichtbar - eine Inspiration für eigene Suchwege.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Gottes Sehnsucht in der Stadt von Philipp Elhaus, Christian Hennecke, Philipp Elhaus,Christian Hennecke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Christliche Kirche. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
II.
Eine weltkirchliche Lerngemeinschaft: Deutschland – England
Dirk Stelter
Die anglikanische Kirche
Reformatorisch und katholisch zugleich
Gleichzeitig reformatorisch und katholisch – so sieht sich die anglikanische1 Kirche. Allein schon aufgrund dieser Charakterisierung ist sie, selbst wenn es keine „fresh expressions of church“ gäbe, für evangelische Kirchen und für die römisch-katholische Kirche interessant.
Hinzu kommt, dass sich die anglikanische Kirche nicht in einer simplen Addition dieser beiden Charakteristika erschöpft, sondern ein Gebilde eigener Art ist. So fällt aus kontinentaleuropäischer Perspektive auf, dass der verbindlich formulierte Glaubensgehalt weniger relevant ist als in den großen Kirchen des Festlands. Zwar gibt es anglikanische Glaubensartikel, aber sie nehmen nicht den hohen Stellenwert ein, der etwa in den evangelisch-lutherischen Kirchen den Bekenntnisschriften zukommt. Zwar gibt es anglikanische Lehre, aber nicht – wie in der römisch-katholischen Kirche – das an eine zentrale Autorität gebundene Lehramt, das Lehre verbindlich auslegt und festlegt. Und so schimmert ein gewisses Befremden durch die Zeilen, wenn das LThK feststellt: „Anglikaner [sind] gegenüber Autoritätspersonen empfindlich u. haben eine Abneigung gg. überspitzte Definitionen. […] Sie veröffentlichen selten Lehräußerungen ohne Minderheitsgutachten … Es heißt, Wahrheit werde allmählich erworben, ohne daß immer klar ist, wie das für Grundsätzliches zu handhaben ist …“2
Die anglikanische Kirche versteht sich in besonderer Weise aus der Geschichte heraus. Das gilt in dreifacher Weise:
Erstens sieht sie sich eingebettet in die Geschichte der Gesamtkirche. Es gibt „ein ausgeprägtes Bewußtsein einer kontinuierlichen Tradition, die über die Reformation und alle Wechselfälle der Geschichte hinaus bis in die Zeit der Urkirche und des Neuen Testaments zurückreicht“.3 Entsprechend gelten als Königsdisziplinen der Theologie die Bibelwissenschaft und die Patristik.
Zweitens haben sich im Laufe ihrer Geschichte verschiedene Strömungen entwickelt, die bisher in der breiten Klammer der anglikanischen Kirche zusammengehalten worden sind. Bezeichnenderweise beginnt das Book of Common Prayer in seiner Ausgabe von 1662 mit den Worten „It hath been the wisdom of the Church of England … to keep the mean between the two extremes“4 und spielt dann auf die geschichtlichen Erfahrungen von Extremen in den vorangegangenen Jahrzehnten an: von der Gegenreformation unter Königin Maria Tudor bis zur puritanischen Herrschaft unter dem republikanischen Lord Protector Oliver Cromwell.
Drittens hat sich die anglikanische Kirche nie als Konfessionskirche verstanden, sondern „schlicht als der christliche Glaube“.5 Die Inhalte dieses Glaubens, so die anglikanische Überzeugung, können mit einer dogmatischen Festschreibung nicht adäquat erfasst werden, denn Menschenworte vermögen Gottes Wahrheit nie ganz zu erschöpfen. Dem korrespondiert das Vertrauen, dass „die Offenbarung, die ein und für allemal in Jesus Christus gegeben wurde, bis an das Ende der Welt nicht aufhören wird, zu wachsen und zuzunehmen durch das Wirken des Heiligen Geistes“.6 Dieses Vertrauen bringt Toleranz mit sich, Bereitschaft zur Ökumene und Offenheit zum Dialog mit neuen gesellschaftlichen und geistigen Entwicklungen.
1. Geschichte
Die anglikanische Kirche beginnt nicht, wie Kontinentaleuropäer mitunter meinen, mit König Heinrich VIII. (1509–1547), sondern mit Augustin.7 Allerdings nicht mit Augustin von Hippo, sondern mit dem Abt des Andreasklosters in Rom, den Papst Gregor I. zusammen mit 40 Benediktinermönchen nach England schickte, wo sie um 596 in der Nähe des heutigen Canterbury an Land gingen. Und so hat dieser Augustin im Nachhinein den Namen Augustin von Canterbury erhalten.8
Weil Papst Clemens VII. sich weigerte, die erst durch seinen Dispens zustande gekommene Ehe Heinrichs VIII. mit Katharina von Aragon für nichtig zu erklären, sorgte dieser, der aufgrund seiner gegen Luther gerichteten Schriften 1521 von Papst Leo X. noch mit dem Titel fidei defensor („Verteidiger des Glaubens“) geehrt worden war, dafür, dass Beschlüsse des Parlaments sowie der Synode der Kirchenprovinzen von Canterbury und York 1534 die Jurisdiktion des Papstes in seinem Reich aufhoben und durch die des Königs ersetzten. Damit hörte die englische Kirche auf, eine nationale Ortskirche der unter dem Papst stehenden abendländischen Christenheit zu sein. Auswirkungen auf Theologie und Liturgie hatte das allerdings nicht.
Unter kontinentalem Einfluss nahmen jedoch die Reformbestrebungen zu, unterstützt vom von Heinrich VIII. ernannten Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer (1532–1556). Unter dem neuen König Eduard VI. (1537–1553) wurden Reformen9 durchgeführt. Sie standen auf fünf Pfeilern: Predigten in englischer Sprache zur Belehrung des Volkes; Gottesdienstreform mit dem Book of Common Prayer („Allgemeines Gebetsbuch“); „42 Religionsartikel“, die im reformatorischen Sinne zu theologischen Streitfragen der Zeit Stellung bezogen; Katechismus; Ernennung neuer, reformgesinnter Bischöfe.
Seine Nachfolgerin Maria Tudor (1516–1558) macht das Schisma mit Rom wieder rückgängig. Anhänger der Reformation wurden verfolgt, viele flohen auf das Festland und lernten dort reformatorische Theologie intensiver kennen.
Die neue Königin Elisabeth I. (1533–1609) führte die Reformen wieder ein: Das Parlament erkannte sie als Supreme Governor („oberste Leiterin“)10 der Kirche an. Sie schrieb ein eng an Eduard VI. angelehntes, allerdings weniger reformatorisches Book of Common Prayer vor. Die Religionsartikel wurden wieder aufgenommen und erhielten als die „39 Religionsartikel“ ihre endgültige Form. Die alte Kirchenverfassung mit dem dreigliedrigen Amt (Bischof, Priester, Diakon) wurde in Kontinuität mit der Kirche vor Heinrich VIII. beibehalten.11 Viele Romtreue wurden verbannt. So war „eine Kirche entstanden, deren Oberhäupter sie als ein reformiertes, mit Heidelberg, Zürich, Genf oder Edinburgh verbundenes Kirchenwesen ansahen; und dennoch war sie, anders als dort, in ein hochkonservatives Gefüge von Ordnung und Brauch eingebettet und daher konservativer geprägt als das konservativste Luthertum.“12
Einigen, die vom Festland zurückkehrten, gingen die Reformen nicht weit genug. Diese „Puritaner“ wollten den Episkopat abschaffen und eine presbyterianische Ämterordnung einführen. Aber auch der neue König, Jakob I. (1566–1625), ließ sich darauf nicht ein. Ebenfalls an der alten Ordnung orientierte sich das neue Kirchenrecht, die zwischen 1604 und 1606 verfassten canones. Allerdings kam der König ihnen insofern entgegen, als er eine neue Bibelübersetzung erstellen ließ: die „King James Version“ von 1611. Die zu dieser Zeit gelegten Fundamente sollten lange halten: Ein die canones ersetzender neuer Codex wurde erst 1969 promulgiert, und die „King James Version“ blieb bis 1881 die einzige in anglikanischen Kirchen weltweit verlesene Bibel.
Die Auseinandersetzung zwischen Traditionalisten und Puritanern bestimmte weithin das 17. Jahrhundert und führte unter Karl I. (1600–1649) zu einem Dauerzwist zwischen dem von Puritanern dominierten Unterhaus auf der einen Seite sowie ihm und dem hochkirchlichen Erzbischof von Canterbury, William Laud (1573–1645), auf der anderen Seite. Der Streit eskalierte: Erzbischof und König wurden hingerichtet. Nach Ausrufung der Republik unter Leitung Oliver Cromwells (1599–1658) ersetzte das Parlament das Book of Common Prayer durch ein „Direktorium des öffentlichen Gottesdienstes“ nach reformiertem Vorbild, die „39 Religionsartikel“ durch das calvinistische „Westminster-Glaubensbekenntnis“ und den Episkopat durch eine puritanische Ämterordnung.
1660 wurde unter Karl II. die Monarchie wiederhergestellt. Die puritanischen Reformen wurden durch das Parlament mit anglikanischer Mehrheit zurückgenommen. Die in den vorausgegangenen zwei Jahrzehnten von Presbyteriern Ordinierten mussten sich erneut von Bischöfen ordinieren lassen; 2000 Geistliche gaben deshalb ihr Amt auf (dissenters).
Auf seinem Sterbebett wurde Karl II. römisch-katholisch. Römisch-katholisch war auch sein Nachfolger, Jakob II. (1633–1701). Er war sehr unbeliebt, wurde 1688/89 im Rahmen der Glorious Revolution vertrieben und durch seine evangelische Tochter Maria II. (1662–1694) und ihren evangelischen Gatten, Wilhelm III. von Oranien (1650–1702), ersetzt. Einige Hochkirchliche verweigerten dem neuen Königspaar den Eid (non-jurors), so dass ein schismatischer Zweig entstand, der eigene Weihen spendete.
Um den Jahrhundertwechsel verloren durch den Rationalismus13 mit seinem Vertrauen in die menschliche Vernunft und den Deismus die Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts an Schärfe. In diesem Sinne versuchten die Latitudinarianer, gegnerische Positionen dadurch zu überbrücken, dass sie gewisse Elemente der Kirchenordnung, liturgische Ordnungen und Lehren für „indifferent“ erklärten.
Im 18. Jahrhundert vernachlässigten viele Geistliche die Seelsorge; sie bezogen aus reichen Pfründen ihr Einkommen und lebten in der Hauptstadt. Auf die geistliche Not, die daraus resultierte, antwortete eine evangelikale Erweckung. Persönliche Erlösung, schriftgemäße Lehre und Predigt standen im Vordergrund. Die evangelikale Frömmigkeit hatte auch sozialethische Implikationen: Evangelikale, besonders William Wilberforce (1759–1833), leiteten eine Kampagne zur Abschaffung des Sklavenhandels.14
Das 19. Jahrhundert brachte – auch im Zuge einer konservativen Wende als Reaktion auf die Französische Revolution – eine Erneuerung des katholischen, hochkirchlichen Erbes der Kirche von England. Exponent dieser Entwicklung war die Oxfordbewegung. Ihre Anhänger betonten den Gehorsam gegenüber den kirchlichen Autoritäten, die Lehren von der apostolischen Sukzession und der Realpräsenz, führten die Beichte, Mitren für Bischöfe und Messgewänder wieder ein. Erstmals seit Heinrich VIII. die Klöster aufgelöst hatte, lebte die Tradition des gottgeweihten Lebens wieder auf. Von 1850 bis 1970 erreichte es die Oxfordbewegung, dass der Sakramentsgottesdienst mit dem Schwerpunkt auf der Kommunion verbreiteter war als das zuvor üblichere Morgengebet mit dem Hauptgewicht auf der Predigt. Hauptfigur war John Henry Newman (1801–1890), der schließlich römisch-katholisch wurde, 1879 sogar Kardinal.15
Neben Wales, Irland und Schottland, wo es der anglikanischen Kirche vergleichbare Kirchen seit dem 16. Jahrhundert gab, verbreiteten sich mit den Siedlern und Kolonisten anglikanische Gemeinden über die ganze Welt. Seit der Wende zum 18. Jahrhundert sorgten Missionsgesellschaften für eine systematische Verbreitung des Anglikanismus.16 Der erste Bischof einer Kolonie wurde 1784 geweiht. Mit der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien entstanden eigenständige anglikanische Kirchenprovinzen. Die Gemeinschaft dieser autonomen Kirchenprovinzen bildet die Anglican Communion, die Anglikanische Gemeinschaft.
2. Anglikanische Frömmigkeit und anglikanischer Glaube
Anglikanische Frömmigkeit wurzelt in der liturgischen Tradition. Ihr Herzstück ist das Book of Common Prayer. „Der ständige Gebrauch des Book of Common Prayer hat mehr als alles andere Glauben, Leben und Zeugnis der anglik. Gemeinde geformt und beeinflusst.“17 Das Buch enthält die Riten für die Taufe und die Heilige Kommunion, die Ordnungen des täglichen Morgenund Abendgebets, die Texte für die wechselnden Teile in den Gottesdiensten der Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, den Psalter, die Gottesdienstordnungen für Konfirmation und Ordination, Hochzeit, Beerdigung und weitere Gelegenheiten sowie einen kurzen Katechismus und die 39 Religionsartikel. Entsprechend der Regel lex orandi, lex credendi („Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens“) speist sich anglikanischer Glaube in besonderer Weise aus diesem liturgischen Buch. Bis 1928 war es in allen Teilen der Anglikanischen Gemeinschaft gleich. Inzwischen hat jede Provinz das Buch im Blick auf die jeweilige Sprache und Kultur revidiert. In der Kirche von England gibt es seit 2000 das Common Worship.18
Schon die Einordnung der „39 Religionsartikel“ in das Book of Common Prayer zeigt, dass ihnen nicht dieselbe Bedeutung zukommt wie z. B. den lutherischen Bekenntnisschriften. Mit ihnen bekräftigten die englischen Reformer einerseits zentrale unstrittige Lehraussagen und positionierten sich andererseits im Sinne der reformatorischen Lehre zu den damals strittigen Themen wie Rechtfertigung durch den Glauben und Bedeutung der guten Werke, Prädestination, die Kirche und ihre Autorität, Amt und Sakramente. Seit 1563 wurden Geistliche, sofern sie Pfründe erhielten, zur Anerkennung dieser Artikel verpflichtet, seit 1865 ist nur noch gefordert anzuerkennen, dass die Lehre der Kirche von England, wie sie im Book of Common Prayer und den Religionsartikeln dargelegt ist, mit dem Wort Gottes übereinstimmt.19
Ein bedeutendes Dokument jüngerer Zeit, das zentrale anglikanische Glaubensinhalte darlegt, ist das – auch in ökumenischer Absicht verfasste – Lambeth-Quadrilateral („Lambeth-Viereck“): „Lambethkonferenz 1888, Resolution 11: Nach Meinung dieser Konferenz stellen die folgenden Art. eine Grundlage dar, auf Grund deren Fortschritte in Richtung Einheit gemacht werden können: a) Die Hl. Schriften des AT und NT enthalten alles für die Erlösung Notwendige und sind die Regel und der letztgültige Maßstab für den Glauben. b) Das Apostolische Glaubensbekenntnis als das Taufsymbol und das Nicaenum als der hinreichende Ausdruck des christlichen Glaubens. c) Die beiden von Christus selbst eingesetzten Sakramente – Taufe und Abendmahl – gespendet mit den unfehlbaren Einsetzungsworten Christi und den von ihm verordneten Elementen. d) Der historische Episkopat, in seiner Arbeitsweise angepaßt an die unterschiedlichen Bedürfnisse der von Gott in die Einheit Seiner Kirche berufenen Nationen und Völker.“20 Allerdings hat dieses Dokument – wie alle auf Lambeth-Konferenzen der Anglikanischen Gemeinschaft beschlossenen Texte – keine verbindliche Autorität.
Anglikanischer Glaube zeichnet sich durch „comprehensiveness“ aus, insofern er die Weite hat, Reformatorisches und Katholisches zu umfassen.21 Evans sieht „fromme Vernünftigkeit“ als Grundzug anglikanischen Glaubens an und definiert ihn als „ein Vertrauen auf die Schrift, wie sie im Lichte der Tradition der ganzen und ungeteilten Kirche durch das verständige Volk interpretiert wurde, das ihre Wahrheit aufgrund eigener Erfahrung erkannt hat“.22
3. Die Gegenwart
Als Erbe aus ihrer Geschichte gibt es in der anglikanischen Kirche drei Parteien oder Strömungen:
– Die Evangelikalen (Low Church, vgl. die evangelikale Erweckung des 18. Jahrhunderts) treten ein für die stete Erneuerung ihrer Kirche durch unmittelbare Erfahrung von Gottes Gnade in Christus. Aus diesem Flügel stammen auch die ersten ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- I. Fresh expressions: Die ökumenische Frage nach einer neueren Kirchengestalt
- II. Eine weltkirchliche Lerngemeinschaft: Deutschland – England
- III. Aufbrechende Kirchenlandschaften: ein neuer Blick auf eine Kirche, die im Kommen ist
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren