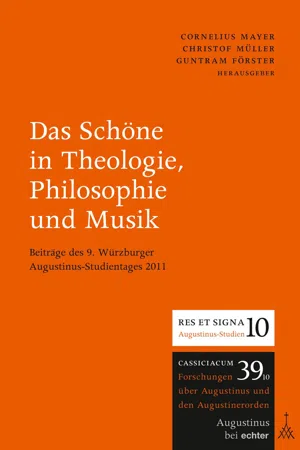
eBook - ePub
Verfügbar bis 10 Jun |Weitere Informationen
Das Schöne in Theologie, Philosophie und Musik
Beiträge des 9. Würzburger Augustinus-Studientages 2011
Dieses Buch kann bis zum folgenden Datum gelesen werden: 10. Juni, 2026
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 10 Jun |Weitere Informationen
Das Schöne in Theologie, Philosophie und Musik
Beiträge des 9. Würzburger Augustinus-Studientages 2011
Über dieses Buch
Das "Schöne" gehört von Anbeginn an zu den großen Begriffen der abendländischen Geistesgeschichte und firmiert hier insbesondere als Kategorie der "Vermittlung": zwischen Sinnlichkeit und Verstand, zwischen Wollen und Sollen, zwischen verschiedenen Disziplinen, aber auch zwischen unterschiedlichen Epochen. In den Beiträgen des vorliegenden Sammelbandes, der in seinem Kernbestand auf den IX. Würzburger Augustinus-Studientag zurückgeht, geben ausgewiesene Experten beispielhafte Einblicke in diese "Vermittlungsleistung" des Schönen in Philosophie, Theologie und zumal in Musik und Musiktheorie: schwerpunktmäßig bei Augustinus (354-430), jedoch auch mit dem Blick auf die Traditionen vor und nach ihm sowie auf die neuzeitliche und die systematische Diskussion des Ästhetischen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das Schöne in Theologie, Philosophie und Musik von Cornelius Mayer, Christof Müller, Guntram Förster, Cornelius Mayer,Christof Müller,Guntram Förster im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Anja Heilmann
«amica est ... similitudo» (Boeth. mus. 1,1)
Musiktheorie und musikalische Ästhetik bei Boethius
1. Das Schöne im Allgemeinen
Könnten wir Boethius mit der Frage konfrontieren: Was ist schön?, dann gäbe er uns vermutlich eine Antwort, die auch Augustinus’ Auffassung entspräche, nämlich in der Sache ungefähr so:
Es sind Abstufungen zu unterscheiden: Wirklich schön ist in gewisser Weise allein Gott; und alles, was aus ihm hervorgeht – seine Schöpfung –, trägt eine deutliche Spur dieser Schönheit aufgrund der Wohlordnung und Einheit alles Geschaffenen trotz aller üppigen Vielheit und Ausdifferenzierung. Neben diesem schönen Geschaffenen gibt es noch künstlich Geschaffenes, z.B. Musik. Wenn ein Kunstwerk der göttlichen Schöpfung analog ist, vom ‹gesunden› Rezipienten gut aufgenommen werden kann, handwerklich wohlgefertigt ist und zu Gott führt, ist es besonders schön. Sowohl bei den Kunstwerken als auch beim All mit seinen Teilen sind wiederum verschiedene Grade der Schönheit zu unterscheiden – je nach der ‹Nähe› zu Gott.
Boethius hätte diese Antwort freilich anders formuliert und viel differenzierter gegeben. Leider hat er keine Ästhetik verfasst, so dass wir seine Auffassungen aus seinen überlieferten Texten herauspräparieren müssen. Dabei weht dem Leser eindeutig ein neuplatonischer Wind entgegen, auf dessen wesentliche Züge bereits andere Beiträge in diesem Tagungsband eingehen, so dass wir uns zur Frage, was bei Boethius ganz allgemein für schön gehalten wird, kurz fassen und dann den Akzent der Ausführungen stärker auf die Musik legen können.
Das in jeder Hinsicht zentrale Gedicht 3,9 in Boethius’ Trost der Philosophie beginnt folgendermaßen1:
O qui perpetua mundum ratione gubernas, | Der du lenkst die Welt nach dauernden, festen Gesetzen, |
terrarum caelique sator, qui tempus ab aeuo | Schöpfer des Himmels, der Erden, der du von Ewigkeit ausgehen |
ire iubes stabilisque manens das cuncta moueri, | hießest die Zeit, selbst nimmer bewegt, bewegend das Weltall! |
quem non externae pepulerunt fingere causae | Keine äußere Macht trieb dich, aus wogenden Massen |
materiae fluitantis opus, uerum insita summi | deine Schöpfung zu formen; in dir nur trägst du des höchsten |
forma boni, liuore carens tu cuncta superno | Guten Gestalt, bist frei von Mißgunst. Das All vom Urbild |
ducis ab exemplo; pulchrum pulcherrimus ipse | leitest du her; die herrliche, Herrlichster selber, trägst du im Geiste, |
mundum mente gerens similique in imagine formans | die Welt, und formst sie zu ähnlichem Bilde, |
perfectasque iubens perfectum absoluere partes ... | in der vollendeten schafft dein Befehl vollkommene Teile ... |
Bei diesen und den folgenden Zeilen handelt es sich um eine Paraphrase einer Passage aus dem Platondialog Timaios (29d–42d), in der die Schöpfung der Welt sowie die Schaffung der Weltseele und der kleineren Teile der Welt geschildert werden. Für unser Thema ist die Aussage erheblich, dass der schöpferische Gott selbst der Schönste ist und seine Schöpfung schön. Das sollte man angesichts der Tatsache betonen, dass Platonikern und Neuplatonikern immer wieder pauschal eine Abwertung der sichtbaren Welt und der Wahrnehmung unterstellt wird. Damit greift man zu kurz: Per se sind die geschaffene Welt und ihre Wesen, darunter der edle Mensch, schön; sie vollenden das Schöpfungswerk und sind in dieser Hinsicht unverzichtbar. Gleichzeit ist aber wahr, dass es nach neuplatonischer Auffassung Schöneres gibt, etwa die Ideen bzw. göttliche, ewige Denkinhalte. Außerdem erinnern diese Zeilen daran, dass das All bereits ein Abbild ist: Gott orientiert sich an einem Urbild und schafft die sichtbare Welt diesem ähnlich. Die Schönheit des Geschaffenen leitet sich also von der des Vorbildes bzw. des Schöpfers, der das Vorbild in seinem Geiste in sich trägt, her – ein Grundsatz, der auch für die Kunst per analogiam Relevanz besitzt. Und drittens deutet sich an, dass Schönheit mit der Vollendung des Ganzen samt seinen Teilen zu tun hat2. In Gott selbst fallen Ganzes und Teil zusammen; in der geschaffenen Welt bilden die Teile sowohl als Mikrokosmos (etwa der Sternenhimmel) als auch insgesamt eine organische Einheit, die in diversen weiteren Gedichten im Trost der Philosophie besungen und gepriesen wird.
2. Das Schöne im Speziellen:
Boethius’ Musiktheorie bzw. Was ist gute Kunst?
Bei der Betrachtung des Schönen in der Kunst und speziell in der Musik wird es recht mathematisch. Boethius stellt sich nämlich wie auch Augustinus in die neuplatonische Tradition, nach der die Zahl als quantitative ‹Chiffre› für die göttliche Schöpfung angesehen wird3. Die Wissenschaft von der Zahl – die Arithmetik – gilt deshalb als eine gute und unverzichtbare Vorbereitung für das Studium der Philosophie, das ja auch einen rationalen Nachvollzug der Weltschöpfung einschließt.
Zahlen spiegeln aber nicht nur die höheren Prinzipien wider, nach denen die Welt geschaffen wurde, und lassen nicht nur die Ordnung in der Schöpfung in gewisser Weise nachvollziehen, sondern sie wirken auch selbst ordnend in der Welt – man denke an die Jahreszeiten, die Zeit überhaupt mit Mondphasen etc. und in der Kunst an das Metrum in Versen oder den Takt in der Musik. Auch die in der Musik behandelten Töne sind wesentlich durch Zahlen bestimmt, wie man allein an den Namen der Intervalle (Terz, Quarte, Quinte etc.) erkennen kann. In der Antike hat man Intervalle untersucht und ist ganz richtig davon ausgegangen, dass diese durch Zahlenverhältnisse bestimmt werden. Das Zahlenverhältnis wurde dabei als ‹Form› an einer Materie – etwa einer gespannten Saite – verstanden4. Hier die einfachsten und in Boethius’ Musiklehrbuch De institutione musica zentralen Intervalle5:
Oktave | 2:1 (einfachstes vielfaches Verhältnis) | |
Quinte | 3:2 (einfachstes epimores Verhältnis) | ‹epimor› (‹ein Teil dazu›) / ‹superparticulare›: Verhältnis, bei dem die größere Zahl die kleinere einmal als ganze und dazu noch einmal deren kleinsten Teil in sich enthält |
Quarte | 4:3 (epimores Verhältnis) | |
Ganzton | 9:8 (epimores Verhältnis) | |
kleiner Halbton | 256:243 |
Die Musiktheorie wurde von Boethius und seinen griechischen Quellen6 als Wissenschaft von den Zahlenverhältnissen angesehen, weshalb im Folgenden näher auf die Rolle der Zahlen einzugehen sein wird. Dabei bedürfen beide genannten Aspekte – die Zahl sei ein Widerschein der göttlichen Schöpfung sowie der Schöpfungsordnung und sie wirke in der Welt – der Erläuterung, um genauer zu verstehen, inwiefern etwas künstlich Geschaffenes schön ist bzw. sein kann.
2.1. Die Zahl als Widerschein der göttlichen Schöpfung und der Schöpfungsordnung
Wie im Timaios dargestellt wird – und eben auf diese Passage (29dsqq.) samt der Psychogonie (34csqq.) bezieht sich das oben erwähnte Gedicht (‹carmen› 3,9) –, bedient sich der Demiurg dreier Prinzipien bei seiner Schöpfung: der Identität, der Verschiedenheit und des Seins. Mit dem Sein ist wohl gemeint, dass etwas etwas Bestimmtes ist, also eine gewisse Bestimmtheit besitzt (im Unterschied zum allerhöchsten Prinzip, dem Einen) und deshalb erkannt werden kann. Außer dem höchsten Einen und der absoluten Materie ‹ist› alles in gewisser Weise. Identität und Verschiedenheit wirken gleichfalls beide auf allen Ebenen der Schöpfung.
Boethius weist darauf in seiner Arithmetikschrift – eine Übertragung des erhaltenen griechischen Lehrbuches des Nikomachos von Gerasa – hin7. Selbst wenn die Überschriften zu De institutione arithmetica nachträglich in das Manuskript eingefügt wurden, fasst doch die zu Kapitel 2,32 den Inhalt treffend zusammen: «Alles besteht aus der Natur des Selben und der des Verschiedenen und das kann primär bei den Zahlen gesehen werden» («quod omnia ex eiusdem natura et alterius natura consistant idque in numeris primum uideri»). So hat die Zwei laut Boethius in besonderer Weise Anteil an der Verschiedenheit (‹alteritas›), weil sie von der Eins ausgehend die erste Abweichung in die Verschiedenheit darstellt. Sie gilt deshalb als Prinzip der Verschiedenheit bei den Zahlen. Da von der Zwei ausgehend alle geraden Zahlen gebildet werden, haben die geraden Zahlen besonderen Anteil an der Verschiedenheit. Die ungeraden Zahlen hingegen besitzen eine besondere Ähnlichkeit zur Eins und haben besonderen Anteil an der Identität, wie man etwa bei den Quadratzahlen lernen kann8: Addiert man die ungeraden Zahlen, die ja der Einheit bzw. der unveränderlichen Natur des Selben teilhaftig sind, erhält man Quadratzahlen, z.B. 1+3=4; 4+5=9; 9+7=16; 16+9=25. Figuriert man diese, d.h. breitet man die Quadratzahlen in der Vorstellung räumlich aus, dann erhält man Flächen mit gleichen Winkeln und gleichen Seitenlängen. Addiert man hingegen die geraden Zahlen auf, erhält man die ‹parte altera longiores›, die heteromeken Zahlen, bei denen ein T...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Universale Schönheit in der Kunst bei Augustinus
- «Das Schöne ist der Glanz des Wahren» Über klassische Paradigmen der Schönheit: Plotin – Augustinus – Schelling
- ‹Pulchritudo› – Über den Grund der Erfahrung des Schönen bei Augustinus
- Gestaltung der ‹aequalitas numerosa› – Augustinus Über die Musik
- «amica est ... similitudo» (Boeth. mus. 1,1) Musiktheorie und musikalische Ästhetik bei Boethius
- Prinzipien der Ästhetik Augustins (Festvortrag vom 18. Juli 2007)
- Delectatio (delectare) (= Augustinus-Lexikon 2, 267–285)
- Musica (= Augustinus-Lexikon 4, 123–130)
- Abkürzungsverzeichnisse
- Stellenregister
- Namenregister
- Autoren- und Herausgeberverzeichnis