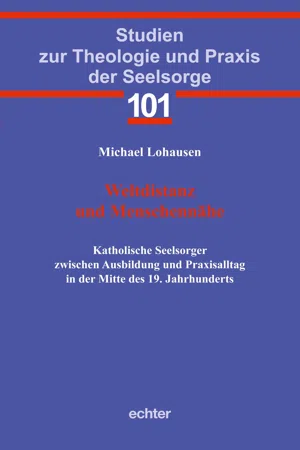![]()
1 Die geschichtliche Rückfrage als Bestandteil der Pastoraltheologie
Wenn man bei der Habilitationsstudie ansetzt, die der Österreicher Franz Dorfmann 1910 in Wien veröffentlicht hat, dann haben sich Pastoraltheologen – nur Männer – seit etwas mehr als hundert Jahren in einem nennenswerten Umfang damit beschäftigt, die Entwicklungslinien in ihrem Fach bis in die jeweilige Gegenwart sichtbar zu machen. Diese Geschichtsrekonstruktion ist im Ganzen inzwischen selbst von Dynamiken, Wendungen, Brüchen gekennzeichnet. Sie hat ihre eigene Vergangenheit. Das nachfolgende Kapitel schließt die Lücke, dass die Etappen dieser Auseinandersetzung noch nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Aufarbeitung gewesen sind, indem Fachautoren, die entweder durch Monographien oder wenigstens innerhalb von größeren Veröffentlichungen die Geschichte der Pastoraltheologie über die ganze Länge untersucht haben, in den Blick genommen und einander zugeordnet werden. Die zum Teil umfangreichen Forschungen, die sich auf einzelne Phasen oder Persönlichkeiten in der Entwicklung beziehen – beispielsweise zum Josephinismus, Johann Michael Sailer als prägender Figur für die Theologie im 19. Jahrhundert oder zur Tübinger Schule –, müssen bei einer solchen allgemein angelegten Perspektive übergangen werden oder können nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Bezugnahme punktuell hilfreich ist.
1.1 Geschichte der Pastoraltheologie institutionalistisch gelesen: Franz Dorfmanns Auftakt
1.1.1 Die Aufklärungs-Debatte: Quellen oder Dogmen als Autorität für die Geschichtswissenschaft?
Der Würzburger Professor Sebastian Merkle (1862—1945)33 meldete sich im Sommer 1908 beim Internationalen Kongress für historische Wissenschaften mit einem Beitrag zu Wort, der einen sich über mehrere Jahre hinziehenden Gelehrtenstreit vom Zaun brach und nach dem Ort des Geschehens als ‚Berliner Rede‘34 berühmt geworden ist. Der Kirchenhistoriker sprach über die Aufklärung. Und er sorgte dabei auch selbst gleich für klare Verhältnisse: Merkle teilte den Zuhörer_innen nicht nur mit, wie er sich eine geschichtswissenschaftlich saubere Beschäftigung mit der Aufklärung vorstellte, sondern auch, unter direkter Bezugnahme auf ausgewählte Persönlichkeiten in der zusammengekommenen Fachgruppe, wie man es aus seiner Sicht nicht machen durfte.
Die Ausgangsposition: „Die Aufklärung ist so schlecht nicht gewesen“
Die Kritik war stellvertretend für eine ganze Fraktion aus dogmatistisch eingestellten Kirchenhistorikern in der Hauptsache auf den Tübinger Professor Johann Baptist Sägmüller (1860—1942)35 gemünzt. Der Würzburger Kollege bescheinigte ihm, „dass … das historische Interesse durch die kirchenpolitische Tendenz alteriert werde, dass der nützliche Zweck mitunter seinen Blick getrübt habe und dass das Gemälde unter dem Einfluss seiner persönlichen Stimmung allzu schwarz geraten sei.“36 Merkle deklassierte diese kirchlich-autoritativ geprägte Parteilichkeit im Geschichtsverständnis als unobjektiv und deshalb nicht vertretbar. Er wusste seine Enthüllungen auch eindrucksvoll zu inszenieren, indem er eine beißende Polemik an den Tag legte, die immer wieder schallendes Gelächter im Auditorium auslöste. Die Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Moderne stand zur Debatte, in der Version, ob die Theologie sich selbst desavouiert, wenn „[die Dogmatik] eine Sache für wahr erklären [kann], auch wenn der Kirchenhistoriker aus den Quellen das genaue Gegenteil bewiesen hat“37, und der Mann am Rednerpult brachte seine Einstellung zu dieser Frage mit der spektakulären Ausreizung der Situation unmissverständlich zum Ausdruck.
Merkle breitete ein ganzes Themenspektrum aus, für das er minutiös vorführte, wie die ins Visier genommenen Fachkollegen durch selektive Quellenrezeption diffamierten, was sie für die anti- bzw. unkirchliche Substanz der Aufklärung hielten. Der Mainzer Kirchenhistoriker und spätere Bischof Heinrich Brück (1831—1903)38 und der Freiburger Kanonist Adolf Rösch (1869—1962)39 standen neben Sägmüller im Fokus der Dekonstruktion. Merkle bezichtigte sie unter Hinzuziehung einschlägiger Belegstellen der „Geschichtsklitterung“40 und stellte fest, dass „sich denn auch die heutige Anschauung vom Zeitalter der Aufklärung zumeist noch im Schlepptau von deren zeitgenössischen Gegnern [bewegt], die die Fehler ihrer Rivalen ins Groteske steigerten oder frei erfanden, während sie die eigenen, die zu einer Änderung geradezu zwangen, nicht sahen oder klüglich ignorierten.“41
Er reklamierte im Gegensatz dazu für sich selbst Objektivität bei der Aufbereitung der historischen Zusammenhänge42 und versuchte das anhand von ausgewogenen Einschätzungen zu Detailfragen auch plausibel zu machen, indem er zum Beispiel Vor- und Nachteile der durch Joseph II. (1741—1790) angestoßenen Generalseminarienpolitik vor Augen führte. Er hielt seinen Kontrahenten auf dieser Grundlage entgegen, dass „[d]ie Aufklärung … ihr gerüttelt Maß von Fehlern [hat]; aber so abgrundtief schlecht, wie man sie gemacht hat, ist sie nicht gewesen.“43
Die Gegenthese: Aufklärungssympathie und Rechtgläubigkeit sind unvereinbar
Die ‚Berliner Rede‘ rief die mit dem Verriss konfronierten und insoweit auch der allgemeinen Belustigung preisgegebenen Fachvertreter erwartungsgemäß sofort auf die Barrikaden. Es kam Sägmüller und seinen Mitbloßgestellten dabei der Umstand zu Hilfe, dass Merkle im Interesse, sich strikt an die Tatsachen zu halten, von diplomatischen Rücksichtnahmen allgemein nichts hielt und es sich überhaupt zur Regel gemacht hatte, in der Sache und in der Form bis an die Grenzen des Vertretbaren zu gehen.44 Er selbst verwirklichte damit das „Hauptanliegen“45, die Denkgewohnheiten und -verbote im Fach Kirchengeschichte noch einmal der schonungslosen Metakritik zu unterziehen und die Ideologielastigkeit darin ans Licht zu bringen – wissenschaftliche und kirchenoffiziöse Gruppierungen fühlten sich im denunziatorischen Klima der Modernismuskrise46 dadurch wiederholt zu Anzeigen wegen Unkirchlichkeit und der Strafandrohung mit dem Index herausgefordert.47 Das Provokationspotential der ‚Berliner Rede“ lag also auf der Hand. Indem sie geschichtswissenschaftliche Neutralität gegenüber der Aufklärung einklagte, weckte sie gleichzeitig massive Ängste vor der Rehabilitierung einer kirchlich gesehen „missliebigen Epoche“48, der nach dem im Katholizismus verbreiteten Bild unausräumbare Fehler anhafteten: Anerkennung der staatlichen Vorrangstellung gegenüber der (Papst-)Kirche, liberale Haltung der Konfessionen untereinander und dekadenter Lebensstil.49
Die von Merkle nach dem Urteil der düpierten Kollegen „in seiner bekannten Art unter dem Hohnlachen seiner Berliner Zuhörerschaft“50 platzierten Invektiven lösten als erstes bei Rösch den Gegenschlag aus. Er meldete sich 1909 mit einem 180 Seiten starken Memorandum51 zu Wort: Der Einleitungsteil dokumentiert – anscheinend um Objektivität zu signalisieren, aber auch von tendenziös-kommentierenden Passagen durchsetzt – zuerst das Presseecho auf die ‚Berliner Rede‘, zum Beispiel in der ‚Vossischen Zeitung‘ und in der ‚Germania‘. Der gleiche Zweck wird hinter dem nachfolgenden Abdruck des Schlagabtauschs sichtbar, den sich Rösch und Merkle im weiteren Verlauf in der ‚Allgemeinen Rundschau‘ geliefert hatten, nämlich den Nachweis zu führen, dass der Verfasser zur neutralen Berichterstattung, die entgegengesetzte Meinungen nicht einfach ausblendet, natürlich fähig ist. Der Rest des Buchs arbeitet mit einer Isolationsstrategie. Nachdem Rösch einmal seine Auffassung zum Ausdruck gebracht hat, dass Aufklärungsgegnerschaft nicht heißen muss, dass man methodisch unsauber arbeitet, bringen die darauffolgenden Passagen keine neuen Sachargumente, sondern rekapitulieren die auf der Linie der Amtskirche liegende und von der überwältigenden Mehrheit der traditionell eingestellten Autoren gehaltene Position. Das Ziel ist offensichtlich, jetzt Merkle als denjenigen dastehen zu lassen, der versucht, mit billigen Publikumseffekten die behauptete Wissenschaftlichkeit seiner Kontrahenten zu untergraben.52
Sägmüller – „ein schwäbisches Original, das an Schrulligkeit, Eigensinn und entschieden kirchlichem Standpunkt wohl kaum zu übertreffen war“53 – legte mit einer 1910 erschienenen Replik54 eine härtere Gangart an den Tag. Der 100 Seiten umfassende Text enthält fünf Teile. Die Einleitungsparagraphen reformulieren hauptsächlich die allgemein verbreiteten Argumente der Aufklärungskritik. Sägmüller rechnet in den darauffolgenden Abschnitten dann selber mit dem ‚ungläubigen Rationalismus‘ an den katholischen Fakultäten im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert ab, indem er im ersten Anlauf zehn Wirkungsstätten der ‚Aufklärer‘ inklusive kompromittierender Skizzen zu mehr als dreißig Einzelpersonen portraitiert.55 Der zweite Schritt setzt das Material, das angeblich den „offenbarungsfeindlichen Charakter der Theologie [der Aufklärung; M. L.] im allgemeinen und der theologischen Disziplinen im einzelnen“56 evident macht, gegen Merkle ein und belegt eindrücklich, dass Sägmüller das Postulat der ‚objektiven‘ Quellenforschung für nichts anderes hielt als ein scheinheiliges Täuschungsmanöver. Er unterstellt Merkle, geschichtliche Ereignisse, die nach seiner eigenen Überzeugung ein für allemal der Gefährdung für Glaube und Kirche überführt worden waren, im Nachhinein zu verharmlosen und durch Herauskehren von Nebensächlichkeiten von den sachlichen Konfliktpunkten abzulenken: „[Als] würde es sich … bloß um einen Kampf um die wissenschaftliche Methode in der Theologie [gehandelt haben], um einen Kampf zwischen der veralteten und verrotteten scholastischen und der neu heraufziehenden historischen Betriebsweise in der Glaubenswissenschaft. Wir müssen … eine solche Darstellung und Auffassung des Wesens der kirchlichen Aufklärung als oberflächlich und als wesentlich falsch bezeichnen.“57
Der springende Punkt an dieser Position besteht nicht darin, in der von Merkle aufgezeigten Problemstellung anderer Meinung zu sein, sondern sie mithilfe der Behauptung auszuhebeln, der ganze Vorstoß sei subversiv. Weil sich Sägmüller zufolge nämlich das, was Aufklärung eigentlich ausmacht, an ihrem Verhältnis zu den amtskirchlich attestierten Glaubensinhalten entscheidet und mit der Feststellung ihrer Offenbarungsunverträglichkeit di...