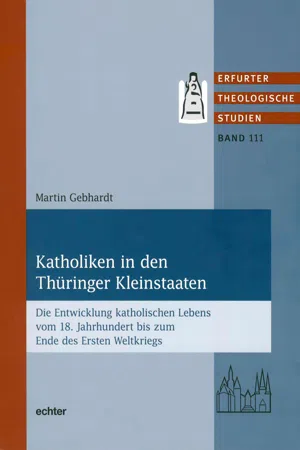![]()
B. KATHOLISCHES LEBEN IN DEN THÜRINGER KLEINSTAATEN
I. Sächsische Herzogtümer
1. Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
Das im Zuge des Wiener Kongresses zum Großherzogtum erhobene Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach1, kurz: Großherzogtum Sachsen, nahm eine Führungsposition unter den Thüringer Kleinstaaten seit Ende des 18. Jahrhunderts ein. Sowohl politisch als auch kulturell war das Großherzogtum seitdem maßgebend. Geographisch lassen sich drei größere Landesteile unterscheiden, so um die Residenzstadt Weimar, um Neustadt/Orla und im Westen Thüringens um Eisenach mit den Gebieten der thüringischen Rhön. Letzterer Landesteil bildete bis 1741 ein eigenständiges ernestinisches Herzogtum. Nach dem Wiener Kongress vergrößerte sich das Staatsgebiet, und auch die Zahl der Katholiken nahm zu, insbesondere dadurch, dass Teile der katholischen Rhön an den neuumschriebenen Staat fielen.2 Die Rhön war zu großen Teilen katholisch geprägt, da sie bis zur Säkularisation im Jahr 1802 territorial der Fürstabtei Fulda zugehörig war.3
Das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach war mit 3.600 km2 der größte souveräne Kleinstaat in Thüringen. Im Jahr 1910 ergab eine Bevölkerungszählung, dass unter 417.149 Einwohnern 19.980 Katholiken lebten.4 Diese vermeintlich große Zahl ergab sich jedoch insbesondere durch den katholischen Bevölkerungsanteil der Rhön. Außerhalb dieses Landstriches galten für die katholische Kirche seit der Reformation deutliche Diasporaverhältnisse im Gebiet des Großherzogtums: 393.774 Personen waren evangelisch-lutherisch.5
1.1 Die katholische Gemeinde Weimar-Jena
Erste katholische Gottesdienste fanden im Jenaer Schloss6 in den Jahren 1662-1682 regelmäßig statt. Diese Heiligen Messen wurden privat für die angeheiratete französische Herzogin, Marie Charlotte de la Tremouille (1632-1682), gehalten.7 Berichtet wird zudem von einigen italienischen Kaufleuten, die durch den Halberstädter Franziskanerpater Heinrich Zumkley ab 1722 sporadisch betreut wurden.8
Weitere Katholiken fanden sich im Bereich der Militärpastoral. Herzog Ernst August (1688-1748, reg. 1707-1748) schuf ein stehendes Heer, das die finanziellen Verhältnisse des Herzogtums überforderte.9 Dafür angeworbene Soldaten waren zum Teil katholisch. Der nächstgelegene Gottesdienstort für sie war Erfurt und lag somit außerhalb des Herzogtums. Nicht wenige Soldaten sollen die Möglichkeit des Kirchgangs zur Desertion genutzt haben und mit „…Sattel und Zeugs durchgegangen sein…“10. Somit war es eine Gegenreaktion des Herzogs, als er 1734 katholische Gottesdienste für seine Soldaten anordnete.11 Er erreichte damit, gegen den heftigen Widerstand der Landstände, die diese Toleranz gegenüber Katholiken nicht billigen wollten, dass die Soldaten auch für den Kirchgang an Weimar gebunden blieben.12 Für diese Gottesdienste reisten fortan katholische Geistliche aus Erfurt nach Weimar – namentlich bekannt ist hierfür der Benediktinerpater und Philosophieprofessor Erhard Grant vom Schottenkloster in Erfurt.13 Weitere Messen wurden von Benediktinern des Petersklosters Erfurt zelebriert. Zum Gottesdienstort wurde 1736 das Jägerhaus bestimmt in welchem nun an Festtagen heilige Messen, vor allem für französisch-stämmige Gardereiter, gefeiert wurden.14 Außerhalb Weimars fanden keine katholischen Gottesdienste statt. Nachweisbar ist jedoch, dass im nördlich von Weimar gelegenen Buttstädt 1757 französischstämmige Militärs um die Nutzung der Stadtkirche für den katholischen Gottesdienst baten, was das Oberkonsistorium in Weimar ablehnte.15
Bis zu seinem Tod im Jahr 1774 feierte Pater Bernhard Grant die katholischen Gottesdienste in Weimar. Herzogin Anna Amalia (1739-1807) bestätigte nicht nur die Nachfolge durch den Benediktinerpater Bernhard16, sondern auch die Nutzung des Jägerhauses für den katholischen Gottesdienst.17
Die Anfänge der späteren Pfarrei sind dennoch in Jena zu suchen. Schon Pater Erhard Grant war durch Krankenbesuche, mit entsprechender Sakramentenspendung, in Jena tätig.18 Die Wiederzulassung von katholischen Gemeindegottesdiensten steht jedoch im Zusammenhang mit der Universität Jena. Diesbezüglich wird schon 1750 der Augustinerpater Anton Jacob Maximilian Gerold de Lay erwähnt.19
Jena als Universitätsstadt zog Studierende und Professoren aus den verschiedensten Herkunftsorten an. Damit kamen auch Katholiken in die Stadt, die bei der Universität Beschwerde einlegten, da sie ihre Sonntagspflicht erfüllen wollten und ihnen dafür der Weg nach Erfurt zu weit war.20 Über den Grafen Carl Maria Ludwig von Coudenhoven, der als Katholik ab 1783 in Jena studierte, bemühte sich die Universität einen geeigneten Seelsorger zu finden.21 Es waren einzelne Universitätsprofessoren, die sich des Anliegens annahmen und es an offizieller, d.h. vor staatlicher und kirchlicher Stelle vertraten. Prof. Christian Loder, Lehrer für Medizin und Geheimer Rat, wandte sich diesbezüglich an den Kurmainzer Geistlichen Rat Hieronymus Kolborn. Loder scheint zu diesem Zeitpunkt eine Art Vermittlerrolle gespielt zu haben,22 angetrieben durch den Vorschlag seines Freundes, des Geistlichen Rats Oberthür aus Würzburg.23 Maßgeblich für sein Handeln scheint seine innere Überzeugung gewesen zu sein, die im Geist der Aufklärung ein positives Bild von konfessioneller Toleranz hochhielt: „Ich schmeichle mir nämlich, dass das Beispiel einer Akademie, die, seit ihrer Errichtung, sich durch ihren Eifer für den Protestantismus ausgezeichnet hat, etwas dazu beitragen wird, die Grundsätze einer vernünftigen Toleranz zur Ehre der Aufklärung unseres Zeitalters in Deutschland zu verbreiten; und in dieser Rücksicht wird es mir wirklich überaus angenehm sein, wenn meine Bemühung mit einem glücklichen Erfolg begleitet werden sollte.“24 In diesem Sinn soll, nach Loders Angaben, auch der Herzog reagiert haben: „Se. Durchl. bezeigten nicht allein über diesen Vorschlag Ihre vollkommene Zufriedenheit, sondern gaben mir auch zu erkennen, dass Sie von Ihrer Seite der hier zu errichtenden Anstalt auf eine tätige Weise beförderlich sein wollten.“25
Über das Erzbistum Mainz konnte dann im Februar 1791 ein Priester namens Adam Georg Ruppert gewonnen werden.26 Die Fragen nach seinem Unterhalt und dem ihm zukommenden Vergütungen blieben jedoch ungeklärt. Die finanzielle Basis für den katholischen Geistlichen war so miserabel, dass ein Leben in Jena nicht möglich war. Kaum etwas war vorbereitet. Kolborn schob die Schuldfrage allerdings auf das Herzogtum und auch auf den Geistlichen selbst, der vorschnell gehandelt hat und zu früh nach Jena gegangen sei.27 Schon im Herbst selben Jahres verließ Ruppert die Stadt.
Obwohl der erste Versuch ein Fehlschlag war, bemühte sich die Universität weiterhin, das Problem der katholischen Seelsorge zu lösen. Über Herzog Carl August wurden 1794 weitere Bestrebungen angeschoben. Bedingt durch die politischen Verhältnisse, residierten der Mainzer Erzbischof und sein Generalvikariat in Aschaffenburg. Der Erzbischof von Mainz, Karl Joseph von Erthal (1719-1802), entsprach der Bitte des Herzogs im Frühjahr 1795 und schickte einen französischen Priester nach Jena.28 Es handelte sich um Gabriel Henry (1752-1835)29, der, wie viele weitere französische Geistliche aus seiner Heimat in Folge der Französischen Revolution fliehen musste, da er den geforderten Eid auf die Zivilkonstitution des Klerus verweigerte.30
Henry wurde erster ständiger Seelsorger der Jenaer Katholiken, besonders der Studentenschaft, für die er ab Februar 1802 im Jenaer Schloss Gottesdienst hielt.31 Unter knapp 4.000 Einwohnern lebten 69 katholische Christen, die hauptsächlich Universitätsangehörige waren.32 Trotz der immer noch nicht vollständig gelösten Finanzierungsprobleme33, blieb Henry in Jena, obwohl nach 1802 eine Rückkehr nach Frankreich möglich gewesen wäre, die ihm die Position eines Generalvikars und Domherren erschlossen hätte.34 Zudem wirkte er als Französischlehrer an der Universität. Zu einer festen Berufung kam es aber, vermutlich aus persönlichem Widerstand Goethes, zunächst nicht.35
Mit den Ereignissen des Jahres 1806 veränderte sich auch die Situation in Jena, „…als plötzlich das Kriegstheater sich bis über unsere Berge hinzog und der Sache eine ganz andere Wendung zu geben anfing.“36 Nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt (14. Oktober 1806) fiel die Stadt unter französische Herrschaft. Dabei kam Gabriel Henry als französischem, katholischem Geistlichen eine besondere Position zu, die ihn bis in höchste französisch-kaiserliche Kreise, aber dadurch nicht selten auch in Zwangslagen brachte. Er selbst war es, der die Ereignisse der Tage der Schlacht von Jena und Auerstedt dokumentierte.37 Sein Bericht galt Herzog Carl August, dem er seine Loyalität bezeugte, die jedoch aufgrund seiner Verbindung zu Napoleon immer wieder angefragt wurde.38 So wurde er schon kurz nach dem fr...