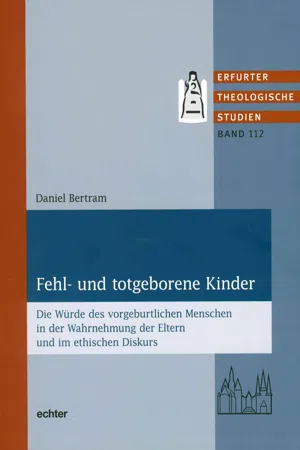![]()
1. STATUS UND WERT DES VORGEBURTLICHEN MENSCHEN UND DER UMGANG MIT FEHL- UND TOTGEBORENEN ZU ZEITEN DES GETEILTEN UND WIEDERVEREINIGTEN DEUTSCHLANDS
Eltern erfahren sich durch ihre Kinder schon in der Schwangerschaft unbedingt beansprucht. Es ist genau diese Erfahrung der Beanspruchung, welche den Ausgangspunkt jeder wirklich angemessenen und ethisch verantwortlichen Beschreibung des Status des vorgeburtlichen Menschen ausmacht. Denn was sonst als die wirkliche lebensmäßige Erfahrung könnte eine Hilfe sein, um dem Geheimnis des Menschen in dieser frühen Zeit auf die Spur zu kommen? Die vorliegende Untersuchung will deshalb versuchen, genau diesen Erfahrungskontext aufzuspüren und zu beschreiben. Sie versucht es – vor aller Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Theologie in philosophischen Theoremen, fachlichen Kontroversen und spezialisierten Kommentaren – durch die Beschreibung der Ausdrucksweisen und Sprachformen, mit denen die Gesellschaft selbst die Wirklichkeit des Menschen in der Schwangerschaft in Worte fasst. Dabei ist es eine Art negativer Hermeneutik, die hier als Ansatzpunkt gewählt wird: Im Spiegel der glücklosen Schwangerschaft, dort, wo Kinder vor der Geburt sterben müssen, soll die eigene Sensibilität im Umgang mit dem Status des vorgeburtlichen Menschen erfasst werden. Das heißt: Jenseits voraussetzungsreicher Gegensätze – etwa wenn es um Rechte der Mutter und des Kindes im Schwangerschaftskonflikt und bei der Abtreibung geht – jenseits auch von entwicklungsbiologischen oder entwicklungspsychologischen Wissensständen und Vermutungen – etwa zum vorgeburtlichen Empfinden des Kindes, seiner körperlichen und psychischen, der geistigen Reife – muss das Faktum der existenziellen Realität des Kindes gerade im Paradox seines Verlustes, seiner Nichtigkeit, eben seines Todes, der es in die Nichtexistenz, Gegenständlichkeit bloßer biologischer Materie abzudrängen droht, anschaulich werden.
Nachfolgend soll gezeigt werden, dass der Kontrast zwischen der materialistisch-sozialistischen Beschreibung von Fehl- und Totgeburt auf der einen Seite und der durch das Erleben von Eltern veränderte rechtliche Rahmen des Personenstandsrechts in der Bundesrepublik auf der anderen diesen Ansatzpunkt der theologisch-ethischen Hermeneutik des vorgeburtlichen Menschen zugänglich macht.
1.1 Der vorgeburtliche Mensch? Theorie und Praxis in der ehemaligen DDR
Das Nachdenken über den Status des vorgeburtlichen Menschen setzte in der DDR erst spät, im Kontext des Erlassens des „Gesetzes über die Unterbrechung der Schwangerschaft“ 1972, ein. Heute finden sich nur noch wenige Publikationen, in denen sich, ausnahmslos regierungsnahe, wichtige Personen des Gesundheitssystems der DDR zu diesem Thema äußern. Es gibt keine Hinweise auf einen größeren, öffentlichen Diskurs; dabei gab es bereits elf Jahre vor diesem Gesetz eine eminent wichtige Änderung: Die (Neu-)Definition von „Lebendgeburt“, „Totgeburt“ und „Fehlgeburt“ bzw. von „Mensch“ und „Abort“.
1.1.1 Zur Ausgangslage: Definition von „Lebendgeburt“, „Totgeburt “ und „Fehlgeburt“ 1961
Seit 1938 galt in der DDR wie auch in der Bundesrepublik eine Definition von „Lebendgeburt“, wonach von einer solchen zu sprechen ist, wenn das Kind postnatal natürlich atmete. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legte allen Staatsregierungen 1950 nahe, von einer „Lebendgeburt“ zu sprechen, wenn mindestens eines der Lebensmerkmale: natürliche Lungenatmung, Herzschlag, Pulsation der Nabelschnur und/oder Muskelbewegung bei dem Neugeborenen feststellbar war. Die Bundesrepublik änderte die gesetzliche Definition von „Lebendgeburt“, indem sie die ersten drei Lebensmerkmale in eine Alternativregelung übernahm; eine Muskelbewegung, so der Gesetzgeber, kann auch willkürlich sein und wurde nicht als sicheres Lebenszeichen verstanden (siehe 1.2.1). Auch in der DDR reichte ein Lebenszeichen aus, um das Kind als „Lebendgeburt“ zu klassifizieren. Mit der Neufassung der „Anordnung über die ärztliche Leichenschau“ (LSchAO) von 1961 wurde die Regelung jedoch überraschend zu einer Kumulativregelung geändert; fortan musste das Kind zwei Lebenszeichen, nicht irgendwelche, sondern vom Gesetzgeber festgelegte, Lungenatmung und Herzschlag, aufweisen, um als Lebendgeborenes zu gelten.3
Man kann nun mit Stephan Mallik die Frage stellen, wie es dazu kam. Der Analyse bietet sich ein komplexes Bild: Ab 1950 gewährte die DDR Müttern ab der dritten Geburt finanzielle Hilfe, die 1958 aufgestockt und von nun an bereits ab der ersten Geburt gezahlt wurde. Anspruchsgrundlage war die „Geburt“ eines Kindes, was nicht nur die Lebendgeborenen einschließt. Dies war zwar intendiert, scheiterte aber in der praktischen Umsetzung daran, dass es keine offizielle Definition von der „Geburt“ (als Anspruchsgrundlage) gab und so Partikularregelungen galten, die sich, dem Gesundheitsministerium der DDR im September 1961 zu Folge, „[…] sowohl für den Staatshaushalt der DDR als auch für die Statistik nachteilig auswirkten.“4 Für 1962 war in der DDR eine Neuauflage der Totenscheine vorgesehen. Dies nahm man zum Anlass, die LSchAO mit der Zielsetzung einer gesetzlichen Definition und Differenzierung von „Fehl-, Tod- und Lebendgeburten“ zu überarbeiten. Die offizielle Begründung des stellvertretenden Gesundheitsministers Marcusson war das Erreichen einer besseren Auswertbarkeit der Totenscheine in Bezug auf die Todesursache, getrennt für Kinder, die im ersten Lebensjahr verstarben und Kinder, die später5 verstarben.6
Bereits der erste Entwurf enthielt eine Zwei-Lebenszeichen-Regelung und den Vorschlag zur Senkung der Mindestkörperlänge auf dreißig Zentimeter, um Fehlund Totgeburten zu unterscheiden. Mit der Zwei-Lebenszeichen-Regelung wies man so den Vorschlag der WHO (ein Lebenszeichen) als zu unsicher zurück; es reiche nicht aus, einen Herzschlag ohne Atmung oder eine Atmung ohne Herzschlag festzustellen, um das Kind als Lebendgeborenes zu bezeichnen, da nur beide Lebenszeichen zusammen das Leben ermöglichten7. Ferner dürfe, in Bezug auf die Lebenszeichen, nicht nur der Zeitpunkt der Geburt berücksichtigt werden, geht es doch um eine dauerhafte Lebensfähigkeit. Auf eine, in anderen Ländern übliche, Formulierung, nach der das Kind mindestens vierundzwanzig Stunden überleben müsse um als Lebendgeborenes zu gelten, verzichtete man jedoch ebenso wie auf eine Mindestgröße oder ein Mindestgewicht für Lebendgeburten. Im finalen Entwurf der LSchAO vom November 1961 fand sich dann oben genannte Zwei-Lebenszeichen-Regelung. Die Körpergröße zur Abgrenzung von Fehl- und Totgeburt beließ man bei fünfunddreißig Zentimetern, so dass sich, kurz darauf gesetzlich festgeschrieben, folgende Einteilung ergab:
Lagen bei der Geburt Atmung und Herzschlag als Lebenszeichen beim Neugeborenen vor, galt es als „Lebendgeburt“, unabhängig von Größe und Gewicht. Besaß das Kind keines oder nur eines der beiden Lebenszeichen, wies aber eine Körperlänge von mindestens fünfunddreißig Zentimetern auf, wurde es als „Totgeburt“ registriert. Wies das Kind keines oder nur eines der beiden Lebenszeichen auf und war dabei kleiner als fünfunddreißig Zentimeter, galt es als nichtregisterpflichtige „abortierte Frucht“ bzw. „Fehlgeburt“. Die Fünfunddreißig-Zentimeter-Grenze wurde 1978 durch eine 1000-Gramm-Grenze ersetzt. Bei einer Totgeburt und einer nach der Geburt verstorbenen Lebendgeburt handelte es sich nach dem Gesetz ferner um eine menschliche Leiche. Das Fehlgeborene galt nach dem Gesetz nicht als menschliche Leiche.8
Diese Neufassung wirft einige Fragen auf: Was geschah mit den Kindern, die ein Lebenszeichen aufwiesen? Wurden sie dem Tod überlassen? Warum hat man es mit der Neudefinition so viel schwieriger gemacht, als „Lebendgeburt“ zu gelten?
Zur Klärung der Motivation ist zunächst zu untersuchen, was oben bereits angedeutet wurde – der Einfluss der Kostenfrage. Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, dass die Ausgaben im Rahmen der der finanziellen Unterstützung von Familien, Müttern und gezielter Geburtenhilfe in der DDR stetig stiegen – im Zeitraum von 1957 bis 1961 auf insgesamt 160 Millionen Mark. In der Analyse des Staatshaushaltsplans des Finanzministeriums wird ausdrücklich die staatlich gewährte Geburtenhilfe, nur eine von vielen Leistungen, als Grund für „Planüberschreitungen des Sozialwesens“ identifiziert9.
Die „staatliche Geburtenbeihilfe“ war eine finanzielle Beihilfe, die vom Jahr 1950 an gewährt wurde. Zunächst war ab dem dritten Kind eine Unterstützung in Höhe von 100 Mark vorgesehen. 1958 wurde der auf 500 Mark erhöhte Betrag bereits von der Geburt des ersten Kindes an ausgezahlt. 1972 stockte man diesen Betrag noch einmal auf 1000 Mark auf. Die Zahlung erfolgte in Raten; den Betrag von 1000 Mark zu Grunde legend stellte es sich so dar: Bei der Vorstellung der Schwangeren innerhalb der ersten sechzehn Wochen waren 100 Mark fällig. Mit der zweiten Vorstellung in der Schwangerenberatungsstelle wurden noch einmal 50 Mark ausgezahlt. Für den Nachweis der Geburt erhielt die Mutter 750 Mark; bis zu diesem Zeitpunkt zusammen 900 von insgesamt 1000 Mark. Stellte sich die Mutter postnatal noch viermal in den ersten vier Lebensmonaten in der zuständigen Mütterberatungsstelle vor, bekam sie dafür jeweils weitere 25 Mark, also insgesamt noch einmal 100 Mark. Steht am Ende der Schwangerschaft eine Fehlgeburt, nach Definition der DDR, so erhielt die Mutter dennoch 150 Mark – dies entspricht den beiden ersten Raten. Bei einer Totgeburt und bei einer Lebendgeburt wurde der volle Betrag ausgezahlt (bei einer Totgeburt wurde der gesamte Restbetrag als Einmalzahlung zur Verfügung gestellt).10
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel im Hinblick auf die Frage nach den Kosten ist die „Verordnung über die Gewährung von Krediten zu vergünstigten Bedingungen an junge Eheleute“. Im fünften Paragraphen ist geregelt, dass eben diesen jungen Eheleuten bei der Geburt eines oder mehrerer Kinder ein teilweiser Krediterlass (mindestens 1000 Mark) zu Gute kommt. Ohne Festlegung, dass mit „Geburt“ eine „Lebendgeburt“ gemeint ist und ohne Definition, was eine „Lebendgeburt“ kennzeichnet, würde der Staatshaushalt, so das Ministerium für Gesundheit, an dieser Stelle unnötig belastet, da er den Eheleuten auch dann einen finanziellen Vorteil verschaffen würde, wenn diese, bei einer Fehl- oder Totgeburt, gar kein Kind großzuziehen und zu versorgen hätten.11
Im Übrigen führte das Gesundheitsministerium das „Kostenproblem“ auf die eigenen Mitarbeiter zur...