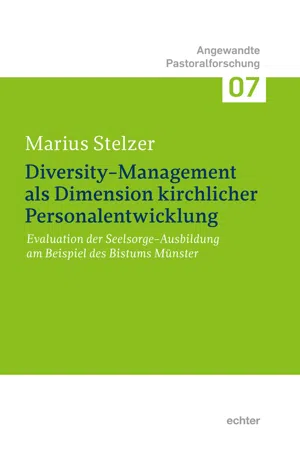![]()
Menschliche Reife: Persönlichkeitsentwicklung und (Homo-)Sexualität
Abstract: Das Themenfeld „Sexualität, Kirche und kirchliche Berufe“ wird im Lauf der Geschichte der kirchlichen Professionsforschung unterschiedlich intensiv betrachtet. Die qualitativen Interviews in unserer Studie zeigen, dass vor allem das Thema Homosexualität in der Ausbildung von Seelsorgenden, besonders mit Blick auf die Priesterausbildung, eine essentielle Rolle spielt und daher besondere Beachtung verdient. Der hier vorliegende Artikel beinhaltet zwei Schwerpunkten. In einem ersten Teil zeigt der Beitrag den gegenwärtigen Erkenntnisstand der humanwissenschaftlich-epigenetischen Forschung zum Phänomen „Homosexualität“ auf. In einem zweiten Teil werden die qualitativen Befunde aus den Interviews mit Blick auf die jeweilige Berufungsbiografie und mit Blick auf kirchliche Unternehmenskultur, wie sie exemplarisch in der Ausbildungskultur sichtbar wird, dargestellt und analysiert.
Einleitung: Kirche und Sexualität
Das Themenfeld „Sexualität, Kirche und kirchliche Berufe“ ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder in den Mittelpunkt der kirchlichtheologischen Diskurse gerückt.
„Die katholische Kirche hat sich in vielfacher Weise zu Fragen der Sexualität geäußert. In ihren sozialethischen Rundschreiben der letzten Jahrzehnte bekundet sie durchaus eine Offenheit für progressive Wege; im Bereich der individuellen Sexualmoral jedoch scheint sie eher eine idealistische, von der Realität abgehobene menschenferne Position zu beziehen“1
schreibt der Moraltheologe Johannes Gründel Mitte der 1990er Jahre.
„Dabei steht das Thema Homosexualität in der Ethik in besonderer Weise zur Diskussion. Angesichts der vielschichtigen möglichen Ursprünge einer homosexuellen Ausrichtung bedarf es einer neuen, differenzierten Bewertung.“2
Mit Blick auf die Geschichte der christlichen Sexualmoral schreibt Gründel, dass der biologische Akzent menschlicher Sexualität insgesamt zu stark betont wurde, der personale Gehalt als der eigentlich wertende Faktor aber zu kurz kommt. Biologische Gegebenheiten sind vielfach der Maßstab sittlicher Wertungen; gleichwohl muss, so Gründel, der eigenverantwortlichen kulturellen Formung und Gestaltung der eigenen Sexualität Raum gegeben werden:
„Dem Menschen ist nach allgemeinem und auch christlichem Verständnis die kulturelle Formung und Gestaltung der Naturgegebenheiten als ethische Aufgabe zugewiesen. Dies bedeutet, daß er auch die ihm zukommende Sexualität zuinnerst anzunehmen und zu formen, d.h. im Rahmen personaler Beziehungen entsprechend ‚human’ zu gestalten hat. Für die sittliche Bewertung solcher Beziehungen spielen die zugrundeliegenden personalen Beziehungen zwar nicht die einzige, aber doch eine entscheidende Rolle.“3
Die deutsche Seelsorgestudie stellt fest, dass hinsichtlich des Verzichts auf Sexualität, der Zölibat mehrheitlich positiv gesehen wird, gleichwohl ein Viertel der befragten Priester die zölibatäre Lebensform nicht wieder wählen würden und knapp ein Drittel der Priester im Umgang mit dem Zölibat bzw. Verzicht auf Sexualität Probleme hat.4 Der Verzicht auf Sexualität stellt aber für mehr als die Hälfte der befragten Priester eine große Herausforderung dar. Der renommierte Pastoralpsychologe und Psychotherapeut Wunibald Müller beschreibt, dass die Gefahr seelischer Erkrankung im Zuge des Verzichts auf genitale Sexualität darin besteht,
„…wenn jemand für eine lange Zeit oder gar ein Leben lang auf die Erfahrung von Intimität verzichten muss. Für den Priester ist es daher wichtig, nicht nur Beziehungen in seiner Pfarrei zu unterhalten, sondern auch in innigen Beziehungen zu Männern und Frauen zu stehen, die ihn herausfordern, in denen er so sein darf, wie er ist, in denen er auch die Möglichkeit hat, in seiner Beziehungs- und Intimtitätsfähigkeit zu wachsen und sich verwundbar zu machen. Das gilt für den heterosexuellen wie für den homosexuellen Priester. Sie sollten eine mit ihrem Amt und ihrem Auftrag in Einklang zu bringende legitime Form von Intimität erfahren und eine Lebenskultur entwickeln, die dazu beiträgt, dass diese Erfahrung von Intimität sich segensreich für ihren Dienst und ihre zölibatäre Lebensform auswirkt.“5
Kirche und Homosexualität
Dass das Thema Homosexualität gegenwärtig in der Personalentwicklung von Seelsorgenden eine wichtige Rolle spielt, zeigt exemplarisch eine aktuelle Publikation von Gerhard Schneider, in der er die Institution des Priesterseminars in den Blick nimmt und auf die Tauglichkeit für die Priesterbildung hin befragt. Das Themenfeld Homosexualität gerät dabei vor allem vor dem Hintergrund des sozialen Systems des Seminars an sich und vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals 2010 (der die gesamte Dekade andauern wird) in den Focus seiner Darstellungen.6
In zahlreichen Interviews und Darstellungen reflektiert Wunibald Müller seine Erfahrungen, die er in der therapeutischen Begleitung zahlreicher Seelsorgender im Recollectio-Haus der Benediktinerabtei Münsterschwarzach gemacht hat. Seine Reflexionen beziehen sich vielfach auf die Dynamik von Sexualität/Intimität und Zölibat, aber auch die Frage nach dem Spannungsfeld von Sexualität bzw. Homosexualität und Kirche bzw. kirchliche Berufe.7
Im Mittelpunkt der beiden von Papst Franziskus einberufenen Bischofssynoden 2014 und 2015 im Vatikan stand das Thema „Ehe und Familie“. Der Themenbereich Sexualität/Homosexualität bildete dabei ein Unterthema der synodalen Beratungen. Im Kontext der ersten synodalen Beratungsperiode erschien im Herbst 2014 ein Sonderheft der Herder-Korrespondenz, in dem verschiedene Autoren aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Disziplin auf das Themenfeld „Kirche und Sexualität“ schauen. Hervorzuheben ist hierbei der Beitrag des Mainzer Moraltheologen Stephan Goertz, der für einen Perspektivwechsel in der Beurteilung von Homosexualität plädiert.8 Ähnlich wie zuvor Gründel zeichnet Goertz biblisch-theologische und lehramtliche Perspektiven in der Wahrnehmung und Beurteilung von Homosexualität nach und überprüft diese aus moraltheologischer Sicht. Dabei spielt die Kontextualisierung auf die Gegenwart eine bedeutende Rolle, nämlich hinsichtlich des Verständnisses von Liebe und Liebesbeziehung, die in der Sexualität ihre Sinnerfüllung finden – nicht nur in der Zeugung von Nachwuchs. Diese Argumentation klingt bei Gründel zwanzig Jahre zuvor schon an, nämlich die Unterscheidung von Liebe und Sexualität zwecks Zeugung von Nachkommenschaft und der Gestaltung einer ganzheitlichpersonalen Beziehung.
Für den gesamten Diskurs zum Themenfeld „Homosexualität und Kirche“ ist gegenwärtig die Aufsatzsammlung Goertz’ aus dem Jahr 2015 relevant, in der diese Fragestellung aus exegetischer, humanwissenschaftlicher und theologischethischer Sicht beleuchtet wird.9 Hier scheint ein bedeutender Aufsatzband vorzuliegen, der das Ziel hat, den moraltheologischen Diskurs weiter zu entwickeln. Wunibald Müller zeichnet in einer Buchrezension die wesentlichen Linien der Buchpublikation Goertz’ nach:
Aus exegetischer Sicht wird oftmals ignoriert, in welchem Zusammenhang homosexuelle Handlungen im ersten und zweiten Testament gesehen werden müssen.
„Hier, so stellen sie (die Autoren, MS) fest, ist nicht von Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, die Rede. Die biblischen Autoren kennen nicht unser Verständnis von Homosexualität als eine sexuelle Identität oder Orientierung, die nicht veränderbar ist – und demzufolge verurteilen sie nicht Homosexualität, wie wir sie heute verstehen.“10
Aus humanwissenschaftlicher Perspektive kann „an der Existenz einer biologischen Prädisposition der sexuellen Orientierung, ob heterosexuell oder homosexuell (manche würden auch bisexuell ergänzen), kein vernünftiger Zweifel bestehen.“11
Aus sexualmedizinischer Sicht ist hervorzuheben, dass Homosexualität nicht krankhaft ist. „Homosexuelle Menschen“, so Müller, „leiden nicht an der Ausprägung ihrer sexuellen Orientierung, sondern an den Folgen einer gesellschaftlichen Norm darüber, die die homosexuelle Orientierung als anormal, krankhaft, widernatürlich einstuft.“12
Müller stellt als wesentliche Linie für die ethische Bewertung von Homosexualität heraus, Sexualität insgesamt vor dem Paradigma der Personalinterpretation genitaler Komplementarität, zu betrachten. Das bedeutet, die körperlich-genitale Sexualität in den Kontext der ganzen Person zu setzen und nicht nur im biologisch-physischen Kontext des genitalen Geschlechtsakt (mit dem Ziel der Fortpflanzung bzw. Zeugung von Nachkommen) zu sehen und zu bewerten. Der Begriff „Personale Komplementarität“ umfasst dabei die ganzheitliche Anerkennung, Integration und das Teilen des personalverkörperten Selbst mit einem anderen verkörperten Selbst.13
„Die Verfasser schließen daraus, dass das Urteil, ob ein bestimmter Akt moralisch ist oder nicht, auf der Grundlage seiner Konsequenzen für das menschliche Wohlergehen innerhalb einer bestimmten interpersonalen Beziehung gefällt werden muss.“14
Das Themenfeld Sexualität und Homosexualität in der Professionsforschung
In der sozialwissenschaftlichen Geschichte zur Erforschung von Dienst und Leben der Seelsorgenden spielt das Thema Sexualität als ein wichtiges Vitalitätsthema menschlicher Existenz – auch der Existenz Seelsorgender – keine zentrale Rolle.15
Priesterausbildung in den 1950er Jahren
Jakob Crottogini fragt in den 1950er Jahren für die damaligen Verhältnisse recht klar nach „Eros und Sexus“ als wesentliche Elemente der „Innenwelt“ priesterlicher Existenz.16 Gefragt wurde nach sexuellen Schwierigkeiten im eigenen Leben, darunter Onanie, sexuelle Phantasie, mangelnde Aufklärung, Verhältnis zu Mädchen, Homosexuelle Tendenzen und Ängstlichkeit. Aus den qualitativen Antworten und Kommentaren entwickelt Crottogini folgende Tabelle:
Tabelle 6: Ursachen und Erscheinungsformen der sexuellen Schwierigkeiten in der Crottogini-Studie (ebd. S 149).
Ursachen und Erscheinungsformen der sexuellen Schwierigkeiten | SCHWEIZER | AUSLÄNDER |
abs. | % | abs. | % |
Onanie | 181 | 56,0 | 68 | 51,9 |
Phantasie | 44 | 13,6 | 20 | 15,3 |
Mangelnde Aufklärung | 42 | 13,0 | 19 | 14,5 |
Verhältnis zu Mädchen | 30 | 9,3 | 14 | 10,7 |
Homosexuelle Tendenzen | 14 | 4,4 | 5 | 3,8 |
Ängstlichkeit | 12 | 3.7 | 5 | 3,8 |
Total | 323 | 100,0 | 131 | 100,0 |
Die von Crottogin...