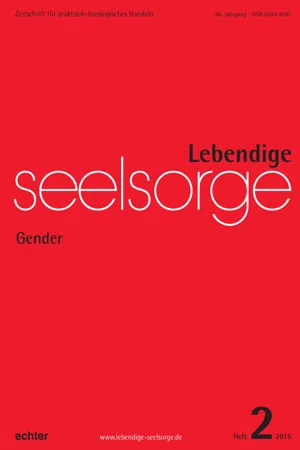![]()
Geschlechtersensibilität und kirchliche Engagementförderung
6,9% der deutschen Bevölkerung sind im Bereich „Kirche und Religion“ ehrenamtlich engagiert (Freiwilligensurvey 2009), Männer und Frauen jeden Alters, mit unterschiedlichsten biographischen Erfahrungshintergründen und Lebensentwürfen. Was wird sichtbar, wenn kirchliches Ehrenamt unter geschlechtersensibler Perspektive betrachtet wird? Elke Langhammer
Frau V., Anfang 70, ehrenamtlich im caritativen Bereich ihrer Gemeinde tätig, meint: „Wissen Sie, der Pfarrer behandelt mich und die anderen älteren Frauen in unserer Gruppe so, als hätten wir niemals etwas gelernt oder gar einen Beruf ausgeübt.“
Herr B., Anfang 40, engagiert sich ehrenamtlich in der Erstkommunionvorbereitung seines Sohnes. Die Gruppe der ehrenamtlichen KatechetInnen ist mehrheitlich weiblich. Auch Herr B. und ein weiterer Vater werden – während der gesamten Vorbereitungszeit – konsequent als „Tischmütter“ bezeichnet.
Zwei Vignetten, Alltagsbeobachtungen aus dem weiten Feld kirchlichen ehrenamtlichen Engagements.
Frau V. fühlt sich in ihrem Wissen und in ihrer Kompetenz nicht gesehen; sie rekurriert im Erzählen ausdrücklich auf berufliche Qualifikation und Erwerbstätigkeit. Neben dem Faktor „Geschlecht“ sind es wohl auch die Faktoren „Alter“ und „freiwillige, unentgeltliche Tätigkeit“, die hier eine Rolle spielen. Im zweiten Fall wollen Männer Elternschaft aktiv leben und sich zudem aktiv an der religiösen Erziehung und kirchlichen Sozialisation ihrer Kinder beteiligen. Sie treffen dabei im Kontext der Erstkommunionvorbereitung auf ein pastorales Feld, das eine klassische Frauendomäne ist. Als „Tischmütter“ werden die beiden Väter sprachlich unsichtbar gemacht.
Was wird sichtbar, wenn kirchliches Ehrenamt unter der Perspektive von Geschlechtersensibilität und Geschlechtergerechtigkeit betrachtet wird? Welche Fragehorizonte und Handlungsperspektiven eröffneten sich dann, wenn die Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen integrales und selbstverständliches Handlungsmuster kirchlicher Engagementförderung wäre?
Meine Überlegungen machen einen Dreischritt: sie blicken zunächst auf den aktuellen offiziellen gesellschaftspolitischen Diskurs zu „Geschlechterdifferenz und freiwilliges Engagement“, wenden sich dann der kirchlichen Engagementförderung zu, um abschließend Fragehorizonte aus der Genderperspektive auf das kirchliche Ehrenamt zu eröffnen.
Dem Gedankengang grundgelegt ist eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise der Genderthematik, die ihr Interesse darauf fokussiert, wie es gelingen kann, eine „gesellschaftliche Form der Generativität herauszubilden, in der Frauen und Männer unterschiedlicher Lebensmuster, auch unterschiedlicher kultureller Prägung sich vorstellen können zu kooperieren, um neuen und weiteren Reichtum an Lebensvielfalt“ und Lebensmöglichkeiten für alle zu ermöglichen (Burbach, 23).
FREIWILLIGENSURVEY UND GLEICHSTELLUNGSBERICHT DER DEUTSCHEN BUNDESREGIERUNG: GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DIFFERENZEN IM FREIWILLIGEN ENGAGEMENT
In der Ausübung freiwilligen Engagements zeigen sich geschlechtsspezifische Differenzen. Nach Angaben des Freiwilligensurveys 2009 sind 32% der Frauen und 40% der Männer in Deutschland freiwillig engagiert. Der Bereich „Kirche/Religion“ ist einer der großen Engagementbereiche: 6,9% der Bevölkerung engagieren sich dort freiwillig.
Bei der Wahrnehmung von zivilgesellschaftlichen ehrenamtlichen Führungspositionen dominieren Männer. Männer engagieren sich im Lebensverlauf deutlich kontinuierlicher als Frauen. In den Lebensverläufen von Frauen zeigen sich sog. „Engagementgipfel“ insbesondere in der Familienphase, aber auch in der frühen Jugend und bei den 65- bis 69-Jährigen. Die thematische Ausrichtung des Engagements differiert erheblich: „Überspitzt kann man es so ausdrücken: Frauen arbeiten mehr am Menschen und Männer mehr an der Sache“ (BMFSFJ 2010, 167). Die Engagementfelder von Männern weisen eine breite Streuung auf und sind in unterschiedlichen Lebensphasen biographisch anschlussfähig; Frauen engagieren sich schwerpunktmäßig in Feldern mit Nähe zum Sozialen und Familialen; zu einem beträchtlichen Teil hat ihr Engagement für Kinder und Jugendliche unmittelbar mit den eigenen Kindern zu tun. Nach der Familienphase fällt Frauen eine neue Orientierung ihres Engagements nicht leicht. „Der mehr oder weniger freiwilligen traditionellen Arbeitsteilung der Geschlechter im Privaten, in der Gesellschaft und im Beruf setzt auch die Zivilgesellschaft kein Alternativmodell entgegen“ (BMFSFJ 2010, 121).
Das Gutachten zum ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung im Jahr 2011 verweist auf „deutlich geschlechtsspezifische Zeitverwendungsmuster für verschiedene Formen von gesellschaftlich notwendiger Arbeit“ (BMFSFJ 2013, 237). Erwerbsarbeit, Hausarbeit, generative Sorgearbeit, freiwilliges Engagement und Nachbarschaftshilfe miteinander zu vereinbaren, stelle insbesondere für Frauen eine große Herausforderung dar. Als politisches Ziel formuliert die ExpertInnenkommission, beiden Geschlechtern zu ermöglichen, neben der Erwerbsarbeit auch andere gesellschaftlich wertvolle und notwendige Formen der Arbeit in ihren Alltag und entlang ihres Lebensverlaufs integrieren zu können. „Um mehr Zeitsouveränität im Alltag und entlang des Lebenslaufs für Frauen und Männer herzustellen, bedarf es […] eines neuen Zeitbewusstseins lokaler Entscheidungsträger“ (BMFSFJ 2013, 244).
AUF DEM WEG ZU EINER NEUEN KULTUR DER AUFMERKSAMKEIT GEGENÜBER DEM EHRENAMT IN DER KIRCHE
Als Organisation verfügt die Kirche über jahrzehntelange Erfahrungen mit Ehrenamtlichkeit. In den letzten Jahren jedoch scheint das Bewusstsein zu wachsen, dass ehrenamtliches Engagement in der Kirche kein Selbstläufer und keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern eine kostbare, knappe „Ressource“ mit großer Bedeutsamkeit für die Zukunftsfähigkeit der Organisation. Damit einhergehend wird die Frage virulent, wie die Kooperation zwischen hauptberuflich Tätigen und ehrenamtlich Engagierten – unter den gegenwärtigen Voraussetzungen einer stark in Veränderung begriffenen pastoralen Basisstruktur – neu ausbalanciert werden kann und muss. „Gesellschaftliche Entwicklungen einerseits und pastorale wie strukturelle Veränderungen innerhalb der Kirche andererseits fordern eine neue Kultur der Aufmerksamkeit gegenüber dem Ehrenamt sowie neue Formen der Kooperation zwischen hauptberuflich und ehrenamtlich Tätigen“ (Rahmenrichtlinien für ehrenamtliches Engagement im Erzbistum Freiburg 2013). Die kirchliche Organisationskultur im Hinblick auf ihren Umgang mit Ehrenamtlichkeit und freiwilligem Engagement zu überdenken, neu zu profilieren und zu professionalisieren, wird von kirchlichen Leitungsverantwortlichen zusehends als Notwendigkeit erkannt. Denn: Menschen, die sich heute für ein ehrenamtliches Engagement entscheiden, suchen verstärkt überzeugende Inhalte, klar umschriebene Aufgaben, Möglichkeiten zu begrenztem projekthaften Engagement und gute Rahmenbedingungen für ihre ehrenamtliche Arbeit wie etwa die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen, kompetente Begleitung, persönliche Förderung, angemessene Anerkennung und Wertschätzung. Professionelles Freiwilligenmanagement geschieht (auch) in der Kirche durch eine bewusste Grundhaltung und wertschätzenden Umgang, durch klare Verfahren und Regelungen und durch die Einbettung des Themas in die Strategie der Organisation (Reifenhäuser, 15).
Welchen Stellenwert haben Fragen der Chancengleichheit für Männer und Frauen in diesem Kontext? – Beleuchtet man die dritte ökumenische Tagung zum ehrenamtlichen Engagement in Kirche und Gesellschaft im Jahr 2013 (www.wir-engagieren-uns.org) unter dieser Rücksicht, so zeigt sich: diskutiert wird die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und freiwilligem Engagement im Lebensverlauf und damit die Ermöglichung einer besseren Work-Life-Balance für Frauen und Männer. Diskutiert wird aber auch die Frage nach dem Recht und der Befähigung Aller zur Teilhabe am ehrenamtlichen Engagement. Der Diskurs über diese Frage orientiert sich an den Grundplausibilitäten des Managing Diversity, der produktiven Nutzung sozialer Differenzen wie Geschlecht, Alter, Herkunft u.a.m.
GENDERBLICK AUF KIRCHLICHES EHRENAMT: FRAGEHORIZONTE
Ein Genderblick auf kirchliches Ehrenamt und kirchliche Engagementförderung eröffnet folgende Fragehorizonte: in welchen pastoralen Feldern arbeiten mehrheitlich Männer ehrenamtlich, in welchen Frauen? In welchen Feldern sind Männer und Frauen zu etwa gleichen Teilen ehrenamtlich engagiert? Welche „Wertigkeit“ haben pastorale Felder, in denen sich vornehmlich Männer bzw. vornehmlich Frauen engagieren – auch im Blick auf die Bereitstellung von finanziellen oder hauptamtlichen personellen Ressourcen? Welche Auswirkungen sind zu erwarten, wenn die bislang von Frauen dominierten Engagementfelder für Männer und bislang von Männern dominierte Engagementfelder für Frauen zugänglich gemacht werden? Welche Maßnahmen würden eine Öffnung befördern? Gibt es innerhalb eines pastoralen Raums, einer Seelsorgeeinheit oder Gemeinde explizite „Frauen-Räume“ oder explizite „Männer-Räume“, die z.B. ihre Wurzeln in der früheren ständischen Organisation der Pastoral haben? Welche Dynamiken sind dort wirksam? Welche Bedeutung haben diese Räume für diejenigen, die sie aufsuchen, nutzen und gestalten? Wie ist die Geschlechterverteilung in ehrenamtlichen Leitungspositionen (Vorsitzende von Räten, Verbänden, Leitung von Gruppen und Kreisen)? Machen Satzungstexte Aussagen zur Geschlechterverteilung?
Welche geschlechtsspezifischen Dynamiken sind wirksam in der Arbeitskonstellation zwischen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen (z.B. Priester und ein Team ausschließlich weiblicher ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen)? Wie wird ehrenamtliches Engagement von Frauen und Männern öffentlich sichtbar? Welche Vorstellungen von „Männlichkeit“ oder „Weiblichkeit“ sind wirksam bei der Verteilung und Ausübung von ehrenamtlichen Aufgaben? Entsprechen die Engagementangebote dem Zeitbudget und dem Tagesablauf von Frauen und Männern? Schließen bereits Rahmenbedingungen organisationaler Art Männer oder Frauen von bestimmten Engagementangeboten aus? Ist bei Leitungsverantwortlichen ein „Zeitbewusstsein“ vorhanden, das ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer in ihrer „Zeitsouveränität“ unterstützt und dazu beiträgt, dass Frauen und Männer Beruf, Familie und ehrenamtliches Engagement vereinbaren können? Werden Männer und Frauen gleichermaßen aktiv angesprochen, sich zu engagieren?
Welche Interessensprofile lassen Männer und Frauen, Jungen und Mädchen erkennen, die sich neu für ein ehrenamtliches Engagement im kirchlichen Bereich interessieren? Welche Auswirkungen sind zu erwarten, wenn Grundaxiome des Managing Diversity in die Ehrenamtsstrategie einer Gemeinde aufgenommen würden?
Elke Langhammer
geb. 1971, Dr. theol., seit September 2014 im neu geschaffenen Arbeitsbereich „Ehrenamt und Engagementförderung“ im Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg tätig.
LITERATUR
BMFSFJ, Hauptbericht des Freiwilligensurvey 2009. Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 1999–2004–2009, München 2010.
BMFSFJ, Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von Männern und Frauen im Lebensverlauf. Erster Gleichstellungsbericht, Berlin 42013.
Burbach, Christiane, Gerechtigkeit und Fairness: Dimensionen des Gender Diskurses, in: Burbach, Christiane / Döge, Peter (Hg.), Gender Mainstreaming. Lernprozesse in wissenschaftlichen, kirchlichen und politischen Organisationen, Göttingen 2006, 15–24.
Notz, Gisela, Arbeit: Hausarbeit, Ehrenamt, Erwerbsarbeit, in: Becker, Ruth / Kortendieck, Beate (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie (= Geschlecht & Gesellschaft 35), Wiesbaden 32010, 480–488.
Reifenhäuser, Carola / Reifenhäuser, Oliver (Hg.), Praxishandbuch Freiwilligenmanagement, Weinheim / Basel 2013.
![]()
Gender-Botschaft
Eine Gottesdienstbesucherin betritt den Kirchenraum und lässt sich in einer der vorderen Bankreihen nieder, um einer katholischen Messe beizuwohnen. Sie richtet den Blick nach vorne, zum Altarraum. Dort bewegen sich Männer im langen Gewand, Frauen sind nicht anwesend. Den weiblichen Part repräsentieren Mädchen, die ministrieren. Zur Predigt tritt ein Priester an den Ambo, um das Wort Gottes auszulegen und es zu verkündigen. Frauen, Männer, Kinder, die ihm gegenüber in den Bänken sitzen, hören ihm zu. Maria Elisabeth Aigner
Gleicht das Bemühen, den Genderdiskurs in die Verkündigung einzubringen einer Quadratur des Kreises? Dass die Genderdebatte an sich weder harmlos und schon gar nicht überholt ist, zeigen die jüngst aufgeflammten Hasstiraden, die sich im Netz anlässlich der Diffamierung einer soziologischen Genderforscherin wie ein überkochendes, siedend heißes Gebräu ausbreiteten. Von „Genderwahn“, „Hetze gegen Genderforscherinnen“, „brutalen Drohungen im Internet“ und „Genderbashing“ ist hier die Rede – Schlagworte, die zeigen, wie tiefgreifend die Thematik nach wie vor in unserer Gesellschaft wirkt (Schaschek). Die Wucht solcher Diffamierungen lässt an jene Zeiten erinnern, in denen Frauen verfolgt und als Hexen verbrannt wurden. Die Gesellschaft und in ihr auch Kirche und Theologie haben in der Geschichte in ihrem Umgang mit Frauen, Gleichgeschlechtlichkeit oder auch Transgender unendlich viel Unheil angerichtet. Weltweit ist nach wie vor kein Ende der damit verbundenen Leiden in Sicht (Kristof/Wu-Dunn).
Das Faktum, dass den Frauen in der Kirche seit jeher eine ungleiche Rechtstellung zukommt, die nach wie vor nicht aufgehoben ist, hat paradoxerweise just in diesen Bereichen zu einer hohen Sensibilisierung in Bezug auf Gender geführt. In der Wissenschaft zeigt sich das an der Aufbruchsbewegung der Feministischen Theologie, die seit geraumer Zeit verstärkt in die „theologische Genderforschung“ übergeht. In der Praxis lässt sich diese Sensibilisierung an überraschend kreativen pastoralen Genderprojekten festmachen, die trotz der vorherrschenden androzentrischen Definitionsmacht pastorales Innovationspotenzial zeigen. Insgesamt scheint es, dass wir gegenwärtig in Bezug auf die Genderdebatte einer großen Ungleichzeitigkeit gegenüberstehen. Wie stark wirksam diese Ungleichzeitigkeit mittlerweile geworden ist, wird hierzulande auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. KünstlerInnen wie Andreas Gabalier und Conchita Wurst stehen für einen bestimmten Zugang zur Genderthematik. Beide lösen gleichermaßen Hypes aus, sammeln Scharen von AnhängerInnen um sich und könnten in ihrem Genderhabitus unterschiedlicher nicht sein.
In Homiletik und Verkündigung kann jedoch kaum von „Ungleichzeitigkeiten“ in Bezug auf Gender gesprochen werden. Vielmehr zeigt sich hier eine „phänomenale Lücke“ (Wolf-Withöft) bzw. ein brachliegendes Feld, das zu beackern sich unbedingt lohnt. Nur: woher die Pflugscharen nehmen?
GLEICHHEIT
Dass Frauen gleichgestellt und gleichberechtigt den Männern ihre Stimme erheben und das Wort Gottes verkündigen können, ist derzeit weder kirchenrechtlich verankert noch pastoral realisierbar. Der Kampf von Frauen um Gleichheit und damit um die Forderung, gleichberechtigt an der Deutungsmacht in der Verkündigung teilzuhaben, ist notwendig. Die darin liegende Gefahr, sich in die vorherrschenden patriarchal geprägten kirchlichen Strukturen einzupassen, mag dazu führen, dass viele Frauen den Bereich der Wortverkündigung erst gleich gar nicht betreten oder für sich beanspruchen wollen. Das Wort Gottes zu hören ist das eine, es selbst zu verkündigen, zu deuten und auszulegen, das andere. Dazu sind Frauen und Männer gleichermaßen berechtigt, gefordert und befähigt.
Wenn es in bestimmten pastoralen Handlungsfeldern und im engeren Sinn in der Liturgie das Bemühen gibt, das...