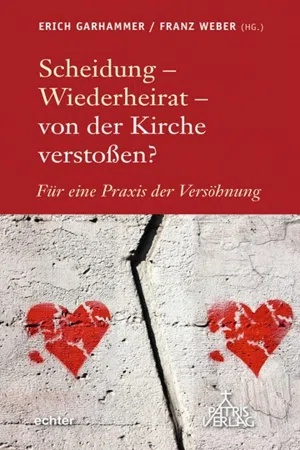![]() Positionen der Theologie
Positionen der Theologie![]()
Gerd Häfner
Ehescheidung und Wiederheirat – Neutestamentliche Aspekte
1. „Ehescheidung“ in der Jesus-Tradition – Befund und Rekonstruktion
Das Thema „Ehescheidung“ erscheint in den Evangelien in zwei Zusammenhängen. Zum einen ist ein Streitgespräch überliefert, in dem Jesus gegen die Ausstellung des Scheidebriefs argumentiert (Mk 10,2–9 par Mt 19,2–8), zum andern gibt es ein Jesuswort, das in verschiedenen Fassungen Ehescheidung und Wiederheirat auf unterschiedliche Weise mit Ehebruch in Verbindung bringt (Mk 10,11 f par Mt 19,9; Lk 16,18 par Mt 5,32). Das Streitgespräch wird häufig auf die urchristliche Überlieferung zurückgeführt.1 Auch wenn dies nicht für den Kern der Überlieferung gelten muss,2 empfiehlt die Diskussionslage, bei der Suche nach der Haltung Jesu an dem genannten Wort über die Ehescheidung anzusetzen. Angesichts der Unterschiede in den verschiedenen Versionen ist dabei zunächst zu fragen, ob sich eine ursprüngliche Gestalt des Jesuswortes rekonstruieren lässt.
Mt 5,32
Jeder, der seine Frau entlässt,
ausgenommen im Fall von Unzucht,
macht, dass sie zum Ehebruch verleitet wird.
Und wer eine Entlassene heiratet,
begeht Ehebruch.
Lk 16,18
Jeder, der seine Frau entlässt
und eine andere heiratet,
begeht Ehebruch;
und wer eine vom Mann Entlassene heiratet,
begeht Ehebruch.
Mk 10,11f
(11) Wer seine Frau entlässt
und eine andere heiratet,
begeht Ehebruch gegen sie.
(12) Und wenn sie selbst ihren Mann entlässt
und einen anderen heiratet,
begeht sie Ehebruch.
Relativ eindeutig ist die markinische Fassung des Spruches als nachträgliche Bearbeitung erkennbar. Sie allein geht von der Möglichkeit aus, dass auch die Frau den Mann entlassen kann. Das ist nach jüdischer Rechtslage nur in Ausnahmefällen möglich.3 Es dürfte sich bei Mk 10,12 also um eine sekundäre Angleichung an die rechtlichen Verhältnisse handeln, die die urchristlichen Gemeinden außerhalb Palästinas vorfanden, aber nicht um einen Ausspruch Jesu. Mk 10,11 stimmt (bis auf „gegen sie“) mit der ersten Hälfte des Spruches bei Lukas überein (Lk 16,18a). Die Diskussion um die ursprüngliche Fassung lässt sich demnach beschränken auf einen Vergleich zwischen Mt 5,32 und Lk 16,18.
Beide Verse bieten im zweiten Teil denselben Wortlaut: „Wer eine (Lukas: vom Mann) Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.“ Da diese Übereinstimmung gegen Markus gegeben ist, stammt das Wort wahrscheinlich aus der gemeinsamen Quelle, die Matthäus und Lukas über Markus hinaus benutzt haben (die sogenannte Logienquelle Q). Die nächste Frage muss sich dann auf den ersten Teil des Wortes richten: Hat Lukas seine Fassung aus der Markus-Parallele geschöpft, also gegen seine zweite Quelle (Q) geändert? Oder bot diese Quelle denselben Wortlaut wie Mk 10,11, so dass Matthäus seine Vorlage an dieser Stelle gänzlich umgestaltet hätte?
Dass Matthäus in 5,32a eingegriffen hat, wird allgemein angenommen: die sogenannte Unzuchtsklausel („ausgenommen im Fall von Unzucht“) findet sich nur in seinem Evangelium, hier aber durchgängig (s. 19,9). Es handelt sich deshalb nach fast einhelliger Meinung um eine Ausnahmeregel, die in der matthäischen Gemeinde angewendet wurde und deshalb ihren Weg in das Matthäus-Evangelium fand. Damit ist aber unsere Frage nach der ursprünglichen Gestalt noch nicht beantwortet. Mt 5,32a und Lk 16,18a unterscheiden sich in einem Punkt wesentlich: Matthäus geht in Übereinstimmung mit der jüdischen Tradition davon aus, dass der Mann seine eigene Ehe nicht brechen kann; er kann nur (dies allerdings gegen Dtn 24,1–4) durch die Entlassung der Frau den Anlass zum Ehebruch geben, der dann geschieht, wenn die entlassene Frau geheiratet wird. Dagegen spricht Lukas davon, dass der Mann durch die Entlassung der ersten Frau und die erneute Heirat die eigene Ehe bricht. Hat der Judenchrist Matthäus „rejudaisiert“, also ein gegen jüdische Überzeugungen stehendes Jesus-Wort wenigstens teilweise wieder in Einklang gebracht mit der jüdischen Tradition? Oder stellt die lukanische Fassung eine Weiterentwicklung dar, die ein Jesus-Wort an nicht-jüdische Verhältnisse angepasst hat, in denen die rechtliche Stellung von Mann und Frau in der Ehe nicht so fundamental unterschiedlich gesehen wurde?
In der exegetischen Literatur findet sich keine einhellige Antwort auf diese Frage. M. E. spricht mehr dafür, dass Matthäus das Jesus-Wort genauer bewahrt hat. In seiner Fassung ergibt sich eine ausgezeichnete innere Verbindung beider Spruchhälften. Der Gedanke, dass die Frau durch die Entlassung aus der Ehe zum Ehebruch verleitet wird, wird im zweiten Versteil fortgeführt: Der Ehebruch, in den die Frau durch die Verantwortung des ersten Mannes getrieben wird (5,32a), geschieht durch die erneute Heirat (5,32b), weil die erste Ehe durch die Entlassung eigentlich nicht aufgelöst ist. Demgegenüber besteht in Lk 16,18 ein wesentlich schlechterer innerer Zusammenhang, der nicht auf eine ursprüngliche Zusammengehörigkeit der beiden Sätze schließen lässt. Der erste spricht vom Brechen der eigenen Ehe, der zweite vom Brechen der Ehe eines anderen. Dabei setzt die zweite Spruchhälfte eine Neubewertung der jüdischen Scheidungspraxis voraus, da anders als in Dtn 24,1–4 davon ausgegangen wird, dass die Frau durch die Entlassung nicht frei ist zu erneuter Eheschließung. Die erste Spruchhälfte ist dagegen völlig jenseits des jüdischen Ehe- und Scheidungsrechts angesiedelt: Dass der Mann seine eigene Ehe brechen kann (Lk 16,18a), ist dort nicht vorgesehen. Neben der besseren Kohärenz der beiden Spruchhälften spricht für die Ursprünglichkeit der matthäischen Fassung, dass Matthäus im Rahmen des Streitgesprächs um die Ehescheidung der Vorlage bei Markus im Wesentlichen gefolgt ist (vgl. Mt 19,9; Mk 10,11). Deshalb dürfte er die abweichende Formulierung in 5,32 nicht selbst gebildet, sondern aus seiner zweiten Quelle übernommen haben.
Jesu Wort zur Ehescheidung hatte also ursprünglich wahrscheinlich folgende Form:
„Jeder, der seine Frau entlässt, macht, dass sie zum Ehebruch verleitet wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.“
2. Zur Deutung des Ehescheidungswortes
Formal gesehen erscheint das Wort Jesu zur Ehescheidung zunächst als Rechtssatz: Ein bestimmtes Verhalten („Jeder, der das und das tut …“) wird mit einer bestimmten Strafe belegt. Das zweite Element, die Nennung der Strafe, fehlt allerdings in Mt 5,32. An seine Stelle tritt ein „ethisches Urteil“4: Wer seine Frau entlässt, veranlasst ihren Ehebruch; wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Die Entlassung der Ehefrau wird anders bewertet als im Gesetz des Mose: Sie ist Anstiftung zum Ehebruch.
Das bedeutet: Eigentlich angesprochen wird hier der verheiratete Mann. Ihm werden die Konsequenzen klargemacht, die dem Urteil Jesu zufolge die Entlassung seiner Frau nach sich zieht: Sie wird zum Ehebruch verleitet; ein anderer Mann, der sie heiratet, wird zum Ehebrecher. Der Mann, der seine Frau entlassen hat, bricht nicht die Ehe; er ist aber verantwortlich dafür, dass Ehebruch geschieht. Adressat der Aussage ist damit derjenige in dem „Beziehungsgeflecht“ von Mt 5,32, der nach der Rechtsordnung der Tora gar nicht belangt werden kann. Er tut etwas, wodurch andere zur Gesetzesübertretung verleitet werden, nämlich zum Ehebruch. Nur dies wird betont; das Verhalten des Mannes, der seine Frau entlässt, wird nicht selbst Gegenstand einer rechtlich fassbaren Beurteilung. Umgekehrt gilt: Diejenigen, deren Tun rechtlich relevant wäre (die entlassene Frau und der sie heiratende Mann, die Ehebruch begehen), sind gar nicht unmittelbar angesprochen. Es geht nicht darum, ihr Verhalten anzuprangern und sie als Ehebrecher bloßzustellen, sondern es sollen allein dem entlassenden Mann die Folgen seiner Tat und die Verantwortung für den Ehebruch der anderen aufgezeigt werden. Diese Tat wird strikt abgelehnt, weil die Ehe anders beurteilt wird. Sinn ergibt der Ausspruch nur dann, wenn vorausgesetzt ist, dass die Entlassung der Frau die Ehe nicht aufhebt. Der Mann hat in der Sicht Jesu, anders als es Dtn 24,1–4 voraussetzt, über das Bestehen seiner Ehe kein Verfügungsrecht.
Jesus verwirft also die Ehescheidung, sagt dies aber in der Form eines Rechtssatzes, der letztlich keine rechtlich fassbare Bestimmung enthält. Das Wort Jesu zur Ehescheidung ist deshalb überfordert, wenn man es im Sinne einer rechtlichen Regelung versteht, die unabdingbar und unter Absehung der näheren Umstände auf alle Ehen anzuwenden ist. Diese Einschätzung schwächt die Verbindlichkeit der Mahnung zu lebenslanger Treue nicht ab. Wenn hier der Gegensatz zwischen Paränese (= Mahnung zu einem bestimmten Verhalten) und Rechtssatz herausgestellt wird, dann nicht, um auszudrücken, Jesus habe die Mahnung nicht ernst gemeint. Es ist damit nur gesagt, dass Jesus keine Regelung vorlegt, die die Gemeinschaft seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger in allen denkbaren Fällen rechtlich verpflichten wollte.
Jesus fordert mit seinem Wort zur Ehescheidung angesichts herrschender Ansichten über die Möglichkeit, die Ehefrau zu entlassen, ein gegensätzliches Verhalten. Damit provoziert er seine Hörer und will sie zu einer Änderung ihrer Einstellung bewegen. Die Provokation spitzt zu und verschärft, sie kümmert sich nicht um Ausgewogenheit und Differenzierung. So bedenkt das Jesuswort gar nicht die Schutzfunktion des Scheidebriefs für die Frau. Müssten Frauen, die aus der Ehe entlassen werden, im Sinne Jesu trotz der damit einhergehenden wirtschaftlichen und rechtlichen Unsicherheit unverheiratet bleiben, damit kein Ehebruch geschieht? Allgemeiner, ohne Bezug auf die damalige Rechtslage, gefragt: Ist ein Ehepartner, der vom andern verlassen wird, zum Alleinsein verurteilt, weil Wiederheirat in jedem Fall Ehebruch ist? Solche Fragen sind nicht im Horizont des Wortes Jesu, und deshalb kann man auch nicht alle denkbaren Fälle von diesem Wort als einem zeitlos und situationsunabhängigen Gesetz beurteilen. Nicht die Verbindlichkeit der Weisung Jesu steht zur Debatte, sondern ihre prinzipielle Anwendbarkeit als Rechtssatz ohne Berücksichtigung der besonderen Situation.
3. Die Frage nach dem Grund für Jesu Ablehnung der Ehescheidung
a) Wie kommt Jesus zu seiner strengen Auffassung von der Ehescheidung? Da Mt 5,32 den verheirateten Mann anspricht und ihm das Recht auf Entlassung seiner Frau bestreitet, wird vielfach vorgeschlagen: Jesus will, entsprechend seiner besonderen Zuwendung zu den rechtlich gering geachteten Frauen, die männliche Vorherrschaft in der Ehe brechen; die Frau soll aus ihrem Status als Besitzobjekt des Mannes befreit und zur gleichberechtigten Partnerin des Mannes werden. Diese sympathische Erklärung hat leider den Nachteil, dass sie sich kaum am Text erweisen lässt: Ein Interesse an der Lage der Frau wird nicht erkennbar. Im Vordergrund steht nicht deren Benachteiligung, sondern das nicht aufhebbare Bestehen einer Ehe. Sicher, dem Mann wird die Möglichkeit bestritten, seine Frau zu entlassen; sie gehört faktisch nicht mehr zum Besitz des Mannes, den er behalten oder abgeben könnte, wie es ihm beliebt. Dass aber dadurch die Stellung der Frau verbessert werden soll, ist nicht gesagt. Allein die Konsequenz der Scheidung für eine erneute Eheschließung wird bedacht: Sie führt zum Ehebruch (im Blick auf die erste Ehe).
b) Man kann versuchen, die dargelegte Sicht von Ehe und Ehescheidung in Jesu Gottesreich-Botschaft einzuordnen. Direkte Anhaltspunkte in der Überlieferung gibt es nicht, da der Zusammenhang an keiner Stelle direkt ausgesprochen ist. Wir müssen also nach sachlichen Verbindungslinien suchen. Man könnte ansetzen am Grundzug der Gottesreich-Botschaft: Gott will Israel endzeitlich sammeln und nimmt die Menschen gerade als Sünder mit seiner zuvorkommenden Liebe an. Die Annahme dieser Vergebung muss freilich zur Konsequenz führen, auch den Nächsten anzunehmen. Was allgemein aus dem Anbruch des Gottesreiches für das Verhältnis der Menschen zueinander folgt, das gilt im Besonderen für das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe: Die gegenseitige Beziehung soll nicht abgebrochen werden, sie soll sich vielmehr bestimmen lassen von der bedingungslosen Annahme, die Gott im Verhältnis zu den Menschen verwirklicht; Verfehlungen sollen nicht angerechnet werden, sondern gegenseitiges Vergeben gelebt werden.5 Die gesetzliche Regelung des Scheidebriefes steht diesem Anspruch entgegen. Sie eröffnet die Möglichkeit, den in der Verkündigung Jesu offenbarten Willen Gottes zu umgehen und sich dabei durch die Berufung auf das Gesetz doch den Anschein der Erfüllung dieses Willens zu geben.
c) Der skizzierte Versuch, Jesu Ablehnung der Ehescheidung aus seiner endzeitlichen Gottesreich-Botschaft abzuleiten, kann sich, wie bemerkt, nicht auf unmittelbare textliche Evidenz stützen. Eine Begründung findet sich in der Jesus-Tradition allein im Streitgespräch mit den Pharisäern (Mk 10,2–9par). Der Abschnitt trägt sicher Spuren urchristlicher Überlieferung,6 dennoch dürfte der Kernbestand ins Wirken Jesu zurückreichen. Jesus kann kaum darauf verzichtet haben, seine Ablehnung des Scheidebriefs zu begründen. Außerdem hat der Begründungsweg im Streitgespräch eine Parallele in der Art und Weise, wie Jesus seine Sabbatpraxis rechtfertigt. Er bezieht sich auf den ursprünglichen Schöpferwillen, um den Sinn des Sabbats als Einrichtung zum Wohl des Menschen zu kennzeichnen: „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen“ (Mk 2,27). Wird der Wille des Schöpfers hier als Auslegungsmaßstab für das Sabbatgebot herangezogen, so im Fall der Ehescheidung als Korrektiv für eine Bestimmung der Mose-Tora, die als Zugeständnis „um eurer Herzenshärtigkeit willen“ erscheint (Mk 10,5). „Von Anfang der Schöpfung“ aber, mit der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau (Gen 1,27), war es anders. Die Aussage aus Gen 2,24, Mann und Frau würden in der sexuellen Verbindung ein Fleisch, wird zum Argument gegen die Ehescheidung: Die Entlassung der Frau durch den Mann hebt auf, was in der Erschaffung des Menschen begründet ist.
Mit dieser Begründung wird einerseits die Unauflöslichkeit der Ehe betont, andererseits keine rechtliche Regelung geschaffen, die eine Trennung von Eheleuten für jeden Einzelfall ausschließen wollte. Greift man die Analogie zur Begründung de...