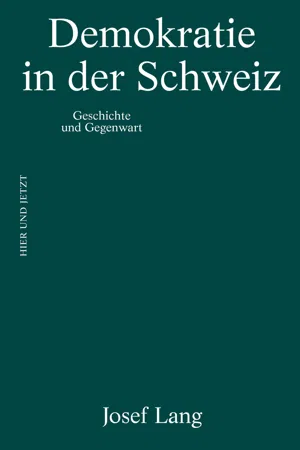
- 224 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Die Schweiz sieht sich gern als Hort der direkten Demokratie, die ihre Wurzelnim fernen Mittelalter haben soll. Die heutige Form des Schweizer Staatswesens geht aber wesentlich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Josef Lang analysiert und reflektiert seine Entstehung und Entwicklung in geraffter Form: Inwiefern gab es Partizipation in der Zeit vor 1798? Welche Auswirkungen hatte die Helvetik? Auf welcher Basis entstand der Bundesstaat 1848? Der Autor beschreibt eindrücklich den Umbruch in den Jahren nach 1860, als sich demokratischer, säkularer und sozialer Fortschritt zu verbinden begannen. Er schildert die Veränderungen des Staatswesens im 20. Jahrhundert mit dem Vollmachtenregime während der Weltkriege, den Konflikten zwischen Korporatismus und Republikanismus in der Zwischenkriegszeit, der politischen Enge in der Zeit der Geistigen Landesverteidigung, dem gesellschaftlichen Aufbruch 1968 und der konservativen Wende der 1990er-Jahre. Und er beleuchtet mit der aktuellen Klimabewegung und den Debatten um Gleichstellung die Gegenwart.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Zeittafel
| 1700–1708 | Schwyzer Stadlerhandel: Er enthüllt als erster mehrerer Landsgemeindekonflikte den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf gleichberechtigte Partizipation der Landsleute und dem beschleunigten Prozess von Aristokratisierung und Korrumpierung, insbesondere durch das Söldnerwesen. Der Aufstandsführer Josef Anton Stadler wird nach schweren Folterungen enthauptet. |
| 1712 | Schlacht bei Villmergen: Der erste Religionskrieg, den die Protestanten gewinnen, ist zugleich der letzte in Europa. Er zeigt das Grundproblem der Eidgenossenschaft und die Hauptherausforderung für die entstehende Aufklärung auf: die konfessionelle Spaltung. |
| 1713 | Zürcher «Zünftler»-Unruhen: Die Bewegung gegen die korrumpierte Oligarchie wird gestoppt, bevor sie die ländlichen Untertanen erfassen kann. |
| 1717–1740 | Untertanenunruhen im Klettgau gegen die Schaffhauser Stadtherren, in Werdenberg gegen die Glarner Landsgemeinde, im Fürstbistum Basel gegen den Bischof. |
| 1728–1735 | Zuger Harten- und Lindenhandel: Sie richten sich gegen die plutokratische Offiziersfamilie Zurlauben. Der Aufstandsführer Josef Anton Schumacher stirbt in Italien auf dem Weg zu den Galeeren. |
| 1732/33 | Appenzeller Landhandel: In Ausserrhoden setzen sich die «harten» Bauern halbwegs gegen die «linden» Herren durch. |
| 1734–1738 | Genfer Citoyens und Bourgeois: Ihre Bewegung fordert die Souveränität des «Conseil General» und gerechtere Steuern. |
| 1746 | Gründung der Naturforschenden Gesellschaft Zürich: Sie gehört zu den ersten der 386 Sozietäten, die im 18. Jahrhundert ihre geistige und soziale Wirkung entfalten. |
| 1749 | Henzi-Verschwörung in Bern: Die «Staats-Reformation» wendet sich gegen die Oligarchisierung innerhalb des Patriziats. Samuel Henzi wird im gleichen Jahr in Bern geköpft. |
| 1755 | Aufstand in der Leventina gegen die Urner Landvögte: Die Landsgemeindeherrschaft rächt sich besonders hart. Die drei Führer werden vor den zwangsversammelten Untertanen, die ihre bisherigen Rechte verlieren, enthauptet. |
| 1760–1784 | Appenzeller Sutterhandel: Der Innerrhoder Aufstand bäuerlicher Landsleute gegen eine sich abschottende Obrigkeit zeigt die Doppelbödigkeit der Landsgemeindedemokratie. Der Anführer ist gleichzeitig ein harter Landvogt gegen die Rheintaler Untertanen. Anton Joseph Sutter wird 1784 hingerichtet. |
| 1761/62 | Gründung der Helvetischen Gesellschaft: Die überkantonale und überkonfessionelle Vereinigung ist das wichtigste Organ der Aufklärung in der deutschsprachigen Eidgenossenschaft. |
| 1762–1765 | Schwyzer Harten- und Lindenhandel: Er wendet sich gegen den Militärunternehmer Reding und dessen Abhängigkeit von Frankreich. |
| 1762–1768 | Genfer Unruhen: Sie werden provoziert durch die Verbrennung von Jean-Jacques Rousseaus «Emile» und «Contrat Social» sowie die Ausweisung des Autors. Zürich und Bern vermitteln nach einer militärischen Intervention gegen den Willen des beteiligten Frankreichs ein «Konzilianzedikt», das dem «Conseil General» wieder mehr Macht verleiht. |
| 1762–1768 | Zürcher Jugendrevolte: Sie entwickelt sich im Umfeld von Johann Jakob Bodmer und wird durch die Niederwerfung des Genfer Aufstandes angeheizt. |
| 1764–1767 | Revolte der Einsiedler «Waldleute»: Sie richtet sich gegen den Fürstabt und die Schwyzer Oligarchen. Auslöser sind die Kosten für den klösterlichen Barockbau. 1766 kommt es zur «Hinrichtung der drei Kälin», später werden weitere «Harte» zum Tod verurteilt. |
| 1770–1780 | «Encyclopédie d’Yverdon»: Sie ist, abgesehen von Rousseaus Œuvre, das wichtigste Werk der Aufklärung aus der Romandie. Es versucht, Religion und Lumières zu versöhnen. |
| 1777–1780 | Zürcher Zunftkonflikt: Die Zünfte wehren sich gegen die Missachtung des Mitspracherechts beim Allianzvertrag mit Frankreich. 1780 wird der aufgeklärte Pfarrer und Statistiker Johann Heinrich Waser wegen seiner Kritik am Söldnerwesen enthauptet, was europaweites Entsetzen auslöst. |
| 1781 | Freiburger Chenaux-Handel: Der Aufstand der ländlichen Untertanen gegen Patriziat und Adel verlangt die Öffnung der Archive zwecks Offenlegung der «alten Rechte und Freiheiten». Der Führer Pierre-Nicolas Chenaux wird enthauptet. |
| 1781/82 | Genfer Unruhen: Ein Bündnis von Bürgerlichen und rechtlosen «Natifs» wird von bernischen, französischen und sardischen Truppen niedergeschlagen. |
| 1787 | Proklamation der Verfassung der USA. |
| 1789 | Beginn der Französischen Revolution. |
| 1790–1797 | Unruhen und Aufstände: Die Französische Revolution stachelt viele Untertanen und Angehörige der Unterschichten an. Ihre Aktionen haben einen starken Versammlungscharakter und sind beeinflusst durch die Menschen- und Bürgerrechte. Die bedeutendsten sind neben der Genfer Revolution (1792–1798) das «Landsgemeindefieber» gegen den sankt-gallischen Fürstabt 1794/95, der gleichzeitige Stäfnerhandel gegen die Stadt Zürich in den oberen Seegemeinden sowie 1797 die Separation des Veltlins vom Bündnerland und der Triumphzug Napoleons durch die Waadt. |
| 1798 | Helvetische Revolution: Die Unfähigkeit der alteidgenössischen Obrigkeiten, die Untertanenverhältnisse aufzuheben, führt zu einer Verknüpfung von französischer Intervention und inneren Aufständen. Am spektakulärsten und erfolgreichsten sind die Bewegungen in der Waadt, wo sich die «République Lémanique» als Teil einer Helvetischen Republik erklärt, im Aargau, in Basel, wo städtische Reform und ländliche Rebellion zusammenkommen, in Zürich, wo Landleute die Stadt besetzen, und in der Ostschweiz, wo die Untertanen Landsgemeinderepubliken errichten. Auffällig ist die Beteiligung ländlicher Unterschichten und vieler Frauen, insbesondere in Aarau, Zürich und im St. Gallischen. |
| 1798–1802 | Helvetische Republik: Sie wird am 12. April 1798 in Aarau proklamiert, baut auf einer modernen Verfassung und ist damit die erste Demokratie in der Schweiz. Sie scheitert vor allem am einheitsstaatlichen Zentralismus, an der finanziellen und militärischen Belastung der französischen Besatzung, an hergebrachten Privilegien wie die Zugehörigkeit zu Gemeindekorporationen und an einer religiös aufgeladenen Fundamentalopposition. Es gibt neben traditionalistischen Aufständen wie in Schwyz und Nidwalden direktdemokratische wie in der Ostschweiz und antifeudalistische wie im Baselbiet, in der Waadt und um Horgen. Hinzu kommen vier Staatsstreiche, bei denen sich radikale Patrioten und gemässigte Republikaner, Unitaristen und Föderalisten gegenseitig wegputschen. Kurz vor ihrem Ende findet am 25. Mai 1802 die erste gesamtschweizerische Volksabstimmung statt. |
| 1802–1829 | Mediation und Restauration: Die von Napoleon zur Befriedung der Schweiz durchgesetzte Mediation ist eine «Restauration avant la lettre», die einen Grossteil der modernen Errungenschaften der Helvetik rückgängig macht. Allerdings schafft sie aus Untertanengebieten die fünf Kantone St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt, und sie schliesst Graubünden an. 1815 folgen Genf, Wallis und Neuenburg. Die Restauration ersetzt 1815 die Mediationsverfassung durch einen Bundesvertrag, der den Kantonen wieder die volle Souveränität verleiht. Dank ausländischem Druck wird die Rückkehr zu den Untertanenverhältnissen verhindert – mit drei Ausnahmen: Baselbiet, Ausser-Schwyz und Unterwallis. Die wie eine Landsgemeinde organisierte Gerichtsgemeinde Disentis versucht, die Herrschaft über das Veltlin zurückzuerobern. Wider die ersten Oppositionsregungen, unter ihnen diejenige der Helvetischen Gesellschaft, und gegen die offene Asylpolitik einzelner Kantone erzwingt die Heilige Allianz 1823 ein Presse- und Fremdenkonklusum. |
| 1830/31 | Beginn der Regeneration: Volksversammlungen und einzelne bewaffnete Aktionen überwinden in elf Kantonen, denen zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung angehören, die Restauration und schaffen liberaldemokratische Verfassungen. Beflügelt werden diese Kantone durch die Julirevolution in Frankreich. Allerdings hat sich die Regeneration im Tessin bereits zuvor durchgesetzt. St. Gallen führt das Veto, ein Vorläufer des Referendums, ein und behält die konfessionelle «Sönderung» bei. |
| 1832 | Erste Sonderbünde: Angesichts der Weigerung der Urkantone, die regenerierten Verfassungen anzuerkennen, schliessen sich die liberalen Kantone des Mittellands zum Siebnerkonkordat zusammen. Die katholischen Urkantone bilden mit den protestantischen Patrizierständen von Basel und Neuenburg den Sarnerbund. Dieser verteidigt den Bundesvertrag von 1815 und richtet sich gegen die Basler und Schwyzer Kantonstrennungen. Papst Gregor XVI. veröffentlicht die Enzyklika «Mirari Vos», eine Kriegserklärung an den Liberalismus, insbesondere den katholischen. Der schweizerische Kulturkampf ist lanciert. |
| 1833 | Scheitern der Bundesreform: Der Versuch der Tagsatzung, eine gemässigte Bundesverfassung («Bundesurkunde») zu schaffen, scheitert wesentlich am Widerstand der konservativen Mehrheit des katholischen Klerus. Die Basler Landschaft wird ein eigenständiger Halbkanton, der in den folgenden Jahrzehnten die radikalsten Positionen vertritt. |
| 1834 | «Badener Artikel»: Die vom Siebnerkonkordat und dem Kanton Basel-Landschaft beschlossenen Bestimmungen wollen die liberalen Priester schützen, die Kirche stärker kontrollieren und den Einfluss Roms schmälern. Sie scheitern am klerikalkonservativen Widerstand in Zug, Luzern und Solothurn und am Veto in St. Gallen. |
| 1836 | Asylbewegung: Gegen das unter ausländischem Druck beschlossene Fremdenkonklusum zur Ausweisung politischer Flüchtlinge gibt es starken Widerstand in den regenerierten Kantonen. Die Volksversammlungen mit 50 000 Personen verteidigen mit dem Asylrecht die Souveränität der Schweiz. Daraus entwickelt sich innerhalb des Liberalismus und g... |
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Zur Geschichte der Demokratie in der Schweiz: eine Einleitung
- Der grosse Sprung nach vorn (1861–1874)
- Widersprüche zwischen Volksrechten und Bürgerrechten in den 1860er-Jahren
- Ancien Régime: im Spannungsfeld von Partizipation und Ausgrenzung
- Revolten und Revolutionen: aus der Vormoderne in die Moderne (1700–1804)
- Von der Republik zur Restauration (1798–1829)
- Regeneration, Verfassung, Bundesstaat (1830–1860)
- Von der Totalrevision zum Landesstreik (1875–1918)
- Autoritärer Staat – vitale Opposition (1919–1949)
- Geistige Landesverteidigung: von der Allmacht in die Krise (1949–1992)
- Von der patriotischen Rebellion zur Klima- und Frauenbewegung (1992–2020)
- Zur Zukunft der Demokratie in der Schweiz: zehn Herausforderungen
- Anhang