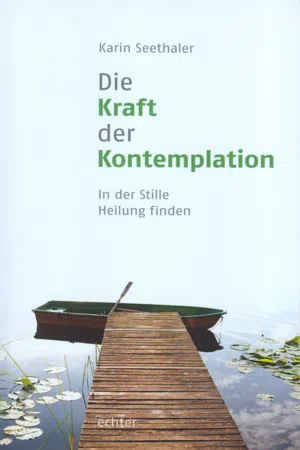![]() III. Kontemplative Haltungen und
III. Kontemplative Haltungen und
ihre heilenden Auswirkungen![]()
1.Achtsame Haltung:
Aufmerksam sein für das, was ist
Das Wesen des Gebets besteht in der Aufmerksamkeit.
(Simone Weil)
Wir leben in einer Zeit zunehmender Beschleunigung, in der Multitasking, Effizienz, durchgetaktete Terminpläne und Stress den Alltag bestimmen. Aufmerksamkeit und Achtsamkeit bleiben dabei oftmals auf der Strecke und mit ihnen das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Dies hat Folgen: Jeder Zweite klagt über steigenden Stress. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts ausgemacht. Achtsamkeit erscheint hier wie ein Zauberwort, das einen Ausweg aus den vielfältigen Belastungen unseres Alltags zu geben scheint. Innerhalb neuer Entwicklungen in der Psychotherapie, der Verhaltensmedizin und den Neurowissenschaften wird das Prinzip der Achtsamkeit als eine hochwirksame Methode beschrieben, um die Lebensqualität zu erhöhen, Stress zu reduzieren und die Gesundheit zu bessern. Federführend ist hier Jon Kabat-Zinn zu nennen, der für den medizinisch-therapeutischen Bereich ein spezielles Achtsamkeitstraining (mindfulness-based stress reduction = MBSR) entwickelt hat, das Menschen helfen soll, besser mit Stress, Schmerzen und Krankheiten umzugehen. Vielfältige Studien belegen die positiven Auswirkungen gelebter Achtsamkeit.
Früher verstand man unter Achtsamkeit vor allem eine Haltung, in der man achtsam mit jemand bzw. mit etwas umging. Heute hat sich der Begriff geweitet und umfasst ausdrücklich auch die Achtsamkeit auf die eigene Person. Die Aufmerksamkeit kann sowohl nach außen als auch nach innen gerichtet sein. Der heute schmerzhaft erfahrene Mangel an Achtsamkeit lässt bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einer Haltung wachsen, die den Alltag zu entschleunigen und die Lebensqualität zu verbessern vermag.
Die Praxis der Achtsamkeit ist jedoch kein neues Bedürfnis und keine Erfindung unserer Zeit. Sie hat uralte Wurzeln in den spirituellen Traditionen. Jesus fordert dazu auf, wachsam zu sein (Mk 13,35), und verbindet die Wachsamkeit mit dem Gebet (Mt 26,41). Es geht dabei nicht um ein „Erreichen“, „Verändern“ oder um ein „Produzieren“, sondern um das „aufmerksame Gewahrsein dessen, was ist“. In dieser Wachsamkeit, die in einer achtsamen und aufmerksamen Haltung zum Ausdruck kommt, ist der Mensch mit allen Sinnen Gott zugewandt. Darin besteht das Wesen des Gebets. Achtsamkeit, die für alle Lebensbereiche wichtig ist, entfaltet in der spirituellen Erfahrung ihre größte Tiefe. Das aufmerksame Dasein ist in gewisser Weise etwas Passives, denn es lässt geschehen, ohne dabei eine Absicht zu verfolgen. Gleichzeitig ist die Ausübung der Aufmerksamkeit ein hochaktiver Vorgang, indem der Mensch all seine Sinne öffnet und empfänglich ist für das, was über das eigene Ich hinausführt. In dieser Haltung ist Begegnung möglich: mit sich selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott.
Die Fähigkeit, seiner Aufmerksamkeit eine Richtung zu geben, ermöglicht es, unter einer Vielzahl von Eindrücken und Informationen eine Auswahl zu treffen. Wenn ich z. B. jemanden vom Bahnhof abhole, werde ich nach der betreffenden Person Ausschau halten. Die Geräuschkulisse, die am Bahnhof herrscht, tritt für mich in den Hintergrund. Auch alle anderen Personen werde ich nur am Rande wahrnehmen. In den Vordergrund rückt das, worauf ich bewusst meine Aufmerksamkeit richte. Diese Fähigkeit, die Aufmerksamkeit bewusst lenken zu können, um bei einer Sache zu bleiben, ist also nicht nur für die Meditation von zentraler Bedeutung, sondern ebenso für die Bewältigung des Alltags. Sie hat eine unmittelbare Auswirkung darauf, wie man sich fühlt. Psychologen der Harvard-Universität erforschten mit Hilfe einer speziellen iPhone-Applikation die emotionalen Auswirkungen von abschweifenden Gedanken. 2250 Teilnehmer wurden zu unterschiedlichen Zeiten, während sie ihrem normalen Tagesablauf nachgingen, kontaktiert und gefragt, was sie gerade taten, ob sie gerade an ihre augenblickliche Tätigkeit dachten oder an etwas anderes und wie glücklich sie waren. Das Ergebnis zeigte, dass die Teilnehmenden fast die Hälfte der Zeit nicht bei der Sache waren, sondern anderen Gedanken nachhingen. Das Ausmaß des Gegenwärtig-Seins war dabei eng mit dem Empfinden von Glücklichsein und Zufriedenheit verknüpft. Die Menschen, die nicht bei der Sache waren, fühlten sich eher unglücklich.
In der Meditation nutzt man die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit bewusst auf das Hier und Jetzt zu lenken und sie immer wieder neu daran zu binden. Indem man sie auf die Gegenwart richtet, lebt man in der Fülle des unmittelbaren Augenblicks. Man ist dem Leben, das der Mensch in Fülle erfahren soll (Joh 10,10), zugewandt und zugleich offen für das Zukünftige. Wer diese Kostbarkeit des Augenblicks entdeckt, findet das Glück des Alltags (Adalbert Stifter).
1.1Die konkreten Schritte,
die in eine achtsame Haltung führen
Achtsamkeit bildet die Basis für eine kontemplative Lebenshaltung. Ohne Achtsamkeit kann sich keine der weiteren kontemplativen Grundhaltungen entfalten.
Die Entscheidung: Ich möchte achtsam sein
Es kommt vor allem darauf an, entschlossen zu beginnen. Wer entschlossen beginnt, hat schon einen guten Teil des Weges hinter sich.
(Teresa von Avila)
Achtsamkeit ist eine grundlegende und angeborene Fähigkeit des menschlichen Geistes. Trotzdem ist man nicht „automatisch“ achtsam. Nur wenn der Mensch achtsam sein will und sich dazu entschließt, wird er diese Fähigkeit tatsächlich in seinem Leben üben. Üben meint hier natürlich nicht ein Einüben mit dem Ziel, perfekt zu werden, sondern ein regelmäßiges Ausüben, da sich die Achtsamkeit stets nur im gegenwärtigen Augenblick entfalten kann. Die bewusste Entscheidung, achtsam sein zu wollen, wird erleichtert, wenn ein Wunsch danach spürbar ist. Dies unterstützt die Fähigkeit, die Achtsamkeit zu aktivieren und dem Hier und Jetzt zugewandt zu bleiben. Ein routinierter Ablauf, Zeitdruck und unterschiedlichste Befindlichkeiten können diesen Wunsch jedoch verdecken. Unabhängig davon ist es aber möglich, mit einer Entscheidung einen bewussten Anfang zu setzen, worauf sich dann nach und nach eine achtsame Haltung entfalten kann.
Ich nehme meinen Körper wahr
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? … Verherrlicht also Gott in eurem Leib!
(1 Kor 6,19–20)
Da die Meditation ein ganzheitliches Geschehen ist, beziehe ich zu Beginn meinen Körper bewusst mit ein. Er ist der Ausgangspunkt für meine Achtsamkeit. Ich nehme meinen Körper wahr und durchwandere die einzelnen Körperteile, angefangen von den Fußsohlen bis hin zum Scheitel. Es ist hilfreich, einige Momente achtsam auf meinen Atem zu lauschen, wie er kommt und geht. Er hilft mir, bei mir selbst anzukommen. So sagt man z. B. zur Beruhigung zu jemandem, der außer sich ist: „Jetzt atme erst einmal tief durch.“ Mit der Wahrnehmung des Atems komme ich wieder in Kontakt mit mir selbst. Wenn ich meinem Atem nachlausche, führt er mich nach innen. Durch diese Wahrnehmungen meines Körpers und meines Atems komme ich bereits in Berührung mit der Gegenwart. Es ist eine Hinwendung zum Geist Gottes, der in meinem Körper wohnt.
Ich lasse gewähren, was sich in mir zeigt
Lass dich schweigend auf dich selbst zukommen.
(Karl Rahner)
Ich achte anschließend bewusst auf meine augenblickliche Befindlichkeit und lasse zu, was sich in mir zeigt: Gedanken, die auftauchen, Erinnerungen und Bilder, die sich in mir zeigen, oder Sätze, die mir durch den Kopf gehen. Vielleicht wird mir eine Empfindung oder ein Gefühl bewusst und ich bemerke eine Unruhe, eine Traurigkeit, eine Freude oder einen Ärger. Ich lasse mich schweigend auf mich selbst zukommen, indem ich gewähren lasse, was sich in mir zeigt. Diese bewussten Wahrnehmungen schaffen einen Zugang zu mir selbst und ermöglichen es mir, mich ganz dort einzufinden, wo ich jetzt bin. Mein Bewusstsein wird dabei unmerklich auf die Ebene des Seins geführt. Ich darf bei mir selbst ankommen und mich da sein lassen, wie ich bin. Es kann eine Haltung des Geschehen-Lassens entstehen.
Einen Meditierenden, der sich am Anfang der Meditation die Zeit zugesteht, sich selbst wahrzunehmen, kann man in gewisser Hinsicht mit einem Geiger vergleichen. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er seine Geige stimmt, bevor er beginnt, auf ihr zu spielen. Würde er dies außer Acht lassen, kämen Missklänge heraus, auch wenn er sich noch so große Mühe beim Spielen seiner Geige gäbe. Die Einstimmung auf die Meditation geschieht durch die achtsame Selbstwahrnehmung. Im Gegensatz zum Geiger braucht man sich aber nicht selbst in Einklang zu bringen. Man muss nichts an sich verändern. So wie man im Augenblick da ist, genauso darf man da sein und sich zu Gott wenden.
Ich verzichte auf Bewertungen
Und nun mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
(Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz)
Wir sind es gewohnt, beständig zu bewerten und zu urteilen. Urteile sind wichtig. Ohne sie könnten wir nicht leben. Sie schützen uns, engen uns jedoch auch ein. In der Meditation gilt es nun, die ungewohnte Haltung einzunehmen, auf die Bewertung seiner Gefühle, Gedanken oder seiner Meditation als Ganzes zu verzichten und sie weder als gut und positiv noch als schlecht und negativ zu beurteilen. Bewertungen und Urteile beenden einen Wahrnehmungsakt. Wer urteilt, achtet nicht mehr auf das, was jetzt ist, sondern orientiert sich an seinem Urteil und fixiert seine Aufmerksamkeit darauf. Die Wirklichkeit wird entsprechend reduziert. Bei einem sogenannten Schubladendenken sieht man z. B. vor allem das, was zur eigenen Sichtweise passt. Wenn ich von jemandem sage: „Das ist ein schwieriger Mensch“, werde ich mit diesem Urteil sein Verhalten wie durch eine Brille betrachten und es entsprechend bewerten. Andere Anteile seiner Persönlichkeit werden nur am Rande oder gar nicht wahrgenommen. Auch Urteile über sich selbst wie z. B. „ich bin kompliziert“ fixieren meine Aufmerksamkeit entsprechend. Man nimmt dann bei sich vor allem das wahr, was dieses Urteil stets aufs Neue bestätigt, und Wesentliches, was meine Person eigentlich ausmacht, sehe ich nicht. Eine Professorin für Heilpädagogik erzählte mir, wie wichtig es ihr war, ihren Studierenden die Bedeutsamkeit der ‚heilsamen Unsicherheit‘ zu vermitteln. Die ‚heilsame Unsicherheit‘ ermöglicht, eigene Urteile und Sichtweisen über Menschen zu relativieren und sie nicht als etwas Endgültiges zu betrachten. Jesus verurteilt den Menschen nicht (Joh 8,11) und fordert dazu auf, auch über andere nicht zu richten (Mt 7,1). Die Einsicht, dass es richtig ist, weder über andere noch über sich selbst zu urteilen, verhindert aber nicht, dass Urteile trotzdem in uns aufsteigen. Sie sind da, ob wir es wollen oder nicht. Der meditative Umgang mit den Bewertungen und Urteilen ist der, sie wahrzunehmen, jedoch nicht, mit der Aufmerksamkeit bei ihnen zu bleiben. Man wendet sich von dem Urteil ab und achtet stattdessen auf das, was noch da ist. Dieser Verzicht, zu urteilen bzw. nicht bei einem Urteil zu bleiben, befreit die festgefahrene Aufmerksamkeit und ermöglicht den Kontakt mit der stets neuen Gegenwart. Ich erkenne dabei an, dass meine Urteile begrenzt sind.
Ich lasse mich von Moment zu Moment auf die
Gegenwart ein
Wir sind die Treibenden.
Aber den Schritt der Zeit,
nehmt ihn als Kleinigkeit
im immer Bleibenden.
Alles das Eilende
wird schon vorüber sein;
denn das Verweilende
erst weiht uns ein.14
(Rainer Maria Rilke)
Achtsamkeit ist die Tür, die ins Leben führt. Sie verbindet uns mit dem Fluss des Lebens, das sich von Augenblick zu Augenblick ereignet. Der Lebensfluss und alles Seiende ist in beständiger Bewegung und in ständiger Veränderung. Achtsamkeit ist also kein statischer Zustand. Sie ermöglicht es, bewusst wahrzunehmen, dass man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen kann, dass kein Morgen dem anderen gleicht, dass jeder Tag neu ist und jede Meditation eine neue Erfahrung in sich birgt. Sie offenbart das Urgeheimnis der Zeit, dass alles Geschehen einmalig ist (nach Martin Buber).
In der achtsamen Haltung lässt man sich von Moment zu Moment auf das jeweils Gegenwärtige ein. In der Meditation erfahren wir dabei, wie viel sich in uns bewegt, wie ein Gedanke den anderen ablöst, wie sich eine Stimmung aufdrängt und wieder verblasst und wie sich z. B. unvermittelt inmitten vieler Gedanken eine Ruhe einstellen kann. Der Mensch muss und darf die Erfahrung machen, dass nichts bleibt, wie es ist. Er erfährt, dass er einem beständigen Wandel unterworfen ist. Gleichzeitig kann er durch eine immer neue Hinwendung zur Gegenwart in das Geheimnis geführt werden, dass bei all dem ‚Treibenden‘, was er erlebt, ein gleichzeitig immer ‚Bleibendes‘ ihn trägt.
1.2Ein Beispiel
Versag dir nicht das Glück des heutigen Tages; an der Lust, die dir zusteht, geh nicht vorbei!
(Sir 14,14)
Der Mann mit der Violine
An einem kalten Januarmorgen 2007 betritt ein junger Mann in Jeans, langärmeligem T-Shirt und Baseballkappe in Washington eine U-Bahn-Station in der Nähe eines belebten Büroviertels. Viele Menschen sind unterwegs, die meisten auf dem Weg zur Arbeit. Der junge Mann holt eine Geige hervor, legt den Geigenkasten vor sich hin und beginnt zu spielen. Es dauert ein paar Minuten, bis der erste Passant den Geiger bemerkt. Er verlangsamt seinen Schritt für ein paar Sekunden, aber er unterbricht seinen Weg nicht. Kurz darauf wirft eine Frau den ersten Dollar in den Geigenkasten, aber auch sie bleibt nicht stehen. Ein junger Mann hält inne, um zuzuhören, und lehnt sich an die Wand. Aber nach einem kurzen Blick auf seine Uhr geht er abrupt weiter. Der Geiger spielt und spielt, fast eine Dreiviertelstunde Stücke von Bach, Schubert und anderen Komponisten klassischer Musik. Zum Schluss bleibt eine Frau mit einem Plastikbeutel stehen, erst ungläubig, dann bewundernd. Sie hat den Mann erkannt. Es ist Joshua Bell, einer der besten Musiker unserer Zeit. Mehr als tausend Menschen sind an ihm vorbeigekommen. Weniger als zehn Menschen sind stehengeblieben, um ihm für kurze Zeit zuzuhören. Etwa 25 Passanten warfen ihm im Vorübergehen eine Münze in den Geigenkasten. Es kamen etwas mehr als 32 Dollar zusammen. Er spielte unter anderem eines der komplexesten und schwierigsten Musikstücke: die „Chaconne in d-Moll“ von ...