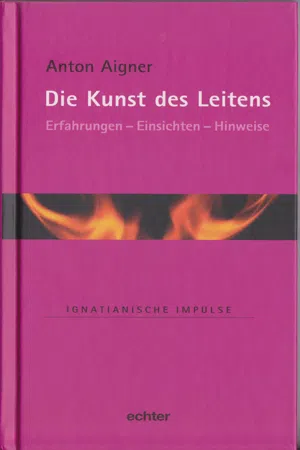
- 94 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Kunst des Leitens
Über dieses Buch
Ob in der Familie oder in der Schule, im Betrieb oder im Verein, in der Pfarrei oder in der Ordensgemeinschaft - immer braucht es Menschen, die vorangehen und die Aufgabe der Leitung übernehmen.Das Buch versucht auf konkrete Weise zu zeigen, worauf beim Führen und Leiten von Menschen zu achten ist. Dabei bringt der Blick auf Ignatius von Loyola, der selbst über 20 Jahre lang seinen Orden klug geführt hat, wertvolle Einsichten in die "Kunst des Leitens".
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
1. »Keinen anderen Oberen als Ihn«
Man schreibt das Jahr 1537. Ignatius und seine ersten Gefährten warten in Venedig auf eine Möglichkeit zur Überfahrt nach Jerusalem. Um die Zeit zu nützen, verteilen sie sich in Zweier- und Dreiergruppen und halten Straßenpredigten in verschiedenen Städten Oberitaliens. »Als sich der Winter näherte und die politische Situation jede Möglichkeit einer Reise nach Palästina ausschloss, versammelten sich die Gefährten in Vicenza, von wo aus sie sich wieder auf verschiedene Orte verteilten. Bevor sie dies jedoch taten, beschlossen sie, dass sie in Zukunft auf die Frage, wer sie seien, mit ›Gesellschaft Jesu‹ (Compagnia di Gesù) antworten wollten, da sie keinen anderen Oberen als Ihn hatten.«1
Drei Jahre später, nach vielen Beratungen unter den Gefährten und zähem Ringen mit den Machtinstanzen im Vatikan, ist Ignatius am Ziel: Seine kleine Gruppe wird von Papst Paul III. als kirchlicher Orden bestätigt. Die Bulle Regimini militantis ecclesiae beginnt mit dem Satz: »Wer immer in unserer Gesellschaft, von der wir wünschen, dass sie mit dem Namen Jesu bezeichnet werde … dienen will …« Es ist der ausdrückliche Wunsch des Ignatius, dass sein Orden den Namen Jesu trägt. Das mag uns heute nicht weiter berühren, war aber damals höchst ungewöhnlich, haben sich doch alle großen Orden bisher nach ihrem Gründer benannt, die Benediktiner, die Franziskaner, die Dominikaner … Warum also keine Ignatianer? Die eigenwillige Benennung mit dem Namen Jesu dürfte damals manche hohe Herren in der Kirche geärgert haben, weil sie als Arroganz empfunden worden ist. Doch Ignatius wählt diesen Namen nicht, um zu provozieren, sondern um von Anfang an klarzustellen: Diese Gemeinschaft und jedes einzelne Mitglied stehen letztlich nicht unter der Leitung des Gründers oder des gewählten Generaloberen und auch nicht des Papstes, sondern unter der Leitung Jesu Christi. Das mag zunächst wie eine fromme Formel klingen. Wir werden aber sehen, wie diese Überzeugung des Ignatius immer wieder ganz konkrete Auswirkungen beim Leiten seiner Gemeinschaft hat.
Wenn wir nach einem »Ignatianischen Leitungsmodell« suchen, müssen wir bei Jesus Christus beginnen. Er ist das Zentrum, um das sich das ganze Denken und »Vorangehen« des Ignatius dreht. Er ist wie die Nabe in einem Wagenrad, die die einzelnen Speichen zusammenführt und festhält. Eine Speiche kann fehlen, ohne dass das Rad in seinem Lauf wesentlich behindert wird; doch wenn die Nabe fehlt, bricht das Rad zusammen. »Für mich ist Jesus Christus alles. Nur so kann ich ausdrücken, was Jesus Christus in meinem Leben bedeutet: alles. Er war und ist mein Ideal seit meinem Eintritt in die Gesellschaft Jesu, er war und bleibt mein Weg und ist immer noch meine Stärke. Ich denke, es ist nicht nötig, viel zu erklären, was das heißt: Nehmen Sie Christus aus meinem Leben, und alles wird zusammenstürzen, wie ein Körper, dem man das Skelett, den Kopf und das Herz wegnimmt.«2 Diese Sätze stammen nicht von Ignatius, sondern von einem seiner Nachfolger als Generaloberer der Gesellschaft Jesu, Pedro Arrupe, einer beeindruckenden charismatischen Persönlichkeit, der in dieser Reihe der Ignatianischen Impulse3 ein eigenes Bändchen gewidmet ist. Ignatius würde dieses Bekenntnis bejahen: Nur von Jesus Christus her ist er zu verstehen – auch in seinem Leitungsstil.
Mit dieser klaren Ausrichtung auf Jesus Christus bringt Ignatius im Grunde nichts Neues, sondern folgt nur dem Wort der Bibel, allerdings mit ganzer Konsequenz: »… einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder … einer ist euer Lehrer: Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein« (Mt 23,8ff.). Wer immer Menschen leitet und führt, im familiären Bereich als Vater oder Mutter, im kirchlichen Bereich als Pfarrer oder Pfarrerin, als Pastoralassistentin oder Ordensoberer, ja auch als Lehrerin in der Schule oder als Chefin einem Betrieb, soll – sofern diese Aufgabe aus einer gläubigen Grundhaltung heraus getan wird – wissen, dass er oder sie an dieser Stelle Christus »vertritt«. Christus ist derjenige, der jeden Menschen und jede religiöse Gemeinschaft letztlich führt. Er ist derjenige, der die leitende Person »in Dienst nimmt«. Manfred Scheuer, Bischof der Diözese Innsbruck, schreibt dazu: »Das Leitungsamt darf nicht der eigenen Anmaßung entspringen, es ist nicht eigenes Produkt, auch nicht nur eine Frage der Kompetenz. Es entspringt vielmehr der Wahl Christi: ›Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt‹ (Joh 15, 15). Solche Leitung ist orientiert am Beispiel Jesu und orientiert an den Menschen: Leitung wird anvertraut, damit andere Leben in Fülle haben (Joh 10,10).«4 Teilhabe am Hirtenamt Jesu Christi verwirklicht sich nicht nur im priesterlichen Dienst, sondern überall dort, wo gläubige Menschen im Vertrauen auf den Hirten Jesus Christus andere Menschen leiten und führen.
Sich als Leiter oder Leiterin wichtig nehmen
Daraus ergibt sich eine konkrete Spannung, denn die Person, die im oben beschriebenen Sinne leitet, soll »sich wichtig nehmen«, aber sie soll sich zugleich »nicht allzu wichtig nehmen«. Was ist damit gemeint?
Wer leitet, soll sich wichtig nehmen: Die leitende Person trägt Verantwortung. Auf sie schauen die anderen. Nach ihr können sie sich ausrichten, an sie können sie sich halten. Die Zwölf, die Jesus zu Aposteln beruft, müssen »vortreten« (Mk 3,13). Von nun an können sie sich nicht mehr in der Masse der Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, verstecken. So steht auch jeder, der im Geiste Jesu Menschen führt, »im Rampenlicht«. Er muss seine Verantwortung ernst nehmen; und deshalb soll er sich selbst wichtig nehmen. Die Qualität des Leiters bestimmt zu einem guten Teil die Qualität der Gruppe, die er führt. In den Richtlinien für die Hausoberen des Jesuitenordens (Nr. 5) findet man den unmissverständlichen Satz: »Der Fortschritt und eine gute Leitung der Gesellschaft (Jesu) hängen zum großen Teil von den Hausoberen ab, und allgemein gesagt, werden die Gefährten das sein, was die Oberen sind.«
Es gibt für diejenigen, die an der Spitze stehen, zweifellos die Versuchung, »abzuheben« und selbstherrlich zu agieren. Doch auch das Gegenteil ist möglich und genauso schlecht: Dass nämlich der Leiter oder die Leiterin aus einem falsch verstandenen »Wir sind alle Brüder und Schwestern« oder einfach aus persönlicher Schwäche jenen Platz nicht einnimmt, der ihm/ihr zukommt, und versucht, in der Masse zu »verschwinden«. Wer zur Leitung berufen ist, muss diese Aufgabe auch wahrnehmen. Demut darf nicht mit Feigheit verwechselt werden. Die Unfähigkeit, die eigene Rolle wahrzunehmen und auszufüllen, kann schlimme Folgen haben.
Michael Winterhoff beschreibt in seinem Buch »Warum unsere Kinder Tyrannen werden«, das lange an der Spitze der Bestsellerlisten zu finden war, verschiedene Formen von Fehlverhalten gegenüber Kindern in Familien und Kindergärten. Eine Störung kann auch eine Form von Partnerschaftlichkeit sein, die das Kind überfordert und ihm die Phase seines Kindseins raubt; sie ist besonders häufig zu finden bei allein erziehenden Müttern oder Vätern, für die das Kind auch Partnerersatz wird. »Erwachsener und Kind begeben sich auf die gleiche Ebene und rangieren auf Augenhöhe nebeneinander, so dass keiner dem anderen eine Richtung vorgeben kann. Dieser moderne Umgang mit dem Kind gilt heute in der Gesellschaft als vollkommen normal.«5 Nur wenn Eltern ihre Rolle als Mutter oder Vater genügend wahrnehmen und sich gegenüber dem Kind auch abgrenzen, kann das Kind auch Kind sein, kann es jene Phase des Kindseins durchlaufen, auf die es ein Anrecht hat und die für seine weitere Entwicklung von hoher Bedeutung ist.
Doch zurück zu Ignatius: Er wird nicht müde, die Bedeutung des Oberenamtes in dem von ihm gegründeten Orden herauszustreichen, und betont immer wieder, dass nur die Besten als Obere für die einzelnen Gemeinschaften eingesetzt werden dürfen. Umgekehrt müssen die Mitglieder einer Gemeinschaft den Oberen »als den, der die Stelle Christi unseres Herrn einnimmt, in großer Achtung und Ehrfurcht halten« (Sa 424). Der Obere soll mit jener Autorität auftreten, die ihm kraft seines Amtes zusteht; zugleich soll er dieses Amt als einen Dienst an den Mitbrüdern verstehen, gerade weil er die Stelle Christi in der Gemeinschaft einnimmt und seinem Beispiel folgen soll. »Die Leitung in der Gesellschaft soll immer eine geistliche sein, durch die die Mitglieder von ihren Oberen eher durch die kluge Liebe als durch äußere Gesetze geführt werden. Die Oberen sollen sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sein und ihrer Pflicht, ihre Untergebenen als Söhne Gottes und in Achtung der menschlichen Person zu leiten, energisch, wo es nötig ist, ehrlich und offen« (EN 349,1). Es lohnt sich, diese Sätze in Ruhe zu meditieren. Sie könnten auch über den Jesuitenorden hinaus die Basis für ein gutes Leitbild sein.
Sich nicht allzu wichtig nehmen
Wer leitet, soll sein Amt und sich selber wichtig nehmen. Er (oder sie) soll sich aber nicht allzu wichtig nehmen. Er soll sich wichtig nehmen, weil er an Stelle Christi diese Aufgabe erfüllt. Er soll sich nicht allzu wichtig nehmen, weil er einen Dienst erfüllt, bei dem er ohne die »Kraft von oben« auf verlorenem Posten steht. Wer leitet, soll sich immer wieder einmal ins Bewusstsein rufen: »Ich bin für Gott nur eine Möglichkeit, um jene Menschen, für die ich mich verantwortlich fühle, einen guten Weg zu führen. Er ist nicht auf mich angewiesen; er hat auch andere Möglichkeiten und er hat mehr Phantasie als wir Menschen.« Solches Denken will die Wichtigkeit meines Leitens nicht abwerten; sondern es will entlasten.
In der Bibel wird diese Einstellung zum eigenen Tun durch das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat ausgedrückt. Der Sämann streut den Samen in den Ackerboden; er tut seine Pflicht und legt sich dann zur Ruhe. »Und es wird Nacht und Tag; der Same keimt und wächst, und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da« (Mk 4,26–29). Hans Schaller vermerkt in einem Kommentar zu dieser Bibelstelle: »Das Gleichnis ist keine Einladung zur Bequemlichkeit. Das versteht sich von selbst. Es weist vielmehr auf eine geistliche Verpflichtung hin, zu unserem eigenen Tun und Wirken eine innere Freiheit und Distanz zu gewinnen und vor allem ein Vertrauen, das uns einerseits dahin engagiert, die Sache durchaus ernst zu nehmen, weil es um das Reich Gottes geht, andererseits uns selber nicht allzu wichtig, weil wir nur Knechte und Diener sind.«6 Das Gleichnis kann auch ein Trost für jene Eltern sein, die sich Sorgen um ihre heranwachsenden Kinder machen, die sich manchmal so ganz anders entwickeln, als es die Eltern erhofft haben. Dann kann man häufig Selbstvorwürfe hören: »Was haben wir denn falsch gemacht? Wo haben wir als Eltern versagt?« Es gibt keine Eltern, die keine Fehler bei der Erziehung ihrer Kinder machen, auch wenn sie sich noch so sehr bemühen. Doch die Liebe und Sorge, die sie ihren Kindern durch zwanzig Jahre und mehr geschenkt haben, der Same, den sie ausgestreut haben, geht nicht verloren. Die Frucht braucht oft lange, bis sie sichtbar wird, und von Eltern wird manchmal viel gläubiges Vertrauen verlangt, damit sie jene Menschen, die ihnen am liebsten sind und am nächsten stehen, in Gottes Führung übergeben können.
Bekannt ist die Geschichte, die von Papst Johannes XXIII., Giovanni Roncalli, erzählt wird: Als der Beginn des Konzils, das der schon betagte Papst zur Überraschung der ganzen Kirche einberufen hatte, immer näher rückte, überfielen den mutigen Papst mehr und mehr die Zweifel, ob denn auch alles gut gehen würde. Bis in den Schlaf verfolgte ihn die Angst. Da hatte er einen Traum, dass Jesus ihm erschien und zu ihm sprach: »Giovanni, nimm dich nicht so wichtig.« Wenn sich selbst der oberste Leiter der katholischen Kirche nicht allzu wichtig nehmen soll, dann gilt dasselbe auch für alle anderen, die in einer Leitungsaufgabe stehen. Wer die rechte innere Distanz zu dieser Aufgabe aufbringt, schläft wieder gut!
Im Jesuitenorden sind alle Oberenposten – mit Ausnahme des Generaloberen – auf eine Amtszeit von sechs Jahren begrenzt. Eine Verlängerung wird nur ungern und nur bei einsichtiger Begründung gewährt. Diese strikte Regelung kann verwundern, denn bei sechs Jahren muss sich der Obere »beeilen«, wenn er etwas voranbringen will. Auf der anderen Seite hat die Begrenzung der Amtszeit auch ihre Vorteile:
– Die Wahrscheinlichkeit, dass man Regelungen, die sich nicht bewährt haben, ständig weiterschleppt, ist nicht so groß, wenn schon nach sechs Jahren ein »Neuer« kommt, der die Dinge mit mehr Unvoreingenommenheit sieht.
– Und auch die Gefahr, dass sich die Führungskraft mit einer Hausmacht umgibt, die nur aus Claqueuren besteht, ist geringer, wenn die Amtszeit kürzer ist.
Heute würde eine Unternehmensberatung diese Überlegungen sicher begrüßen. Ob sich schon Ignatius von solchen Ideen leiten ließ, als er die Amtszeit der Oberen auf ein festes Maß begrenzte, ist ungewiss. Doch von einer Tatsache war er sicher überzeugt, nämlich dass jeder, auch der beste Obere, austauschbar ist und ersetzt werden kann. Deshalb soll er sich nicht allzu wichtig nehmen.
Die Vertrautheit mit Gott
Kehren wir nochmals an den Ausgangspunkt un...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Einführung
- 1. »Keinen anderen Oberen als Ihn«
- 2. Wie Ignatius die Gesellschaft Jesu leitet
- 3. Drei Spannungsfelder
- 4. Das rechte Leiten – eine Kunst
- 5. Der Leiter – kein »Übermensch«
- Schluss: »Nur wer gehorchen lernt, kann recht befehlen«
- Zehn Leitsätze
- Anmerkungen
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Die Kunst des Leitens von Anton Aigner im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Christliche Kirche. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.