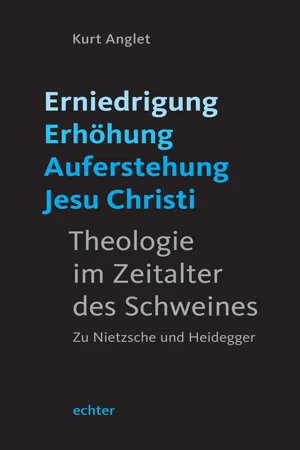![]()
VI. Erniedrigung – Erhöhung – Auferstehung Jesu Christi
Heidegger hat keinerlei Konsequenzen daraus gezogen – weniger aus einer Einsicht als einer Mutmaßung, die nichts von seiner Anmaßung (»je wesentlicher ein Denken ist«) preisgibt, dass – bei allem Irrigen – eine »geschickhafte Bestimmung und Entfaltung ihm vorbehalten ist.« Seine Unwissenheit ist freilich gespielt, weil er sehr wohl weiß, warum sein Denken in dem, »was es von sich und mit sich will, irrig« ist; m. a. W., weil nicht es – als sei das Denken von der Person des Denkenden losgelöst – als vielmehr er selbst um seine Selbstvermessenheit weiß. Es handelt sich nicht so sehr um das Eingeständnis eines Irrtums als um das Verschweigen dessen, worin sein Denken irrig ist: in der Überhöhung seines Denkens zum Sein über alles Seiende, einschließlich über Gott, seinen Schöpfer, von dem es im zweiten Klemensbrief an die Korinther heißt (vgl. 1,8):
Er rief uns, die wir nicht waren; Er wollte, dass wir aus dem Nichts zum Sein kamen [Übers. Jos. Pascher nach der Ed. Funk].
Er hat uns berufen als nicht Seiende, und Er hat uns aus dem Nichtsein sein lassen wollen [Übers. Lindemann/Paulsen].
Sein ist als Werk Gottes nicht ablösbar von der Schöpfung aus dem Nichtsein bzw. aus dem Nichts. »Seyn« aber als kryptotheologische Konstruktion im Denken Heideggers ist nicht vom Nichts, vom Nichtsein geschieden – daher seine Ablösung, ja Gegenüberstellung von allem Seienden, als wäre es vor aller Schöpfung, während es doch nach § 125 Seyn und Zeit der Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) nichts anderes bedeutet als das, »was ist, um aus diesem Seienden, darin das Unwesen waltet als ein Wesentliches, in das Seyn hinauszuhelfen und die Geschichte in ihren eigenwüchsigen Grund zu bringen« (GA 65, 242 f.). Unabhängig von allen antijüdischen oder antichristlichen Aussagen ist Heideggers Denken – gegen den Gott der Schöpfung und der Vorsehung, gegen den Gott der Erlösung und Vollendung – dem in der Geschichte herrschenden Unwesen verschworen; und zwar nicht aus politischer Naivität oder irgendwelchen geschichtsphilosophischen Phantastereien, sondern wohlweislich, da »mit dem Zeitalter, dem wir eingeeignet bleiben, ein wissender Ernst zusammentaugt« (vgl. ebd. 242). Darin besteht sein »Verschweigen« nicht zuletzt nach dem Krieg, ohne sein Seinsdenken offen als irrig zu bekennen und sich ins Schweigen zurückzuziehen, gemäß dem eingangs zitierten Wort aus dem Brief vom 21. September 1949: »Wir verraten das Schweigen nämlich, solange wir schweigen« (HA 141). Was verschwiegen wird, ist die eigene Schuld, über die Heidegger hinweggeht, als ob in allem Geschehen ein höheres Schicksal waltet, das »Seyn«, obgleich dessen Diktat nicht der göttlichen Eingebung eines prophetischen Wortes, also dem Akt göttlicher Inspiration, entspricht, sondern der Denker nur das zur Sprache bringt, was er hören will. So vermerkt Heidegger in einem Brief an seinen Bruder vom 21. Februar 1946 (HA 134):
Allerdings ist jetzt der Zug des Denkens täglich mehr und klarer darauf gerichtet, das Eigene rein und aus eigener Gestalt zu sagen. Denken – was ist es anderes als: das Diktat des Seyns in die Sprache einschreiben. Doch das fügsame Hinhören genügt nicht, weil der Denkende zugleich und eigentlich das Eigene der Sprache für das Diktat bereiten und fügen muß; es ist wie jenes Werkzeug, mit dem die Fugen in die »Daugen« – oben und unten eingeschnitten werden, damit Boden und Deckel am Faß eingefügt werden können.
[Es sei angemerkt, dass jenes »bereiten und fügen« in die »Daugen« etymologisch dem griechischen Wort φεύγω, lat. fugio, dt. biegen entspricht; im übertragenen Sinne es so viel bedeuten kann wie fliehen, entfliehen, sich einer Behauptung entziehen …] Abgesehen von dem Vergleich mit dem Werkzeug, der zeigt, wie »der Denkende« sich seine Sprache zurechtbiegt, finden sich Heideggers Überlegungen unter dem Stichwort Denken? nahezu wörtlich in den Anmerkungen I des vierten Bandes der Schwarzen Hefte, also mitten im Krieg, mit der abschließenden Feststellung: »Das bereite und vor-bereitete Sich-sagen-lassen verlangt die höchste Kühnheit« (GA 97, 86). Es ist in der Tat vorbereitet durch einen, der sich nichts sagen lässt, weil er es immer besser weiß. Nicht kühn, sondern dreist, ja vermessen ist es, wie sich Heidegger mit den wechselnden geschichtlichen Konstellationen, die ein ums andere Mal sein Urteil widerlegen, seine Worte zurechtbiegt, als wären sie mal vom »Seyn«, mal von der Sprache als dessen Behausung vorgegeben, und so in einem Brief vom 18. Januar 1945 an den Bruder vermerkt, der zunächst mit folgender geschichtlicher Zeitdiagnose einsetzt (HA 118):
Der Osten – das ist das Russland, das jeder Wissende unserer Generation seit Jahrzehnten kennt.
Was der »Weltgeist« mit den Deutschen vorhat, ist ein Geheimnis. Gleich dunkel ist, warum er sich der Amerikaner und Bolschewisten als seiner Schergen bedient.
Die einzige Behausung für unser Wesen ist unsere Sprache – das heißt ihr Wort als Wiege der Sage. An dieser Behausung allein müssen wir sagend bauen und das künftige Wohnen also retten. Alles Andere ist bestandlos und ohne gültige Form.
Bei allem Hören der Sprache (zum Beispiel Vorlesungen und Vorträgen) müssen wir scheiden zwischen dem, was sie an regelhaften Vorschriften enthalten und dem, was in die Verhaltungsweise und Handlungsweise des Einzelnen gelegt ist. Hier entscheidet immer, aus welcher Gesinnung der eine dem anderen begegnet – oft ist – und im Entscheidenden stets – das »wehrlos Ratgeben« stärker als alle Waffengewalt.
Dem würde kaum jemand widersprechen, zumal in einer Zeit, in der das »falsche Wort« am »falschen Ort« todbringend sein konnte. Doch die »Gesinnung« kann einer – wie oben (S. 53) die Ausführungen Gregors des Großen zeigen – durchaus hinter Worten verbergen. Offensichtlich ist das nicht der Fall, wenn Heidegger in einem Brief an die Familie seines Bruders von der Karwoche 1946 die »einfachen Verhältnisse« der früheren Jahre beschwört, die »etwas Bleibendes« hätten, »auch dann wenn es so aussieht, als müßte die überlieferte Welt zerbrechen. Es liegt an uns, ob wir den Geist der früheren Zeit ins Unsichtbare retten oder ob wir ihn preisgeben, indem wir ins Gewöhnliche des Heutigen und seines Verzehrs verfallen und das Ungemäße hereinlassen. Wir alle müssen hier immer noch lernen« (HA 137 f.). Was unter dem »Geist der früheren Zeit« zu verstehen ist, da es doch Heidegger nach wie vor um die Zukunft geht, sei dahingestellt, zumal Heidegger wenige Jahre zuvor die Frage nach »Verfall oder Rettung der Überlieferung« kaltließ (vgl. GA 65, 242). Dergleichen sein Ansinnen, jenen Geist »ins Unsichtbare« zu retten, wo er doch in einem Brief vom 9. August 1945 unter Verweis auf Hölderlins Elegie »Stuttgard« bzw. »Die Herbstfeier« betont: »Auch dies gehört zum Abendländischen, daß wir einmal erfahren, daß der ›Geist‹ nicht das Übersinnliche ist, das mit Hilfe einer Anstachelung durch ›Sinnliches‹ ›geschaffen‹ wird, sondern daß der Mensch eh in den Abgrund reicht und darum alles Übersinnliche überhöht in die Heitere und ihr Ereignen« (HA 130). Dass für eine derartige Überhöhung nicht die Zeit da ist, zeigt Heideggers Brief aus der Karwoche 1946, in dem er an das Schicksal der Heimatvertriebenen »im Osten unseres Vaterlandes« mahnt, das alles übersteige und unabhängig geschähe »von dem, was wir zwischen 1933 und 45 ›erlebten‹« (Vgl. HA 138). So wenig ein Leid das andere aufwiegt, so scheint Heidegger für einen Augenblick ganz vergessen zu haben, »daß der Mensch eh in den Abgrund reicht«. Und so schließt sein Brief:
Aber wenn dieses Leid und diese Leiden nur erst einmal die innerste Not und das Heil-lose der Welt sichtbar macht und kenntlich und uns aus der Gedankenlosigkeit aufjagt – die Anderen mögen in ihr weiter ersaufen – dann ist schon ein heilig-schmerzlicher Gewinn erlangt, den wir behalten müssen.
Wäre das Denken der früheren Jahre Ausdruck einer tiefen Gedankenlosigkeit gewesen, dann wäre in der Tat »ein heilig-schmerzlicher Gewinn erlangt, den wir behalten müssen«. Davon ist nichts mehr zu spüren, wenn nach dem oben zitierten Wort aus den Anmerkungen IV des vierten Bandes der Schwarzen Hefte »der Hirt als der Denkende« »die Sprengkraft des Wortes« hüte, ja, sich »in der Nachbarschaft des Todes« weiß (vgl. GA 97, 386). In seiner Nachbarschaft sieht Heidegger bereits auf den ersten Seiten der Anmerkungen I, also im Jahre 1942, das »Seyn«, unter dem Stichwort Seyn und »Tod« (GA 97, 10): Was wesenhaft »ist«, hat seine Beständigkeit in der Anfänglichkeit der Anfängnis des Kommens. Daß es »immer wieder« Kommen und Künftiges sein kann. Dieses Kommen Können entspringt einer anfänglichen Gewesenheit. Erst muß das Seyn in die Gewesung zurück – das Gewesende als die Herkunft des Kommenden. Ein erster Versuch, dieses Wesen des Seyns zu begreifen ist »Sein und Zeit«.
Dieses Begreifen ist unmöglich ohne das Wissen des Daseins und wie dieses im Wesen alles verwandelt und uns die nächsten Ausblicke gibt auf die inneren Möglichkeiten des Seins selbst. Das Seinkönnen – »der Tod«.
Es bedarf der Apostrophierung nicht, wie das Wort auch sonst gleichsam nackt geschrieben wird, weil der Tod überhaupt kein »Seinkönnen«, keine bloße Möglichkeit im Sinne von potentia darstellt, sondern eine reale Macht, nach der es nicht »immer wieder« ein »Kommen und Künftiges« geben kann. In endlosen Variationen seines Denkens ist es Heidegger gelungen, die Todesverfallenheit des menschlichen Daseins zu beschwören und zugleich unter dem Titel des »Seyns« das Wissen um eine Zukunft, die es gar nicht geben kann, weil sein Denken gar keine andere Vollendung kennt als »die Vollendung alles Feststellens des Lebe-Wesens Mensch« (vgl. GA 97, 386). Dass es sich hierbei nicht bloß gewissermaßen um einen fundamentaltheologischen Tatbestand handelt, sondern um ein »Wissen« von geschichtlicher Tragweite, bekundet das sechste Kapitel der Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), DIE ZU-KÜNFTIGEN überschrieben; darin, unter § 250. Die Zukünftigen, findet sich – als Satz heraus- und hervorgehoben – folgende Feststellung: »Unsere Stunde ist das Zeitalter des Untergangs« (GA 65, 397). Ihr geht der nicht gerade kleinliche Anspruch voraus (vgl. ebd. 396 f.):
Womit muß das Wissen der wahrhaft Wissenden anheben? Mit der eigentlichen geschichtlichen Erkenntnis; d. h. dem Wissen des Bereichs und dem Innestehen (fragenden) in dem Bereich, aus dem die künftige Geschichte sich entscheidet. Diese geschichtliche Erkenntnis besteht nie in der Feststellung und Abschilderung der jetzigen Zustände und Lagerungen der Begebenheiten und ihrer gehegten Ziele und Ansprüche. Dieses Wissen weiß um die Stunden des Geschehens, das Geschichte erst bildet.
Obwohl Heidegger nach dem oben zitierten Brief vom 31. Juli 1945 fragt: »Was wissen wir inmitten solcher Weltkatastrophen, wie sie sich jetzt ereignen, vom Geheimnis der Geschichte?« (HA 128), schöpft er aus einem »Wissen«, das um die Zukunft weiß: »um die Stunden des Geschehens, das Geschichte erst bildet«. Und obschon sich die Zukunft als ganz dunkel erweist, zählt er sich nach dem Brief vom 14. Juli 1944 zu den Wissenden: »Ob und wie die Wahrheit des Seyns gewahrt wird von den Wenigen, das wird nie öffentlich sichtbar und feststellbar sein. Darum müssen die Wissenden seiender werden und sein im Kleinsten und zu jeder Stunde« (HA 104). Dabei die Mahnung in dem Abschnitt zuvor: »Wir dürfen nicht der Übermacht des Seienden anheimfallen, gerade jetzt nicht.« Denn hinter dem »Seyn« verbirgt sich »das Walten des Unausgesprochenen« (HA 108 = Brief vom 28. September 1944), dem Surrogat des Gottes, dem Heidegger abgeschworen hat, ohne als Nihilist oder simpler Skeptiker dastehen zu wollen; in der Schar derer, die sich mit dem einfachen Nein begnügen. Denn: »Wer sich am Ziel glaubt, büßt ein den Rang. / Erst das verneinende Nein gewahrt und / gewährt Dir das Ja« (HA 115). Das Ja zu sich selbst, zu dem eigenen Ich, das sich erhoben wähnt nicht allein über die Gläubigen, die nichts begriffen haben, sondern nicht weniger über die Zweifler und Leugner, die aus ihrem Untergang keine wahre Größe zu schöpfen wissen, gemäß der Devise: »Untergang erst ist anfänglicher Aufgang« (ebd.). Denn wenn schon Untergang, dann ein triumphaler, der nicht auf den Schlachtfeldern der Geschichte endet; oder nach einer akademischen Laufbahn im Krematorium; oder wie der arme Hölderlin seinen Lebensabend im Tübinger Turm verbringt oder gar Nietzsche – nach seinen wuchtigen Donnerschlägen – im Irrenhaus statt auf den Höhen des Olymps. Nein, bei dem Wissen, das buchstäblich über das »Ziel« hinausgeht, handelt es sich um eine Gnosis, freilich nicht um eine Gnosis im frühchristlichen Sinne, in der sich der Gnostiker aufgrund seiner Taufe Christus gleich weiß, um durch sein Wissen sich selbst und die Welt zu erlösen. Nein, es bedarf keiner anderen Taufe als der auf den eigenen Tod, wenn »der Tod das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns« ist (vgl. GA 65, 284). Ist doch Heidegger in diesem Zeugnis, das den Selbstuntergang einschließt, sich treu geblieben von seinem Vortrag vor der Marburger Theologenschaft Der Begriff der Zeit vom Juli 1924 an.
Dass schon damals das Thema gewissermaßen in der Luft lag, zeigt eine kleine Entdeckung, die Einblick in das Wesen der Gnosis gewährt. So vermerkt Erik Peterson zu den sog. Oden Salomos – es »war eine große Überraschung, als der englische Gelehrte Rendel Harris 1909 den Text der Oden Salomos beinahe vollständig aus einer syrischen Papyrushandschrift mitteilen konnte. Im Anschluß an diese Publikation entstand eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur, die in der Schrift von Gerhard Kittel über die Oden Salomos (Leipzig 1914) aufgezählt ist.« [Unveröffentlichtes Manuskriptfragment aus der Vorlesung »Geschichte der altkirchlichen Literatur«, Göttingen, im Wintersemester 1923/24]:
Daß statt der Geburt des göttlichen Kindes die Taufe als die eigentliche Geburtsgeschichte erzählt wird, weist auf den gnostischen Charakter der Salomo-Oden hin. Diese Modifikation ist uns aus der gnostischen Literatur bekannt. In der Gnosis verschwindet ja der Unterschied zwischen Christus und dem Gnostiker; sie sind beide eins geworden bis zur völligen Identifikation. Am Anfang des Lebens des Gnostikers steht aber natürlich die Taufe, die geistliche Wiedergeburt. Und daraus erklärt sich dann, daß die Gnostiker die Taufe Jesu in dieser Weise in den Vordergrund rücken.
Die Identifizierung des Gnostikers mit Christus ist in den Oden oft ausgesprochen. So heißt es z.B. in der 17. Ode: »Ich ward bekränzt durch meinen Gott, mein lebendiger Kranz ist er. / Und ich ward gerecht erfunden durch meinen Herrn, meine unvergängliche Rettung ist er. / Ich ward vom Eitlen befreit und stehe nicht als Verurteilter da. / Meine Fesseln wurden von ihren Händen abgerissen; / Antlitz und Gestalt einer neuen Person habe ich bekommen. / (…) und ich öffnete Türen, die verschlossen waren. / Ich habe zerrissen eiserne Riegel. / Mein Eisen aber ward glühend und schmolz vor mir. / Und nichts erschien mir verschlossen, / weil ich die Pforte zu allem war. / Und ich ging zu allen meinen Gefangenen, sie zu befreien, / daß ich keinen ließe, der gebunden wäre oder bände, / und ich gab meine Erkenntnis ohne Neid und meine Bitte in meiner Liebe. / Und ich säte meine Früchte in die Herzen und verwandelte sie in mir. Und sie empfingen meinen Segen und lebten, / und sie versammelten sich zu mir und wurden gerettet, / weil sie mir die Glieder waren und ich ihr Haupt. / Lobpreis dir, unserem Haupt, Herr, Gesalbter! Hallelujah!« – Der Gnos...