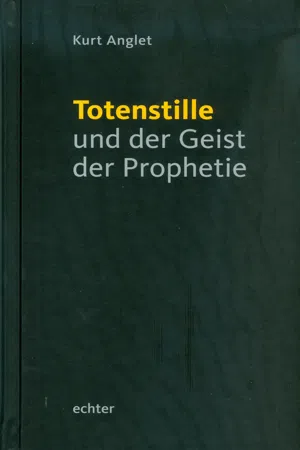![]()
Eine commode Religion
| I. | WUNSCHWELT UND HIMMELREICH |
»… und eine commode Religion.« Mit diesen Worten endet Georg Büchners Lustspiel »Leonce und Lena«, beschließt darin die lange Wunschliste für eine heile Welt, wie sie heiler keine Werbung oder politische Utopie ausmalen könnte. Die Wirklichkeit freilich war und ist eine andere. Mögen die politischen Utopien längst ausgedient haben und mag sich die Werbung mit der Weckung von Bedürfnissen begnügen, die nach einer umgehenden Befriedigung verlangen – hartnäckig hat sich, zumindest in der westlichen Gesellschaft, das Verlangen nach einer Religion gehalten, die sich ganz unseren Wünschen und Träumen von einer heilen Welt anbequemt, insofern man ihr überhaupt noch Glauben schenkt. Und wenn schon Glauben, dann glaubt man halt, was man selbst glaubt: »Ich habe mich durch Erfahrung von der Wahrheit des Spruches in der Bibel überzeugt und ihn zu meinem Leitstern gemacht: Trachtet am ersten nach Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen.« Soweit Hegel augenzwinkernd in einem Brief an Knebel (vom 30.8.1807; vgl. Briefe von und an Hegel, 186). Wo der Weltgeist höchstpersönlich die Geschäfte regelt, gerät das Reich Gottes zur bloßen, letzthin überflüssigen Beigabe. Der gesellschaftliche Fortschritt löst offensichtlich ganz von sich aus ein, was keinem Geringeren als Christus selbst zufolge höchste Priorität für seine Jünger besitzt: »Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben« (Mt 6,31–33). Offenkundig weiß es jedoch der Philosoph besser, dem alle Reiche dieser Welt mehr bedeuten als das Reich Gottes und der Reichtum dieser Welt mehr als seine Gerechtigkeit. Nur hat sich gut zweihundert Jahre später die Hegelsche List der Vernunft als ein Akt der Selbstüberlistung erwiesen: Die Reiche dieser Welt versinken in einem Schuldenmeer, dessen Tiefe jede Meerestiefe übertrifft. Das ist die Wahrheit, über die keine Dialektik hinausführt. Immerhin ließ sich der babylonische König Nebukadnezar noch durch Daniels Deutung seines Traums beeindrucken, demzufolge durch einen Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhand von einem Berg löste und ein gewaltiges Standbild aus Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton – das Symbol für die Abfolge großer Weltreiche – zu Staub zertrümmerte (Dan 2,44):
Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht; dieses Reich wird Er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten; es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen.
Obschon Zeitzeuge solcher Zerstörung, hat weder der zurückliegende Erste Weltkrieg noch das prophetische Wort Daniels irgendwelche Spuren bei einem bekannten Theologen hinterlassen. Wir haben in diesem Zusammenhang in dem Band »Auferstehung und Vollendung« bereits auf Adolf von Harnack verwiesen, der nach einem Vortrag des jungen Karl Barth moniert, »dass dieser Vortrag einen Rückfall von der heutigen Forschung darstelle. Alles, was man heute so schön überwunden habe, worüber man in fortschrittlicher Ehrlichkeit hinausgekommen sei, werde hier wieder aufs Tapet gebracht: die christologischen Dogmen und sogar ›die Auferstehung des Fleisches‹! Solchen Traditionalismus müsse er, von Harnack, sich verbitten« (E. Busch, Meine Zeit mit Karl Barth. Tagebuch 1965–1968, Göttingen 2011, 102 f.). Ob Auferstehung oder Wiederkunft Christi, ob Menschwerdung des Logos oder Kreuz Christi, ob Sündenfall oder Gericht, von Teufel oder Hölle ganz zu schweigen – alles fällt dem Verdikt eines fortschrittstrunkenen Denkens anheim, obwohl Millionen Menschen erst kurz zuvor die Hölle des Ersten Weltkriegs erlebt haben – von der Hölle des Zweiten erst gar nicht zu reden. Genau hier hat eine Theologie, die ihre eigene Überlieferung ernst nimmt, heute einzusetzen, anstatt sich oder der Menschheit eine heile Welt vorzugaukeln, die es nicht gibt, niemals gab und auch nicht geben wird, wenn man den Schriften der alttestamentlichen Prophetie und des Neuen Testaments Glauben schenkt. Denn die Vollendung der Welt vollzieht sich durch die Überwindung des Negativen, der Mächte des Bösen hindurch, die in unserer Zeit so virulent wirken wie nur zur Zeit Harnacks oder Hegels. Und von dieser Wirklichkeit her sind die Zeugnisse des Neuen wie des Alten Testaments zu deuten, nicht aus den Phantasmagorien einer »fortschrittlichen Ehrlichkeit«, die lediglich den Selbstbetrug verschleiert, der sich hinter ihrer Maske verbirgt.
Derlei Selbstbetrug findet sich nicht allein bei den Repräsentanten des sog. Kulturprotestantismus, die die Wirklichkeit, zumal die Kriegswirklichkeit aus den Augen verloren haben; blind für die Konstellation der biblischen Apokalypse und einer apokalyptischen Moderne. Er manifestiert sich nicht weniger in einer unbändigen Friedensrhetorik, wie sie seit geraumer Zeit in der katholischen Kirche bis in die liturgischen Texte hinein ertönt. So etwa im italienischsprachigen Hymnus zu den Laudes am Sonntag, der enthusiastisch anhebt: »O giorno primo ed ultimo, / giorno radioso e splendido / del trionfo di Cristo!« – Mutet es schon recht eigentümlich an, dass der Tag der Auferstehung als erster und als letzter Tag gepriesen wird, der doch – nach aller neutestamentlichen Überlieferung – noch aussteht, so klingt es noch wunderlicher in der zweiten Strophe: »Il Signore risorto / promulga per i secoli / l’editto della pace.« Was solcherlei Friedensedikt besagt, erklärt die dritte Strophe: »Pace fra cielo e terra, / pace fra tutti i popoli, / pace nei nostri cuori.« Einmal abgesehen von der letzten Bekundung, der des Herzensfriedens, findet sich nichts, aber auch gar nichts davon in den neutestamentlichen Schriften; im Gegenteil, die Ankündigung Jesu: »Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen« (Mt 24,35). Und keineswegs ist mit der Auferstehung Christi sein früheres Wort – in Anlehnung an den Propheten Micha (7,6) – abgegolten (Mt 10,34–36):
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein.
Wenn aber schon die Hausgenossen – um wie viel mehr seine Volksgenossen: Die Kinder Israels mussten es in den Jahren zwischen 1933 bis 1945 auf deutschem Boden erleben, nicht einmal als solche anerkannt zu werden. Und wenn den Christen innerhalb der islamischen Welt des Nahen Ostens in ihrer angestammten Heimat das Daseinsrecht abgesprochen wird, so zeugt das ja nicht allein von einer Verletzung der Menschenrechte, sondern von der Bedrängnis, der die Christen in ihrer Umgebung von Anfang an ausgesetzt waren. Ihnen gilt die Friedensverheißung, die Christus an seine Jünger richtet: »Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht« (Joh 14,27). In diesem Sinne beschließt er seine Rede vor seinem Abschiedsgebet: »Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.« Darin – in seinem Kreuz und seiner Passion – liegt sein Triumph über die Welt, die von seiner Auferstehung aus offenbar wird.
Denn so anerkennenswert alle Friedensbemühungen auf dieser Erde sind – nicht umsonst werden in der Bergpredigt diejenigen, die Frieden stiften, von Christus seliggepriesen; ja ihre Seligpreisung ist mit dem Zusatz versehen: »denn sie werden Söhne Gottes genannt werden« (Mt 5,9) –, so werden bis auf den heutigen Tag Christen um des Namens Christi willen verfolgt. Nicht allein von feindlicher Hand, sondern selbst unter christlichen Herrschern im Mittelalter bezahlten Fromme und Heilige mit ihrem Leben, so Wenzel und Johannes Nepomuk in Böhmen, Stanislaus in Polen, Thomas Becket in England; von der Neuzeit mit ihren Konfessionskriegen und Revolutionen gar nicht zu reden. Mochte das Leben damals auch weithin – nicht zuletzt durch wahrhaft fromme Fürsten und Könige – christlich geprägt sein, die Versuchung, das Reich Gottes mit einer politischen Theokratie zu verwechseln, war von Anfang an gegeben, ja, währt buchstäblich »bis heute«: »Seit den Tagen Johannes’ des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich« (Mt 11,12). Daher sind die Mahnungen der hl. Hildegard von Bingen an Bischöfe und Kleriker, sich nicht einem feudalen Lebensstil anzubequemen, keineswegs bloß moralischer Natur; vielmehr liegt in ihm eine, wenn nicht die Ursache für den Niedergang des Glaubenslebens, das niemals sein Maß an sich hat, an dem, was Menschen denken oder wünschen, sondern allein am Willen Gottes. Einer, der das am eigenen Leibe zu spüren bekam, weil er es klar aussprach, nämlich der hl. Johannes Chrysostomus († 407), der als Patriarch von Konstantinopel wegen seiner klaren Worte bei der Kaiserin in Ungnade fiel und auf dem Weg in die Verbannung von einem Soldaten zu Tode gehetzt wurde, hat das in seiner Auslegung zum ersten Brief an Timotheus unmissverständlich zum Ausdruck gebracht (Hom. 10,2: PG 62, 551 f.):
Leuchtet wie Lichter in der dunklen Welt [Phil 2,15], sagt der Apostel. Darum hat er uns hier zurückgelassen, dass wir andere lehren, als Sauerteig wirken, wie Engel unter Menschen wandeln, wie Erwachsene unter Kindern, wie geistliche Menschen unter sinnlichen, damit sie davon Gewinn haben und damit wir so Samenkörner werden und viele Frucht bringen.
Doch dann macht Chrysostomus gleichsam die Rechnung auf, hält den Gläubigen den Spiegel vor, indem er ihnen aufzeigt, wie die Wirklichkeit aussieht:
Man brauchte so etwas nicht zu sagen, wenn unser Leben wirklich leuchtete. Es brauchte keine Belehrungen, wenn wir Taten sprechen ließen. Es gäbe keine Heiden, wenn wir wahre Christen wären, wenn wir die Gebote Christi hielten, wenn wir Unrecht und Benachteiligung ertrügen, wenn wir Beschimpfung mit Segen und Böses mit Gutem vergälten. Niemand wäre dann so empfindlich, dass er nicht alsbald die wahre Religion annähme, wenn wir alle so lebten. Aber dem Geld huldigen wir genau wie sie, ja noch mehr als sie. Vor dem Tod haben wir Angst wie sie. Armut fürchten wir wie sie, Krankheit ertragen wir schwerer als sie. Ehren und hohe Stellungen erstreben wir genauso wie sie, und ebenso plagt uns wie sie der Geiz. Wie sollen sie vom Glauben überzeugt werden? Durch Wunderzeichen? Wunder geschehen nicht mehr. Durch unser Verhalten? Das aber ist schlecht. Durch Liebe? Keine Spur davon ist zu sehen. Darum werden wir auch einst nicht nur über unsere Sünden, sondern auch über den Schaden Rechenschaft ablegen müssen, den wir angerichtet haben. Kommen wir doch endlich zur Vernunft! Wachen wir auf! Geben wir ein Beispiel himmlischen Lebens auf der Erde! Unsere Heimat ist im Himmel [Phil 3,20].
Dem wäre nichts hinzuzufügen, wenn, ja wenn sich in unserem demokratischen Zeitalter zumindest in der westlichen Welt nicht einiges geändert hätte. Unsere Heimat soll im Himmel sein, wenn selbst Theologen die leibliche Auferstehung leugnen? Ein Beispiel himmlischen Lebens auf der Erde geben, wenn wir uns ganz diesem Erdenleben angepasst haben? Oder gar »die wahre Religion« verbreiten, wenn eine Religion so viel zählt wie die andere, keine den Anspruch auf Wahrheit stellen darf? – Die Liste der Fragen ließe sich verlängern angesichts von Christen, die zwar Christi Namen tragen, aber sich längst dieser Welt, den Mächten dieses Äons anbequemt haben. Die Gebote Christi haben ausgedient. Allenfalls die Liebe zählt – allerdings eine Liebe, die keiner Gebote bedarf, weil jeder so leben – oder sterben – darf, wie es uns beliebt. Lebenswandel oder Glaubensleben scheinen jedem selbst anheimgegeben, jede Mahnung eine Verletzung persönlicher Autonomie und allgemeiner Toleranz. Bereits Kant, dessen Philosophie es nun wahrhaft nicht am Normativen gebricht, hat in seiner Religionsphilosophie zwischen der jüdischen Gesetzes- und der christlichen Liebesreligion unterschieden, so als ob die Propheten des Alten Bundes und die gesetzestreuen Israeliten Pharisäer im pejorativen Sinne des Wortes wären, dem Christen es jedoch freigestellt wäre, zu glauben, zu denken, zu leben und zu lieben, was er will, wenn er sich nur an die allgemeine Gesetzgebung hielte, wie sie heute durch die Charta der Menschenrechte verbrieft erscheint.
Doch Christus kennt eine derartige Trennung von Gesetz und Liebe nicht, mag er sich auch gelegentlich scharf gegen die Pharisäer wenden, die sich zwar auf das Gesetz berufen, aber die Liebe schuldig bleiben. Die Liebe hebt jedoch nicht das Gesetz auf, sondern erfüllt es, insofern sie dem Sünder Raum gibt, umzudenken, umzukehren, statt im Schlechten, im Abwegigen fortzufahren.
Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, wird im Himmelreich der Größte sein.
Das ist in der Bergpredigt (Mt 5,17–20) gesagt, gewissermaßen eine programmatische Aussage Jesu, über die sich niemand, der sich Christ nennt, so einfach hinwegsetzen kann. Denn man lese den Nachsatz, der den Ernst seiner Aussage unterstreicht: »Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen« (Mt 5,20). Wer meint, es handelte sich hierbei um eine Besonderheit des Matthäusevangeliums mit seiner Hervorhebung des Gesetzes, der sei auf eine noch radikalere Formulierung im Lukasevangelium verwiesen: »Aber eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe aus dem Gesetz wegfällt« (Lk 16,17).
Bei der Trennung von Liebe und Gesetz handelt es sich um eine neuzeitliche Konstruktion, weil Liebe im messianischen Sinne nicht bloß ein romantisches Gefühl, eine subjektive Empfindung bedeutet, sondern einen normativen Kern besitzt, dessen Ursprung Gott, der Vater, darstellt: »Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe« (Joh 15,9–12). In der Regel dürfte es einem Menschen kaum eine Freude bereiten, ein Gebot zu erfüllen; er wird darin eher eine Pflichterfüllung sehen, deren Ausführung ihm allenfalls eine gewisse Genugtuung, ggf. ein gutes Gewissen verschafft. Die Freude, von der Jesus spricht, besitzt jedoch nicht ihr Maß an sich selbst, sondern in der messianischen Selbsthingabe, die seine Jünger zur apostolischen Selbsthingabe herausfordert; ganz in diesem Sinne fragt der auferstandene Christus dreimal Petrus nach seiner Liebe, bevor er ihm seine Herde anvertraut und ihn – unter Hinweis auf seinen Tod – zur Nachfolge aufruft (vgl. Joh 21,15–19). Auch hier, in den Abschiedsreden (Joh 15,13–17), verweist er auf seinen Tod, allerdings den eigenen, der zum Maß seiner Freundschaft und ihrer Erwählung erhoben wird:
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf: Liebt einander.
Bei der Christusliebe handelt es sich also um einen Auftrag, der von Gott, dem Vater, ausgeht. Ohne diesen seinen theologischen, ja theozentrischen Ursprung wäre es absurd, von Freundschaft oder gar Liebe zu reden. Kein Mensch würde einen anderen als seinen Freun...