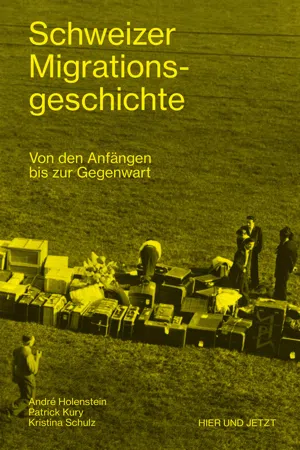![]()
1 Am Anfang waren Einwanderer
Migration und eidgenössischer Gründungsmythos
Migrationsbewegungen der Frühzeit
Wanderungen im römischen Vielvölkerreich
Spuren in Orts-, Gewässer- und Gebirgsnamen
«Der Anfang und das gar ehrenhafte Herkommen der drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden. / Uri hat als erstes Land vom Römischen Reich die Freiheit erhalten, dort zu roden und zu wohnen. / Nachher sind Römer nach Unterwalden gekommen, denen hat das Römische Reich auch bewilligt, dort zu roden und zu wohnen. / Später sind Leute aus Schweden nach Schwyz gekommen, da ihrer daheim zu viele waren. Auch diese empfingen vom Römischen Reich die Freiheit, da zu roden und zu wohnen.»13 (Das Weisse Buch von Sarnen)
Migration und eidgenössischer Gründungsmythos
In den Meistererzählungen der Schweizer Geschichte hat Migration bislang kaum Platz gefunden. Dies überrascht, spielt sie doch eine wichtige Rolle in der mythischen Erzählung von den Anfängen der Eidgenossenschaft im «Weissen Buch von Sarnen» (um 1470). Diese erste zusammenhängende Darstellung der eidgenössischen Gründungsgeschichte setzt nicht etwa mit dem Widerstand gegen die bösen adeligen Vögte ein, sondern mit einer Herkunftssage. Noch bevor die Chronik vom Freiheitskampf der Waldstätte, von Wilhelm Tell und dem Schwur der ersten Eidgenossen auf dem Rütli berichtet, erzählt sie von Einwanderern, denen das Römische Reich erlaubt habe, in den Tälern um den Vierwaldstättersee zu roden und dort zu bleiben. Zuerst seien Siedler nach Uri gekommen, dann hätten Römer Unterwalden bevölkert, und schliesslich seien Leute aus Schweden nach Schwyz gelangt.
In den 1480er-Jahren fügte der Geistliche Heinrich von Gundelfingen (1440/1450–1490) dieser Sage weitere Einzelheiten hinzu.14 Demnach habe in unvordenklicher Zeit in Skandinavien eine Hungersnot geherrscht, die den König von Schweden und den Grafen von Ostfriesland gezwungen habe, die Bevölkerung ihrer Länder zu verkleinern. Mit dem Los seien jene Einwohner ausgewählt worden, die übers Meer hätten auswandern müssen. In ihrer Verzweiflung hätten sich die Vertriebenen zusammengeschlossen und seien raubend südwärts bis an den Rhein gezogen. Dort hätten sich ihnen die Franken unter König Priamus in grosser Überzahl in den Weg gestellt. Unter ihrem Hauptmann Swicerus hätten die Schweden und Friesen die Franken aber in die Flucht geschlagen. Auf ihrer Wanderung seien sie schliesslich in die Gegend am Vierwaldstättersee gelangt, die sie an ihre Heimat erinnert habe. Der Graf von Habsburg habe ihnen als Landesherr erlaubt, dort zu siedeln. Darauf hätten sich die Schweden zwischen Pilatus und Gotthard und die Friesen jenseits des Brünigs im Haslital niedergelassen. Jahre später sei die Christenheit in arge Bedrängnis geraten, als der Heidenfürst Eugenius Papst Zosimus und die Kaiser Honorius und Theodosius aus Rom verjagt habe. Da sei der Gotenkönig Alarich diesen zu Hilfe geeilt, wobei ihn die Schwyzer und Haslitaler als standhafte Christen und treue Diener von Papst und Reich unterstützt hätten. Mit ihrem Heldenmut hätten die Schwyzer und Haslitaler in Rom massgeblich zum Sieg der Christen über die Heiden beigetragen. Als Belohnung hätten die Schwyzer auf ihren Wunsch eine rote Fahne mit den Marterzeichen Jesu Christi und die Haslitaler die Fahne des Kaisers, allerdings nur mit dem einköpfigen Adler, erhalten. Reich beschenkt und im Besitz ihrer urkundlich verbrieften Reichsfreiheit seien die Schwyzer und Haslitaler in ihre Täler zurückgekehrt.
Die Herkunftssagen entsprangen nicht der Fantasie ihrer Verfasser, sondern waren um 1500 in den Waldstätten allgemein bekannt. So forderte ein Schwyzer Sittenmandat Ende der 1520er-Jahre die Landleute auf, jeweils beim Mittag- und Betläuten im Andenken an die Vorfahren aus Schweden fünf Vaterunser und fünf Ave-Maria sowie das apostolische Glaubensbekenntnis zu beten. 1531 bekräftigte die Schwyzer Landsgemeinde diese Anweisung: Die Menschen in Schwyz sollten jeden Tag zu Gott beten, so wie dies schon die frommen Vorfahren aus Schweden getan hätten; Gott habe es ihnen mit viel Gnade und Glück vergolten.15 Das Andenken an die Wanderung der Vorfahren gehörte, so zeigen die Beschlüsse, noch im frühen 16. Jahrhundert zur ehrenhaften Identitätsrepräsentation der Schwyzer. Wie ihre frommen und tapferen Ahnen aus Schweden wollten auch die Schwyzer eigenständig bleiben, nur Gott als ihren Herrn anerkennen und an ihrem alten, wahren Glauben festhalten – ein Bekenntnis, das nicht zufällig im Frühjahr 1531 formuliert wurde, als die reformationspolitische Krise in der Eidgenossenschaft auf ihren Höhepunkt im zweiten Kappelerkrieg zusteuerte.
Die fremde Abstammung und die durch Not erzwungene Auswanderung der Vorfahren aus dem hohen Norden haben sich im Gegensatz zu den tyrannischen Vögten, Tells Apfelschuss und dem Rütlischwur kaum ins kollektive Gedächtnis der Waldstätte eingeschrieben. Durch die Brille des Migrationshistorikers gelesen, erhalten diese Herkunftsgeschichten jedoch paradigmatischen Charakter. In ihnen lebt die Erinnerung daran fort, dass Einwanderinnen und Einwanderer den Raum bevölkert und kultiviert haben, wo in den letzten Jahrhunderten die Schweiz entstanden ist.
Migrationsbewegungen der Frühzeit
Das Ende der letzten Eiszeit bietet sich als Anfangspunkt für eine Geschichte der Migration im schweizerischen Raum an. Nach dem Rückzug der Gletscher und mit der Bildung einer stabilen Pflanzendecke konnten Tiere und Menschen aus verschiedenen Richtungen in die Räume zwischen Léman und Bodensee sowie zwischen Rhein und Tessin einwandern, denn in den Jahrtausenden davor waren nur ein Teil des Jurabogens und wenige Gebiete des Mittellandes nicht von Eis bedeckt gewesen. Um 15 000 v. Chr. gelangten Tiere und Menschen zuerst ins Mittelland und nach zirka 12 700 v. Chr. in die inneralpinen Gebiete. Fortan ernährten sich kleinere Gruppen nomadisierender Wildbeuter für viele Jahrtausende von der Jagd, dem Fischfang und der Sammelwirtschaft.
Ab etwa 6500 v. Chr. breiteten sich Ackerbau und Viehzucht – ausgehend vom Gebiet des so genannten Fruchtbaren Halbmonds zwischen der Levante und dem heutigen Iran – in Europa aus (so genannte neolithische Revolution), indem Bauernvölker einwanderten oder die Wildbeuter die bäuerliche Lebensweise von Nachbarn übernahmen. Im schweizerischen Raum sollen der Ackerbau ab etwa 6500 v. Chr., die Viehzucht ab etwa 5400 v. Chr. betrieben worden sein, wobei Jagen und Sammeln noch für lange Zeit wichtig blieben. Sesshaftigkeit kennzeichnete die neue Kultur, die in der Schweiz mit frühesten archäologischen Spuren von bäuerlichen Siedlungen am Ende des 6. Jahrtausends v. Chr. in der Nordschweiz (Schaffhausen, Basel-Landschaft), im Wallis und im Tessin fassbar wird. Die Sesshaften betrachteten fortan die nomadisierende Lebensweise der Wildbeuter als räuberisch und zerstörerisch. Nomaden und Bauern kamen sich bei der Beschaffung der Nahrung und bei der Kontrolle über die Ressourcen in die Quere. Die Bauernkulturen entwickelten ihre «notorische Aversion gegen alles Fremde».16
Spätestens in der Eisenzeit (8.–1. Jahrhundert v. Chr.) bewohnten keltische Stämme den Raum der heutigen Schweiz. Umstritten ist allerdings, wann diese sich im grössten Teil des schweizerischen Raums – mit Ausnahme bestimmter Täler in Graubünden (Räter) – niedergelassen haben. Ihre Namen (Helvetier, Allobroger, Rauriker, Lepontiner, Uberer, Seduner, Veragrer, Nantuaten) sind nur indirekt in Beschreibungen griechischer und römischer Autoren der Antike überliefert. Unter ihnen waren die Helvetier im 1. Jahrhundert v. Chr. der grösste Stamm. Sie lebten in weiten Teilen des Mittellandes mit Aventicum (Avenches) als Zentrum.17
Die «keltische Frage» hat ihre besondere Bedeutung für die Schweizer Geschichte, weil humanistische Geschichtsschreiber im frühen 16. Jahrhundert in den Helvetiern das nationale «Urvolk» der Schweiz erkannt haben wollten. Die Helvetier gingen fortan in die schweizerische Nationalideologie ein, und ihr Name diente in der Neuzeit dazu, das nationale Band zu beschwören, welches das Konglomerat partikularer Orte trotz aller inneren Gegensätze zusammenzuhalten schien. So wurden bereits im 17. Jahrhundert die Gesamtheit der 13 Orte und ihrer Zugewandten als «Corpus Helveticum» bezeichnet, und «Helvetia» entwickelte sich zur personifizierten weiblichen Repräsentationsfigur der Schweiz. 1798 löste die «Helvetische Republik» die alte Eidgenossenschaft ab, und nach der Gründung des Bundesstaats 1848 wurde, um keine der Landessprachen zu bevorzugen, «Confoederatio Helvetica» offizieller lateinischer Staatsname.
Es entbehrt allerdings nicht der Ironie, dass ausgerechnet der Name jenes Stammes zum Synonym für die Schweiz werden konnte, der sich möglicherweise nur kurze Zeit in diesem Raum aufhielt und diesen aus freien Stücken wieder verliess. Wahrscheinlich wanderten die Helvetier erst kurz vor 100 v. Chr. aus dem süddeutschen Raum ins schweizerische Mittelland ein. Doch schon 58 v. Chr. zerstörten sie hier ihre Wohnstätten und zogen aus ungeklärten Gründen unter ihrem Führer Divico weiter, um sich zwischen Bordeaux und Toulouse niederzulassen. Dort hatten sie sich bereits 107 v. Chr. aufgehalten und bei Agen gemeinsam mit den germanischen Kimbern ein römisches Heer geschlagen. Der römische Feldherr Julius Caesar aber setzte der Auswanderung der Helvetier in der Schlacht bei Bibracte 58 v. Chr. ein Ende. Die geschlagenen Helvetier gelangten nicht ins Land ihrer Träume, sondern wurden in stark dezimierter Zahl ins schweizerische Mittelland zurückgeschickt, wo sie – nunmehr unter römischer Herrschaft – das Land gegen Einfälle der Germanen beschützen sollten.
Wanderungen im römischen Vielvölkerreich
War das Südtessin schon 194 v. Chr. von den Römern erobert worden, so gehörte nach der Unterwerfung der Helvetier 58 v. Chr. der grösste Teil des schweizerischen Raums bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. zum Römischen Reich, ohne darin allerdings eine ethnische oder administrative Einheit zu bilden. Im Zuge dieser Eingliederung vermischten sich die einheimischen Kulturen der Kelten und Räter mit jener der Römer. Wenn auch diese Akkulturation als «Romanisierung» bezeichnet wird, darf man sie sich nicht als Übermächtigung der unterworfenen Völker durch die Römer vorstellen. Vielmehr eigneten sich Kelten und Räter die römische Kultur an. Nicht zuletzt durch die Eingliederung der indigenen Eliten in die römische Herrschaftsordnung entstand so die besondere Kultur der Galloromanen. Da sich die römische Einwanderung auf ein paar Tausend Veteranen und Soldaten, einige Hundert Beamte, Ingenieure, Gewerbetreibende und Geschäftsleute beschränkte, blieb das keltische Substrat in der gallorömischen Kultur stark.18 «Der Einfluss der Römer auf die Völker der Kelten und Räter bedeutete für diese nicht nur Fremdherrschaft, sondern auch die Integration in eine grössere Welt und die Einbettung in eine sehr reiche und vielfältige Kultur, die den Nährboden für die Entwicklung Europas bildete.»19
Die Zugehörigkeit zum Römischen Reich brachte den schweizerischen Raum erstmals mit einer urbanen Kultur in Berührung. Die Bevölkerung genoss Schutz und eine lange Friedenszeit. Die Römer legten ein überregionales Strassennetz an und prägten damit langfristig die Raumbildung und Siedlungsentwicklung. Im 4. Jahrhundert führten sie das Christentum ein. In der Westschweiz hatten auch die im Jahr 443 von den Römern angesiedelten Burgunder massgeblichen Anteil am Aufbau kirchlicher Strukturen. Um 450 erfolgte mit Romainmôtier die erste Klostergründung auf heutigem Schweizer Boden, um 515 folgte das Kloster St. Maurice. Im selben Zeitraum, zwischen dem späten 4. und dem 6. Jahrhundert, entstanden an den römischen Zentralorten auch die Bischofssitze Martigny (später verlegt nach Sitten), Augst (später verlegt nach Basel), Windisch, Genf, Chur und Lausanne.
Die Romanisierung erfolgte regional unterschiedlich rasch und intensiv. Sie prägte das Genferseegebiet und das Unterwallis deutlich stärker als das nordwestliche Mittelland, die Nordostschweiz oder die Alpentäler. In der Westschweiz, in Rätien und im Tessin bildeten die Galloromanen über viele Jahrhunderte die Mehrheit der Bevölkerung und legten auf lange Sicht betrachtet das Fundament für die Entstehung der romanischen Schweiz.
Anders verhielt es sich in der Nordschweiz. Seitdem die Grenze des Römischen Reichs an den Rhein verlegt worden war (260 n. Chr.), waren das schweizerische Mittelland und die Bündner Alpenpässe dem Einfluss germanischer Völker ausgesetzt. In der Spätantike schwankte das Verhältnis der Römer zu den Germanen lange «zwischen Konfrontation und Kooperation».20 Im 5. und 6. Jahrhundert gelangten mehrere germanische Völker in den schweizerischen Raum. Im Südwesten siedelten die Römer Reste der Burgunder an (443 n. Chr.), die fortan als ihre Verbündeten gegen die Hunnen und Germanen kämpften und sich rasch in die gallorömische Kultur integrierten. In der zweiten Hälfte des 6. und im 7. Jahrhundert gelangten die Alemannen, die Ende des 5. Jahrhunderts unter die Herrschaft der Franken gefallen waren, über den Hochrhein ins Mittelland. Rätien kam Ende des 5. und im frühen 6. Jahrhundert kurzzeitig unter die Herrschaft der Ostgoten, während die Südschweiz seit Ende des 6. Jahrhunderts zum Reich der Langobarden in Italien gehörte.
Die Einwanderung der Alemannen aus Süddeutschland betrachtet man heute nicht mehr als systematische Landnahme, sondern als eine sich über Jahrzehnte erstreckende, meist friedliche Infiltration, in deren Folge als Erstes die für die agrarische Nutzung günstigen Lagen besiedelt wurden. Mit dem Einsickern der Alemannen wurde die romanische Bevölkerung langsam assimiliert, das Althochdeutsche breitete sich am Hochrhein sowie in grossen Teilen des Jura, des Mittellandes und der Voralpen aus.
Spuren in Orts-, Gewässer- und Gebirgsnamen
Die mit dem Landesausbau verbundenen Migrationsbewegungen der Frühzeit sind abgesehen von archäologischen Spuren vor allem über die Ortsnamen fassbar. Diese lassen sich verschiedenen Namenschichten und Zeiträumen zuordnen und ermöglichen so näherungsweise Aussagen darüber, wann und durch wen ein Raum besiedelt wurde.21 Für die Schweiz unterscheidet man drei Namenschichten. In Gewässer- und Gebirgsnamen (Aare, Birs, Emme, Rhein; Albis, Alpen) fasst man die älteste Namenschicht, die seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. von keltisch-helvetischen, lepontinischen beziehungsweise rätischen Namen überformt wurde. Die Benennungen von Räumen (Helvetier → Helvetia; Räter → Raetia; Lepontiner → Leventina) und von Siedlungen (Avenches, Biel, Brig, Chur, Moudon, Olten, Solothurn, Thun, Winterthur, Yverdon) sind Ausdruck davon.
Mit der Eingliederung des schweizerischen Raums ins Römische Reich wurde diese älteste Namenschicht seit der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. mit romanischen Namen überlagert und ergänzt. Verbreitet sind Siedlungsnamen, die auf die lateinischen Ausdrücke «campus» (Feld) oder «curtis» (Hof) zurückgehen (Campo TI, Champagne VD, Gempen SO, Gampelen BE, Gampel VS, Court JU, Gurzelen BE, FR und SO, Corcelles BE, NE, VD, Bassecourt JU, Courtelary BE). Auch Gutsnamen, die einen Personennamen mit dem besitzanzeigenden Suffix «-acum» verbinden, verweisen auf römische Besiedlung (Brissago TI, Dornach SO, Erlach BE, Martigny/dt. Martinach VS usw.).
Die alemannische Besiedlung macht sich in einer dritten Phase bemerkbar durch Ortsnamen mit der Endung «-ingen» (ältester alemannischer Siedlungsraum, 6./7. Jahrhundert: Itingen BL, Seftigen BE), mit der Endung «-i(n)ghofen»/«-ikofen» (erster Ausbauraum, 7./8. Jahrhundert: Zollikofen BE, Zollikon ZH, Etziken SO, Etzgen AG) sowie mit der Endung «-wil», «-wiler» (zweiter Ausbauraum, 8.–11. Jahrhundert: Bärschwil SO, Hergiswil NW, Rapperswil BE, SG usw.). Die Verbreitung der Ortsnamen lässt auf ein Wachstum der Bevölkerung und die Gründung neuer Siedlungen ab dem 7. Jahrhundert schliessen. Um 700 waren in der Nordost- und Nordwestschweiz diejenigen Räume wieder besiedelt, die es schon in römischer Zeit gewesen waren; zuvor nicht oder kaum besiedelte Zonen wurden neu erschlossen.22 Die deutsch-romanische Sprachgrenze blieb über die längste Zeit beweglich, wie die Verteilung von Ortsnamen mit dem Kompositum «Walen», «Walchen», «Welsch» zeigt (Walensee beziehungsweise Walenstadt SG, Walchwil ZG, Wahlen BL, Wahlern BE, Wahlendorf BE, Welschenrohr SO), die auf eine Kontaktzone zum romanischen Sprach- und Kulturraum verweisen. Erst in der frühen Neuzeit stabilisierte sich die Sprachgrenze, bis im 19. und 20. Jahrhundert die starke Zuwanderung in die Städte das Gewicht der einzelnen Sprachgruppen besonders entlang der Sprachgrenze (Biel, Freiburg, Sitten) wieder veränderte.
![]()
2 Stadtgründungen und Landesausbau im Hoch- und Spätmittelalter
Brennpunkt Stadt
Bürgerrecht und Bürgergeld als Instrumente der Regulierung
Migrationsräume und Zielorte
Die Migrations- und Integrationspolitik der Stadt Zürich
Der Migrationshintergrund der städtischen Machtelite
Der Landesausbau der Walser in den Hochalpen
Ursachen und Motive der Walserwanderung
Migration in der Wirtschaft der Walser
Zwei zentrale Entwicklungen prägten die Schweizer Migrationsgeschichte des Hoch- und Spätmittelalters: die Erschliessung neuer ländlicher Siedlungsräume, der so genannte Landesausbau, und die Gründung zahlreicher Städte. Beide Vorgänge setzten eine säkulare Tradition kolonisatorischer Migration fort. S...