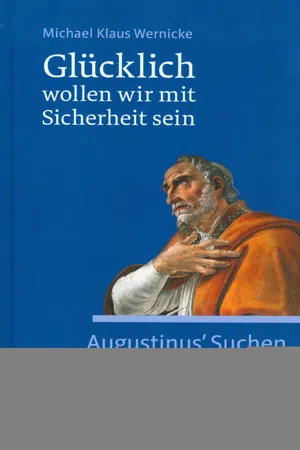![]()
Der Kampf für die katholische Kirche und ihre Lehre
Als Valerius plante, seinen Priester Augustinus zum Bischof zu weihen, handelte er mit kluger Berechnung. Bischof Aurelius gegenüber hatte er persönliche Gründe für sein nicht den kirchlichen Gesetzen entsprechendes Begehren angeführt: Er sei alt und hinfällig. Es könnte noch hinzugefügt werden, dass er Grieche war und die lateinische Sprache nicht wirklich beherrschte. Wichtiger aber war, dass Valerius die außerordentlichen Fähigkeiten Augustins erkannt hatte und sich, hellsichtig, wie er war, über die desolate Lage der katholischen Kirche in Afrika keine Illusionen machte. Er sollte sich nicht täuschen. Augustinus und seine Mitbischöfe, von denen etwa zehn aus dem Kloster von Hippo hervorgegangen sind, setzten eine stille Reform in Gang, gaben den eingeschüchterten Katholiken neues Selbstbewusstsein. Mit Gottes Hilfe, so berichtet Possidius, erhob die katholische Kirche in Afrika nach und nach wiederum das Haupt.
Kampf gegen den Donatismus
Der Catholica war nämlich in Augustins Heimat eine gefährliche Konkurrenz erstanden: die Donatisten, die vielerorts, auch in Hippo, die Mehrheit der Christen stellten. Sie hatten ihre Kirchen, ihre Bischöfe, ihre Priester. Die Spaltung zerriss die nordafrikanische Kirche so sehr, dass Bischof gegen Bischof stand, dass Christen sich gegenseitig verfolgten und dass sogar das bürgerliche Zusammenleben dadurch häufig beeinträchtigt war.
Der Donatismus hatte seinen Ursprung in der Zeit nach der großen Verfolgung unter Kaiser Diokletian, die mit einem Edikt begonnen hatte, das im Februar 303 in Nikomedien, der Residenz des Herrschers, veröffentlicht worden war. Den Christen wurde geboten, ihre heiligen Bücher, die Bibel, den Behörden auszuliefern, die sie dann verbrannten. Gotteshäuser sollten zerstört werden, gottesdienstliche Zusammenkünfte wurden untersagt. Viele Kleriker traf Verhaftung oder Tod, weil sie das Edikt nicht befolgten. Nicht alle Bischöfe und Priester waren so tapfer: Um des lieben Lebens willen lieferten sie die heiligen Bücher aus.
Als im Jahre 311 Bischof Mensurius von Karthago gestorben war, wählte man den Diakon Cäcilian zum Nachfolger. Der hatte sich, weil er vor einer unangemessenen Verehrung der Martyrerreliquien abgeraten hatte, die Abneigung einer begüterten und einflussreichen Dame namens Lucilla zugezogen. Eine Synode von 70 Bischöfen, die mehrheitlich Numidier waren, erklärte die Weihe des Cäcilian für ungültig, weil der als Traditor, Bücherauslieferer, verdächtigte Felix, Bischof von Apthugni, dabei mitgewirkt hatte, und schlug als neuen Kandidaten den Diakon Maiorinus vor, der auch von Lucilla unterstützt wurde, wählte und weihte ihn. Der wichtigste afrikanische Bischofssitz Karthago hatte nun zwei konkurrierende Bischöfe. Konstantin der Große, der davon Mitteilung erhielt, war entsetzt, weil er, wie er selbst versicherte, jede Kirchenspaltung und Uneinigkeit unter Christen verabscheute. Er beorderte drei italienische und 20 afrikanische Bischöfe nach Rom, die unter Vorsitz des Papstes Miltiades entscheiden sollten, welcher Bischof der rechtmäßige sei. Die Beratungen führten zum Ergebnis, dass Wahl und Weihe des Cäcilian gültig seien, er also der Oberhirte von Karthago sei.
Durch den Schiedsspruch des Papstes war die Spaltung leider nicht beendet. Maiorinus legte Beschwerde ein, und Konstantin berief im Jahre 314 eine Synode nach Arles, die sich wiederum für Cäcilian aussprach, deren Beschluss die Donatisten wiederum nicht annahmen. Auf der Rückreise von Arles verstarb Maiorinus in Mailand. Unverzüglich wählten numidische Bischöfe den Donatus zum Nachfolger des Verblichenen, nach dem die Anhänger der schismatischen Kirche bis zum heutigen Tag benannt sind: Donatisten.
Seltsamerweise zeigte sich der so sehr um die Einheit bemühte Konstantin später duldsam. 321 erließ er ein Edikt, mit dem er anordnete, dass die Donatisten zu dulden seien. Als der katholische Bischof von Cirta sich bei Konstantin beschwerte, dass seine Basilika, deren Bau der Kaiser doch für die Katholiken finanziert hatte, von den Schismatikern besetzt sei, mahnte ihn der Herrscher zur Geduld.
Kaiser Konstans, der Sohn Konstantins, schickte „Friedensstifter“ nach Afrika: Paulus und Macarius. Sie suchten nach einem Kompromiss, den die Donatisten jedoch entschieden ablehnten. Es kam zu blutigen Tumulten, man rief nach Truppen, die auf ihre Art den Frieden wiederherstellten. Eine Reihe von Donatisten starb den Martyrertod, hochverehrt von ihren Glaubensgenossen, andere, unter ihnen Donatus, flohen nach Gallien.
Kaiser Julian jedoch, den christliche Historiker den „Abtrünnigen“, „Apostata“, nennen, rief während seiner kurzen Regierungszeit von 361 bis 363 alle gebannten Bischöfe in ihre Heimat zurück. Diese scheinbar humanitäre Maßnahme hatte Böses zum Ziel: Die Christenheit sollte gespalten werden, im Streit versinken und letztendlich verschwinden. Donatus war 355 in Gallien gestorben. Ihm folgte der zweifellos kluge und organisatorisch begabte Parmenian als donatistischer Bischof von Karthago, der dann ab 361 auch dort residieren konnte. Seine Bischofskollegen, denen Julian freie Hand gegeben hatte, setzten sich in den Besitz von Kirchen, deren Gebäude und Altäre sie erneut weihten, deren Gemeinden sie erneut tauften. Denn Weihen und Sakramente der Traditores, der Nachkommen von Auslieferern heiliger Bücher, waren nichts wert, waren ungültig.
Parmenian verfasste ein Werk, das leider verloren ist, dessen Inhalt aber Optatus von Mileve überliefert hat: Die wahre Kirche habe sich, so Parmenian, von der verunreinigten Kirche der Traditores vollständig zu trennen. Die wahre Kirche sei die Braut Christi, wie der Epheserbrief sie beschreibt (Eph 5,27): herrlich, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, heilig und makellos. So sahen es auch seine Anhänger: „Nur Afrika riecht frisch, die ganze Welt stinkt“, behaupteten sie stolz, und: „Groß ist die Kirche der Numidier; wir sind Christen, und wir sind es allein.“
Merkwürdigerweise erstand dem Parmenian ein Gegner aus den eigenen Reihen: Tyconius mit seinem Buch „Liber Regularum“. Ihm erschien fragwürdig, dass Parmenian so eisern daran festhielt, es gäbe eine fleckenlose Kirche, und damit natürlich die donatistische meinte. Das konnte er nicht akzeptieren angesichts der vielen Stellen in der Heiligen Schrift, die von Sünden der Gläubigen reden und zur Reue und zur Umkehr aufrufen. „Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen.“ Das liest man bei Matthäus (Mt 18,15 ff). Auf dem Gang zum Ölberg sagte Jesus zu den Jüngern: „Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen.“ Und auf die vollmundige Versicherung des Petrus, dass er niemals Anstoß an ihm nehmen würde, entgegnete der Herr: „Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“ (Mt 26,31.33 f). Als der Apostel tatsächlich abstritt, Jesus zu kennen, da krähte der Hahn. „Und er ging hinaus und weinte bitterlich“ (Mt 26,69–75). In den Tränen löste sich seine Schuld, wie Ambrosius in einem seiner Hymnen dichtet, und es wurde ihm vergeben.
Von den Donatisten herausgefordert, entwickelte Augustinus Schritt für Schritt sein Kirchen- und Sakramentenverständnis, das für die Kirche des Westens grundlegend wurde. Augustinus machte sich Gedanken über die Merkmale der wahren Kirche: Sie muss katholisch sein, schrieb er in einem Brief an Macrobius, und um zu erklären, was katholisch ist, zitierte er den hochverehrten Bischof und Martyrer Cyprian: Sie breitet ihre Strahlen über alle Völker aus und streckt ihre Äste mit reicher Frucht über die ganze Welt, d. h., sie ist allumfassend, allgemein, universell. Die wahre Kirche muss die Einheit bewahren, und dazu sind die Gläubigen imstande, „die entsprechend der innersten und hervorragenden Liebe den Heiligen Geist haben“.
Ohne ganz auf das Bild von der Kirche als der unbefleckten Braut Christi zu verzichten, bevorzugte Augustinus immer mehr die Lehre des Apostels Paulus von dem einen Leib: „Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklave und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt“ (1 Kor 12,12 f). „Freuen wir uns also“, rief Augustinus in einer Predigt aus, „und danken wir, dass wir nicht nur Christen, sondern Christus sind“.
Ein anderes Bild für Kirche, das für ihn wichtig wurde, war das von der himmlischen Stadt Jerusalem, wie sie der Brief an die Hebräer beschreibt: „Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem …“ (Hebr 12,22). Die Kirche ist Leib Christi, aber sie ist noch nicht das himmlische Jerusalem. Wir sind noch nicht hinzugetreten „zu Tausende von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind“ (Hebr 22,22 f).
Dass die Donatisten diesen Abstand zwischen dem Jetzt und der Vollendung der Zeit nicht zur Kenntnis nahmen oder nehmen wollten, darin lag nach Augustinus ihr Irrtum. Der Bischof von Hippo leugnete keineswegs die Existenz der Sünder in der Kirche. Er verglich die Kirche mit einer Tenne, auf der das geerntete Getreide, Stroh und Körner vermischt nebeneinanderliegen. So wie die Körner unter dem vielen Stroh kaum zu sehen sind, so ähnlich sei es auch in der Kirche Gottes; auf den ersten Blick könnte man meinen, es gäbe dort nur Spreu, um so viel sind die Bösen in ihr mehr als die Guten.
Deshalb, weil die Kirche eine Kirche ist, in der viele Sünder sich finden, muss sie Ort der Vergebung sein; aber auch ein Ort der Umkehr, ein Raum, in dem das geistliche Leben reifen kann und muss.
Die Sakramente, die von Sündern gespendet werden und deren Gültigkeit, da von Sündern, von Traditores, gespendet, die Donatisten bestritten, sind nach Augustins Ansicht gültig. In einem Vortrag zum Johannes-Evangelium (5,18) lehrte er lapidar und einprägsam: „Die Johannes taufte, taufte Johannes“, da es ja zur Zeit des Täufers die Taufe Christi noch nicht gab, „die aber Judas taufte, taufte Christus. So also, die ein Trunkenbold taufte, die ein Mörder taufte, die ein Ehebrecher taufte, taufte, wenn es die Taufe Christi war, Christus. Ich fürchte nicht den Ehebrecher, nicht den Trunkenbold, nicht den Mörder, weil ich auf die Taube schaue, durch die mir gesagt wird: ‚Dieser ist es, welcher tauft‘“. Das ist auch die Lehre der katholischen Kirche bis zum heutigen Tag.
Es war dem Seelsorger Augustinus ein Herzensanliegen, die Einheit der Kirche wiederherzustellen und die Donatisten zur Rückkehr in die katholische Kirche zu bewegen; und dies war eine Aufgabe, an der er fast 30 Jahre lang arbeitete und die seine geistige und physische Kraft zuweilen bis zur Erschöpfung in Anspruch nahm. Er suchte das persönliche Gespräch, den Briefkontakt mit führenden Persönlichkeiten der Donatisten. Er näherte sich ihnen mit Respekt und großer Höflichkeit. An den „geliebtesten Herrn und ehrwürdigen Bruder Maximinus“, einen Bischof der Donatisten, richtete er im Jahr 392 ein Schreiben. Er versicherte ihm, dass die Anrede „geliebtester Herr“ keine leere Schmeichelei sei, sondern dass er ihn wirklich nicht nur liebe, sondern so liebe wie sich selbst. Er fuhr fort: „Wenn ich dich auch ‚ehrwürdig‘ genannt habe, so ist das nicht so zu verstehen, als würde ich deine bischöfliche Gewalt anerkennen; denn für mich bist du kein Bischof. Doch fasse das bitte nicht als Beleidigung auf … Denn weder dir noch sonst einem Menschen, der uns kennt, ist unbekannt, dass du so wenig mein Bischof bist als ich dein Priester bin. Ehrwürdig nenne ich dich, da ich weiß, dass du ein Mensch bist und dass der Mensch nach Gottes Bild und Gleichnis erschaffen und deshalb schon nach Recht und Ordnung der Natur ehrwürdig ist …“ Was für ein Plädoyer für die Würde aller Menschen! Er, so fuhr Augustinus fort, habe gehört, dass Maximinus einen bereits getauften Diakon wiedergetauft habe, was er, wenn es geschehen sei, für einen Frevel hielte; denn die Taufe, richtig gespendet, ist gültig, selbst wenn ein Häretiker getauft hat. Da er aber keine falsche Anklage erheben wollte, bäte er Maximinus um Stellungnahme. Er nahm dann die Gelegenheit wahr, den Donatisten zu bitten, den ungeteilten Leibrock Christi nicht zu zerreißen, sondern sich zur Einheit der Christen zu bekennen.
Auch den donatistischen Bischof von Hippo, Proculeianus, nannte Augustinus im Briefgruß „den ehrwürdigsten und geliebtesten Herrn“, der, so habe er von Evodius gehört, zu einem Gespräch mit katholischen Bischöfen bereit sei. Darüber freute er sich sehr; denn die Spaltung zu beenden, darum bemühe er sich „mit aufrichtigem Herzen und demütiger, christlicher Furcht“.
Die Führer der Donatisten weigerten sich aber dickköpfig, mit den katholischen Bischöfen in Verhandlung zu treten. Auf eine Einladung der im Jahre 403 gefeierten Synode zu Karthago zu einem Religionsgespräch gab der donatistische Bischof Pirmian eine überaus arrogante Antwort: Es sei gegen die Würde der Martyrersöhne, sich mit den Traditores, den Bücherauslieferern, zusammenzusetzen.
Viele der katholischen Bischöfe verloren die Geduld und riefen nach dem Einschreiten des Staates. Auch Augustinus war enttäuscht und schloss sich den Hardlinern an, zumal da er selbst einem Anschlag der Donatisten knapp entgangen war. Die schismatische Kirche hatte nämlich einen bewaffneten Arm, die Circumcellionen, die sich nach Possidius hordenweise in allen Gegenden Afrikas herumtrieben, Gutshöfe überfielen und Diener Gottes zu Krüppeln schlugen, ihnen Kalk und Essig in die Augen schütteten oder sie sogar ermordeten.
Augustinus war nur deshalb nicht in den Hinterhalt geraten, den ihm die Donatisten gelegt hatten, weil sein Reiseführer irrtümlich vom geplanten Weg abgewichen war und der Bischof und seine Begleitung ihr Reiseziel auf einer anderen Route erreichten. Der Freund Possidius jedoch, inzwischen Bischof von Calama, wurde Opfer eines Überfalls. Er hatte in einem Ort seines Sprengels gegen die Sektierer gepredigt. Die lauerten ihm und denen, die mit ihm waren, auf, nahmen sie fest, raubten ihnen Reittiere und Gepäck und schlugen sie blutig. Misshandlungen erlitten auch andere katholische Bischöfe und Kleriker, die, ehemals Donatisten, zur katholischen Kirche übergetreten waren.
Es waren diese Verbrechen, die den Kaiser Honorius zu einem Unionsdekret bewegten, das er am 12. Februar 405 erließ: Donatistische Gotteshäuser sollten der Catholica übergeben werden, Zusammenkünfte der Schismatiker wurden verboten, unionsunwillige Bischöfe und Kleriker wurden verbannt.
Wegen der Hartnäckigkeit, mit der die Donatisten jedes Religionsgespräch verweigerten, und wegen der Grausamkeit der Circumcellionen begrüßte Augustinus dieses kaiserliche Dekret. In einem im Jahr 408 geschriebenen Brief an einen gewissen Vincentius, Mitglied einer Sekte, die ein Ableger des Donatismus war, erklärte er sein Verhalten. Es wäre Liebe, die verirrten Schafe gewaltsam in den einen Schafstall zurückzuführen. „Würden wir nun diese unsere bisherigen Feinde“, so schrieb er, „die unseren Frieden und unsere Ruhe durch alle mögliche Gewalttat und Hinterlist stören, derart verachten und ertragen, dass wir auf nichts sinnen, nichts tun, wodurch sie in Schrecken gesetzt und gebessert werden könnten, so würden wir in Wahrheit Böses mit Bösem vergelten. Denn wenn jemand sähe, wie sein Feind, durch ein gefährliches Fieber wahnsinnig geworden, dem Abgrund zuliefe, würde er da nicht Böses mit Bösem vergelten, wenn er ihn laufen ließe, statt ihn zurückzuhalten und binden zu lassen?“ Es genüge freilich nicht, die Irrgläubigen in Schrecken zu versetzen; man müsse sie auch belehren. Strafandrohung ohne Belehrung sei Tyrannei. „Du meinst“, so argumentierte er weiter, „man dürfe niemand zur Gerechtigkeit zwingen, obwohl du“ in Jesu Gleichnis von dem großen Gastmahl, zu dem die Geladenen nicht kommen wollten, „liest, dass der Hausvater zu seinen Knechten gesagt hat: ‚Alle, die ihr findet, zwinget sie einzutreten‘“ (Lk 14,21–23).
Die Geschichte war mit dem Edikt des Honorius nicht zu Ende. Es kam zu einem Religionsgespräch im Juni 411 in Karthago. Wortführer der katholischen Partei war Augustinus, der sich eine solche Konferenz immer gewünscht hatte. Seine Sicherheit in der Auslegung der Heiligen Schrift, seine gründliche Kenntnis der Akten und seine Schlagfertigkeit ließen Marcellinus, den Vertreter des Kaisers, zu dem Urteil kommen, dass die Donatisten besiegt seien. Alle Verbote, die gegen sie verhängt und die zeitweise ausgesetzt waren, traten wieder in Kraft. In dieser Situation, in der die Donatisten übel bedrängt waren, machte sich Augustinus zum Sprecher katholischer Milde. Es setzten Massenübertritte zur Catholica ein, und Augustinus wurde als deren Urheber beglückwünscht. Er wehrte solches Lob kühl ab: „Das haben nicht wir bewerkstelligt, sondern Gott.“
Kampf gegen den Manichäismus
Bereits am Anfang seiner seelsorglichen Tätigkeit hatten ihn Katholiken und sogar die Donatisten gebeten, doch den manichäischen Religionsdiener aufzusuchen und mit ihm zu diskutieren. Manichäer, Augustins ehemalige Freunde, gab es also auch noch in Hippo. Sie hatten sich, so Possidius, in die Stadt „eingeschlichen und die Herzen vieler Bürger und Nichtbürger angesteckt“. Augustinus fragte also den Fortunatus, den „Anführer dieser Sekte“, einen ehemaligen Priester, den er aus seiner Zeit in Karthago kannte, ob er zu einem öffentlichen Disput bereit sei. Der nahm die Herausforderung an, und so traf man sich am 28. August 392 in den Thermen des Sossius zu Hippo. Viel Volk hatte sich eingefunden, um das Streitgespräch zu verfolgen. Es dauerte zwei Tage. Am Ende wusste Fortunatus auf die Argumente Augustins keine Antworten mehr, er verlie...