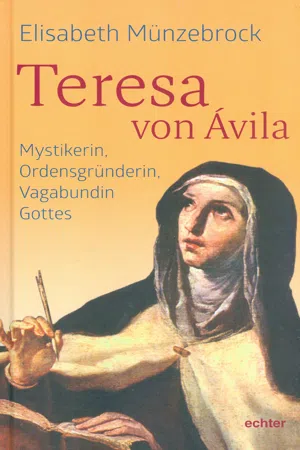![]() Teresa, Gründerin allen Hindernissen zum Trotz – „femina inquieta“ und „Vagabundin in Gottes Diensten“
Teresa, Gründerin allen Hindernissen zum Trotz – „femina inquieta“ und „Vagabundin in Gottes Diensten“![]()
8.San José: erste Klostergründung mit Hindernissen (1562–1567)
Trotz aller „felsenfesten Entschlossenheit“, alles ihr nur Mögliche zu unternehmen, damit dem Herrn treuer gedient würde, gilt auch für (zukünftige) Heilige das Gesetz der Routine und der Rückschläge. Beinahe 28 lange Jahre, von 1535 bis 1563, hatte Teresa im Menschwerdungskloster von Ávila gelebt. Sie bekennt sich zu dieser langen „Durststrecke“, wenn sie schreibt: „So verbrachte ich (…) von den achtundzwanzig Jahren, die es jetzt her sind, seit ich mit dem inneren Beten begonnen habe, mehr als achtzehn in diesem Kampf und dieser Zerreißprobe, gleichzeitig mit Gott und der Welt zu leben“ (V 8,3).
Schließlich besinnt sie sich auf ihre eigentliche Berufung, dem Herrn endlich ohne Abstriche und Halbheiten zu dienen, und überlegt, wie sie dies für sich selber erreichen und auch andere hierfür gewinnen könnte. Wie immer beginnt Teresa beim Nächstliegenden: bei sich selbst.
Kurz zuvor waren ihr die Bekenntnisse des heiligen Augustinus in die Hände gefallen; ein Grund mehr, ihre aufgewühlte Seele in die neue geistliche Richtung des späteren Sólo Dios (Gott allein) zu lenken.
Fast zeitgleich zur ersten Abfassung ihrer Vida trägt sie sich mit dem Gedanken, zum ursprünglichen Ordensideal zurückzukehren und dies in einem eigenen Klösterchen zu verwirklichen. Dieses Ideal, in Form gebracht in der ursprünglichen Regel, war ein Ordensstatut, das von Patriarch Albert von Jerusalem 1209 entworfen und später durch Papst Honorius approbiert worden war: „Jeder bleibe in seiner Zelle, Tag und Nacht das Gesetz des Herrn betrachtend.“9 Durch die 1238 erfolgte Umsiedlung des Ordens nach Europa und ordensinterne Verweichlichungsbestrebungen, begleitet von wiederholten Angriffen durch die Sarazenen, glaubte man das ursprüngliche Ideal nicht mehr durchhalten zu können. 1247 bestätigte Papst Innozenz IV. eine neue, „gemilderte“ Ordensregel, auf die 1434/35 eine weitere „Milderung“ folgte. Teresa hatte durch ihre gelehrten Beichtväter wohl Kenntnis von dieser letztgenannten Fassung und strebte eine Rückkehr zum Statut von 1247 an.
Motivation ihrer Klostergründungen
Teresa hat von nun an nur eines im Blick: den „direkten Draht“ zu Seiner Majestät (Gott) und als Folge die innere (und äußere) Reform einer darniederliegenden Frömmigkeit. Dabei spielen – wie bereits erwähnt – die inneren Ansprachen ihres göttlichen Freundes ebenso eine Rolle wie die ihr zugetragenen Berichte über die sich anbahnende Kirchenspaltung und eine im Glauben „lau gewordene“ Christenheit.
„Oftmals schien es mir, als hielte ich einen großen Schatz in Händen, und wünschte, dass alle sich seiner erfreuten; doch war es mir, als seien mir die Hände gebunden, ihn auszuteilen. Da ich aber sah, dass ich eine Frau und noch dazu eine armselige Frau war, unfähig, etwas für den Dienst des Herrn zu tun, entschloss ich mich, das Wenige, das in meiner Macht stand, beizutragen: den evangelischen Räten mit ganzer Kraft zu folgen und zu ermöglichen, dass die wenigen, die hier bei mir sind, das Gleiche tun.“10
Zu jener Zeit (um 1562) ist Teresa keineswegs nur die sensible, nach innen lauschende Nonne, sie wird in zunehmendem Maße zupackend und ungewöhnlich realistisch. Mit Schmunzeln erfährt der erstaunte Leser, dass der „mystische Höhenflug“ zunächst mit ganz irdisch-merkantilen Problemen beginnt: eine neue Art von kontemplativem Kloster soll gegründet werden, das einen wirklich drastischen Rückzug aus der Welt anstrebt, um die Schwestern völlig frei werden zu lassen von allem „Ballast“ des Reichtums, der Beqemlichkeit und der Abhängigkeit von äußeren Dingen.
Aus heutiger Sicht sind die Absicht dieser „Gründungen“ an sich und das immer wiederkehrende „Durchführungsritual“ (die fast überstürzte Einsetzung des Allerheiligsten, ohne dass das Kloster äußerlich fertiggestellt ist) einigermaßen schwer verständlich. Teresa muss also gewichtige Gründe für diese lebenslangen und all ihre Kräfte aufzehrenden Unternehmungen gehabt haben.
Das von Teresa erwähnte langjährige „geistliche Dahinvegetieren“ im Menschwerdungskloster ist wohl nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Seit ihrer Begegnung mit jenem Bild des wundenüberdeckten Schmerzensmannes (1554) ist ihre Seele aufgewühlt, sie möchte nicht nur ihr eigenes Ordensleben radikal verändern und auf das Wesentliche zurückführen, sondern auch ihren Mitschwestern (und später den Mitbrüdern) den Weg weisen hin zu einer strengen, bescheidenen Lebensführung, die Raum lässt für eine echte Begegnung mit dem Herrn in der Kontemplation.
Und in letzter Instanz ausschlaggebend ist Seine Majestät, Gott selbst, und Sein Auftrag: „Ich hatte den Wunsch, den Menschen zu entfliehen und mich ganz aus der Welt zurückzuziehen … Ich glaubte, es um Gottes willen tun zu können, und dachte, dass es zuerst wohl wichtig wäre, der Berufung zu folgen, die Seine Majestät mir im Orden aufgetragen hatte, indem ich meine Ordensregel mit größtmöglicher Treue beobachtete … Es ergab sich, dass einmal, als wir mit mehreren beisammen waren, eine von uns sagte, ob wir nicht nach der Art der Unbeschuhten11 leben könnten, ob es wohl nicht möglich wäre, ein Kloster zu gründen“ (V 32,10).
Gegen alle Widerstände
„Als ich jedoch eines Tages kommunizierte, trug mir Seine Majestät auf, meine Kräfte dafür einzusetzen, und er machte mir große Versprechungen, ich solle doch nicht von der Verwirklichung meiner Gründungspläne ablassen; man würde ihm damit viel dienen; man solle das Kloster nach dem hl. Josef benennen; den einen Eingang bewache er, den anderen Unsere Liebe Frau; Christus sei mit uns, und dieses Kloster würde zu einem leuchtenden Stern werden, der viel Licht verbreite“ (V 32,11).
Dem heiligen Josef, ihrem geliebten San José, soll das neue Klösterchen geweiht werden: Teresa empfindet seit ihrer Genesung Anfang der 1540er Jahre nach fast drei Jahren totaler Bewegungsunfähigkeit gerade für diesen Heiligen eine fast innig zu nennende Zuneigung und Liebe. Doch noch gilt es, plötzlich sich auftürmende Schwierigkeiten von verschiedenen Seiten zu beseitigen: In Ávila beginnt sich der Plan herumzusprechen und ruft die besorgten Stadtväter auf den Plan wegen der (an sich gerechtfertigten) Befürchtung, die Stadt könne zu den bereits existierenden Klöstern nicht noch einen weiteren – allein auf Almosen basierenden – Konvent verkraften. Die verschiedensten „geistlichen Würdenträger“ geraten sich bezüglich der Neugründung in die Haare, und bis in die letzten Stunden hinein wird das Vorhaben andauernden neuen Widerwärtigkeiten ausgesetzt bleiben: Eine der Stützmauern stürzt in sich zusammen, das ohnehin knappe Geld ist bereits aufgebraucht, und nur von Teresas unerschütterlicher Festigkeit ermuntert, können Bruder, Schwager und Freundinnen den Bau zu Ende bringen.
„Als nun alles erledigt war, gefiel es dem Herrn, dass am Tag des hl. Bartholomäus (24. August 1562) einige Novizinnen eingekleidet wurden und das allerheiligste Sakrament eingesetzt wurde; und mit aller Autorität und Rechtskraft wurde unser Kloster zum glorreichen Vater Josef gegründet im Jahr tausendfünfhundertundzweiundsechzig“ (V 36,5).
![]()
9.Die Madre Fundadora: Teresas Gründungsreisen quer durch ganz Spanien
Teresas ungewöhnliches Organisationstalent
Das Unternehmen der ersten Klostergründung gelingt nicht nur – es wird zum durchschlagenden Erfolg: Der Ordensgeneral P. Rubeo (Giovanni Rossi)12, den sie 1567, fünf Jahre nach der Gründung, in ihr Kloster zum hl. Josef nach Ávila einlädt, als dieser gerade in Spanien weilt, ist begeistert. Er erteilt Teresa weitgehende Gründungsvollmachten: „Dazu ermächtigen Wir in Ausübung Unseres Amtes als Ordensgeneral die ehrwürdige Karmelitin Mutter Teresa, zur Zeit Priorin des Klosters San José und Uns im Gehorsam unterstellt, dass sie in freier Verantwortung Häuser, Kirchen und Grundstücke allerorten in Kastilien als Schenkung annehmen oder erwerben darf, um Klöster für karmelitanische Nonnen zu gründen, die Uns unmittelbar unterstehen.“13
Aus dem Wortlaut des Gründungsauftrags von P. Rubeo erfahren wir auch, wie die Realität dieser Gründungen ausgesehen haben mag: „Die Nonnen werden einen Habit aus braunem Sackleinen tragen. Wenn man es nicht bekommen kann, möge man grobes Tuch nehmen. Ihr Leben folgt der ursprünglichen Regel. (…) Die Anzahl der Nonnen soll fünfundzwanzig in einem Kloster nicht übersteigen.“14
Umsichtig, zielstrebig und nach allen Regeln des „Managements“ gründet und leitet Teresa ihre Klöster. Und die refrainartig wiederkehrende Klage, sie sei ja nichts als ein erbärmliches Weib, steht im krassen Gegensatz zu der – für damalige Verhältnisse – als „Kompliment“ zu interpretierenden Aussage eines hochgestellten Geistlichen: „Man hat mir gesagt, die Madre Teresa sei eine Frau, … hingegen ist sie ein Mann, und zwar einer von den ganz Bärtigen“ (BMC 18,9; DST 1142).
Von 1562 bis zu ihrem Tod am 4. Oktober 1582 (am folgenden Tag tritt die Kalenderumstellung in Kraft, so dass wir den 15. Oktober als ihren Todestag benennen) nimmt Teresa unglaubliche Risiken und Strapazen auf sich, um bei sengender Hitze auf steinigen Pfaden im holprigen Eselskarren durch ganz Spanien zu ziehen, um neue Klöster zu gründen und bestehende immer wieder zur Erneuerung aufzurufen.
Am 15. August 1567 gründet sie einen Karmel in Medina del Campo. Am 11. April 1568 folgt die Gründung von Malagón und am 15. August desselben Jahres die von Valladolid. Als erster Frau gelingt ihr am 28. November 1568 die Gründung des ersten Männerklosters der „Reform“ in Duruelo: Die ersten Mönche sind Johannes vom Kreuz und Antonio de Heredia. Am 14. Mai 1569 öffnet das Kloster von Toledo seine Pforten; am 23. Juni desselben Jahres folgt Pastrana (wovon im Zusammenhang mit der Prinzessin von Éboli noch zu handeln sein wird!). Teresa gründet am 1. November 1570 in Salamanca und am 25. Januar 1571 das Kloster von Alba de Tormes (wo sie 1582 ihre letzte Ruhe finden wird).
Damalige Realität und heutige Sichtweisen
Welches aber waren die immer neuen Beweggründe für ein derartig schwieriges und aus heutiger Sicht merkwürdiges Unterfangen?
Teresas eigene schicksalhafte Konversion und Lebenswende durch die Begegnung mit jenem Bild des wundenüberdeckten Schmerzensmannes (1554) hatte den Ausschlag gegeben: Als Konsequenz glaubt sie – immer in geistlicher Zwiesprache mit ihrem Gott – Ihm Räume schaffen zu müssen, in denen ein intensives geistliches Leben in Armut und völliger Zurückgezogenheit möglich ist. Es geht ihr also um eine neue Qualität der Klöster als Nährboden und Ausgangspunkt für eine innere Erneuerung der im Verfall begriffenen Kirche Gottes. (Luthers Beitrag hierzu sollte auf völlig andere Weise erfolgen; beider Anliegen aber ähnelt sich in vielen Punkten!).
Dabei kann man Teresas zeitbedingte Klagen über „die armen Lutheraner und Ketzer, die verdammt sein werden“ (V 32,6) nur als das einordnen, was sie sind: Ausbrüche einer von dem Gedanken an die ewigen Höllenqualen gequälten Nonne, die – von ihren Beichtvätern über die in fernen Landen begangenen Gräueltaten aufgeschreckt – Gott selber um Abhilfe anfleht und ihr eigenes Leben in die Waagschale werfen will, um jene zu erretten.
Möglicherweise hat Teresa im Palast der Doña Luisa de la Cerda in Toledo, wo sie von Ende Dezember 1561 bis Juni 1562 weilte, von den Unruhen der Kalvinisten in Mittel- und Südfrankreich nach dem Edikt von Saint-Germain vom 17. Januar 1562 erfahren. Teresas zeit- und informationsbedingte einseitige Wertung der Lutheraner als Häretiker wird an verschiedenen Stellen ihres Werks deutlich.15 Sie bezeichnet sie mehrfach als „Verräter“. Ihr war zu Ohren gekommen, dass jene „unheilvolle Sekte“ (CE 1,2), die Christus „von Neuem ans Kreuz bringen“ wolle (a. a. O.) und ein „Feuer“ (CE/CV 3,1) entfachte, das „die Welt in Flammen“ setzte (CE/CV 1,5), die Sakramente, vor allem die Eucharistie abschaffte, Priester umbrachte und Kirchen zerstörte.16 Allerdings ist sie der Meinung – und damit steht sie damals fast allein da –, dass man „mit Waffengewalt einem so großen Übel nicht abhelfen“ könne (CE 3,1).
Immer wieder ist die Rede von „Irrtum“ und „Verblendung“, von in Frankreich begangenen „Verwüstungen durch diese Lutheraner und wie sehr diese unheilvolle Sekte immer mehr Anhänger gewinnen sollte“ (CE 1,2); und vor allem musste Teresas Seele bei dem Gedanken an „die dem Allerheiligsten angetanen „Beleidigungen“ (F 3,10) bis in alle Tiefen hinein erzittern.
Und so fordert sie zum Gebet für jene „armen Verirrten“ auf, versäumt es dabei aber nicht, kritisch zu unterscheiden zwischen dem „sektiererischen Inhalt jener Lehre“ und jenen, „die ihr verfallen“ zu sein scheinen.
„Das Bewusstsein, eine weitere Kirche (sie meint ihre eigenen Gründungen!) zu sehen, ist für mich ein besonderer Trost, wenn ich daran denke, wie viele (Kirchen) die Lutheraner uns wegnehmen. Ich weiß nicht, welche Prüfungen man im Gegenzug für ein solch großes Gut für die Christenheit fürchten sollte, mögen sie noch so groß sein. Auch wenn viele von uns es nicht wahrhaben wollen, dass Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, im Allerheiligsten Sakrament an vielen Orten zugegen ist, so sollte das für uns ein großer Trost sein“ (F 18,5).
Teresas Besorgnis verstärkt sich und weitet ihr Herz, als sie 1566 im Josefskloster zu Ávila Besuch erhält von P. Alonso Maldonado, einem Missionar aus Südamerika, der ihr Kunde bringt von den vielen Seelen, die dort verlorengingen, weil zu wenige Missionare vorhanden seien.17 Teresa ist z...