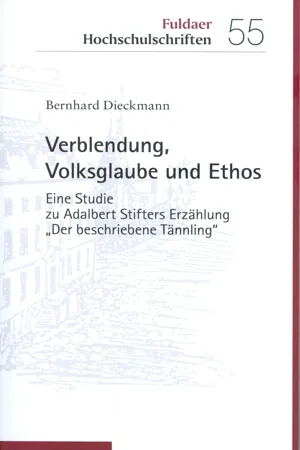![]()
1. Der Rahmen: Hanna und Hanns – Ehrgeiz und Dienen
Zusammen mit Guido sind Hanna und Hanns die einzigen Personen, die im Text namentlich genannt werden.10 Dazu werden je einmal Namen von Hannas Gefährtinnen (393,33–394,8) und von Jagdgenossen Guidos bzw. ihrer Diener (422,8–22) angeführt und die beiden so in soziale Zusammenhänge gestellt. Hanns hat zwar auch Gefährten, seine Arbeitskameraden, aber ihre Namen werden nicht genannt. Die Namensgleichheit Hanna/Hanns11 ist Hinweis, dass sie die Hauptfiguren der Erzählung sind. Um zu verstehen, wie sich im Scheitern ihrer Beziehung die Problematik ihrer Lebenseinstellung zeigt und entscheidet, ist es geraten, sich zuerst des Rahmens der Erzählung zu vergewissern, ihres Ausgangspunktes wie ihres Ergebnisses.
Für das Ergebnis hat Stifter am Ende der Erzählung ein einfaches Bild gefunden: Das Zusammentreffen Hannas mit Hanns, als sie „wieder einmal“ (431,33) ihre Heimat besucht. Sie wird in einer Kutsche gefahren und trifft unterwegs auf Hanns mit seinen (Pflege-)Kindern. In der Journalfassung wird bei diesem Zusammentreffen Hannas Reichtum und Unglück der Armut und dem kräftigen Leben – wenn nicht dem Glück – von Hanns gegenübergestellt: Hanna sitzt bleich und blass, „ein erloschenes Lichtlein“ in ihrer Kutsche (J 279,28). Hanns steht mit den sechs Kindern, für die allein er sorgt, am Weg; zwei Kinder zog er in einem „Wägelchen mit einem Dächlein darüber“ (J 279,31). Die Gesichter der Kinder sind „wie blühende Rosen“ (J 280,3). Die Buchfassung formuliert zurückhaltender. Es heißt nur noch, dass Hanna „bleich“ in ihrem Wagen sitzt (432,4–5).12 Hanns sorgt nur noch für drei Kinder – die seiner Schwester.13 „Er hatte sich an ein mit Leinwand überspanntes Wägelchen gespannt, in dem er die drei Kinder eben in seinen Holzschlag führte.“ (432,7–9) Dass er sie durch eine Leinwand vor Sonne und Regen schützt, macht augenfällig, wie liebevoll sich Hanns um sie sorgt. Hanna erkennt ihn nicht – wohl nicht allein aus Desinteresse: Sein Angesicht hat Furchen (432,7). Hanna schafft es nur, aus ihrem Reichtum ein belangloses, erniedrigendes Almosen abzugeben;14 sie will „dem armen Manne eine Wohlthat erweisen“ (432,11–12) und schenkt ihm einen Taler. Da der Weg in die Wälder, wo Hanns arbeitet, von Pichlern über Pernek ging (397,14–16), Hanna „auf dem Wege zwischen Pichlern und Pernek“ fuhr (432,1–2) und Hanns mit dem Wagen „auf dem Wege“ stand (432,7), kann man davon ausgehen, dass Hannas Kutsche Hanns mit seinem Wägelchen überholen wollte und er zur Seite treten musste. Das würde das Almosen Hannas weiter motivieren: Sie dankt dem armen Mann, dass er ihr Platz gemacht hat.
Aber Hanna wirft ihm das Geldstück nicht zu, sondern „aus ihrem Wagen auf die Erde“ (432,11). Hanns dagegen erkennt sie, er geht schon gebückt, weil er den Wagen mit den Kindern zieht; nun muss er sich noch tiefer bücken, um das Geld aufzuheben15 – ein Bild dafür, wie demütig und gelassen er inzwischen seine soziale Rolle akzeptiert. Es wird noch erzählt, dass er das Geldstück fassen ließ und als Votivgabe in der Wallfahrtskirche aufhing – vermutlich aus Dankbarkeit, dass ihn die schmerzhafte Jungfrau vor einem Mord bewahrt hat. Die Gegenüberstellung der beiden Wagen ist zu beachten: hier die Kutsche Hannas, dort das ärmliche „Wägelchen“ von Hanns. Hanna wird herrschaftlich gefahren; Hanns hat sich wie ein Zugpferd eingespannt, um seine Kinder zu ziehen. Hanna wird als Herrin bedient, Hanns dagegen dient, lebt in der Fürsorge für andere.16
Wenden wir uns dem Ausgangspunkt der Erzählung zu, so zeigt er zwei junge Leute, die beide ehrgeizig sind. Das erste Ereignis, das von Hanna erzählt wird, ist ihr Erstbeichttag. Ihre Gefährtinnen waren in feinen Kleidern erschienen, und ihre Haare waren gepudert, „damit sie schön wären, und in der festlich weißen Farbe da stünden. Nur Hanna’s Haare waren dunkel geblieben, weil ihre Mutter keinen Puder zu kaufen vermochte“ (392,25–27). Die anderen Mädchen trugen Kleider mit Reifröcken, Hannas Kleid dagegen war „grob“ (392,22), und die Mutter hatte „Puffchen“ (392,29) an das Unterkleid genäht, „daß das darüber angelegte Rökchen doch ein wenig wegstehe, und einen Reifrok mache“ (392,29–30).
Unter dieser Diskrepanz hat Hanna offensichtlich gelitten. Denn als ihre Gefährtinnen sie nach dem gerade erwähnten Gebet vor dem Gnadenbild fragen, worum sie gebetet hat, beschreibt sie das vornehme Kleid des Gnadenbildes und erzählt, dieses hätte ihr ebenso „sehr Schönes und sehr Ausgezeichnetes“ verheißen (394,11). Es besteht eine direkte Verbindung zwischen Hannas ärmlicher Kleidung an diesem Festtag und ihrer Behauptung, das Gnadenbild hätte ihr prachtvolle Kleider zugesagt. Nur wenn man diesen Zusammenhang übersieht, kann man von „Hannas rätselhaftem Wunsch in der Kapelle“ sprechen.17 Hanna stellt der demütigenden Erfahrung des Tages die Verheißung künftiger Größe entgegen.
Hannas Wunsch entspricht der Erziehung, die sie erfahren hat. Sie lebt in enger Gemeinschaft mit ihrer Mutter, die sie am Ende auch in das Schloss Guidos begleitet (390, 431–32). Über ihre Herkunft oder ihren Vater wird kein Wort verloren. Armut, Fleiß und Frömmigkeit der Mutter werden hervorgehoben, aber auch, dass sie – und Hanna mit ihr – in vielerlei Hinsicht auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen ist. Schon das Häuschen wurde ihnen aus „Mildthätigkeit [...] eingeräumt“ (390,10). Hanna ist schon als Kind auffallend schön. Sie war „immer“ im Haus (390,30); denn die Mutter hielt sie von den Menschen fern. Wenn sie einmal fortging, sperrte sie das Kind sogar ein. Als es älter geworden war, erschien es beim Spiel der Kinder im benachbarten Pichlern, „allein es stand nur immer da, und sah zu, entweder weil es nicht mitspielen durfte, oder weil es nicht mitspielen wollte“ (391,4–6). Die wenigen Bemerkungen über Hannas Jugend kann man als Geschichte einer falschen Erziehung lesen.18 Es sieht so aus, als hätte schon die Mutter Hanna wegen ihrer Schönheit bewundert und verwöhnt, als hätte sie Hanna angehalten, sich für etwas Besonderes zu halten und Anspruch auf die Bewunderung oder gar Bedienung durch die anderen zu haben. So ist denn Hanna auch aufgetreten; immer war sie sonntäglich gekleidet, hat nicht gearbeitet und auf Distanz zu den anderen geachtet, die sie auch mit ihrer großen Reinlichkeit betont.19 „Söhne reicher Bauern“ (395,30) warben um sie und hätten sie gerne geheiratet, aber sie war an ihnen nicht interessiert.20
Auch dass Hanna die Farbe Weiß zugeordnet wird, zeigt, dass sie etwas Besonderes ist oder sein will: „Sie hatte immer ein weißes leinenes Tüchlein um den Busen, auf welches ihre dunklen Augen hinab schauten, und ihre noch dunkleren Wimpern hinab zielten.“ (395,6–8) Zudem lebt sie in einem weißen Häuschen zwischen dem Kreuzberg und Pichlern (389). Aber „schneeweiß“ (384,29) sind auch die beiden „Brunnenhäuschen“ (385,19–20) sowie das „Gnadenkirchlein“ am Kreuzberg (385,12).21 Überhaupt ist Weiß die Farbe der Feste: Die Kinder tragen bei festlichen Anlässen weiße Kleider,22 die Perücken der Herren beim Jagdfest sind weiß bestäubt.23 Mit ihrer Liebe zur Farbe Weiß signalisiert Hanna, dass ihr Leben ein einziger Sonntag sein soll.
Hanns dagegen lebt und arbeitet im Kreis der anderen Holzfäller. Seine Eltern sind „längstens gestorben“ (403,6–7). Als lebende Verwandte werden nur seine Schwester in Pichlern (403,5; 423,5) und später ihre drei Kinder (431–432) erwähnt; er ist ein „vorzüglicher Arbeiter“ (400,31–32), weiß sich aber auch gegen seine Gefährten durchzusetzen und ist unter ihnen „wie ein König“ (400,28); er bewährt sich also als Holzfäller und bleibt dabei „ordentlich“ im Rahmen seines Berufes und Standes. Doch indem er um Hanna wirbt, ist Hanns auch ehrgeizig. Diese wird von jungen Männern aus allen sozialen Schichten der Gegend umworben. Wenn Hanns mit Hanna auf einem Tanzfest war, „wo sie Viele sehen konnten, und wenn nun der eine oder andere junge Mann mit seinen Augen schier nicht von ihr lassen konnte, und stundenlang sie mit denselben gleichsam verschlang, so hatte Hanns seine außerordentliche Freude darüber und triumphirte“ (403,10–14). Seine Freundschaft mit Hanna bedeutet für Hanns einen Sieg über seine Rivalen und verschafft ihm Anerkennung und Geltung. Er sucht einen Ausgleich dafür, dass er eher unansehnlich ist: „Er war nicht der Schönste unter Allen, ja er war vielleicht weniger schön, als alle Andern ...“ (396,5–6)
Den ganzen Ertrag seiner Arbeit bekommt Hanna, „daß sie nichts entbehre und ihren Leib schmüken könne“ (396,17–18). Wie ihre Mutter lebt Hanna von der Hilfe anderer – eben des Hanns. Er versucht dabei mit ganzem Einsatz, auf Hannas Ehrgeiz einzugehen. Am Schluss von Teil 2 häufen sich die Superlative. Hanns „that Alles, was ihm sein Herz einflößte“ (404,19–29), um ihre Wünsche zu erfüllen: Der „schönste Maibaum“ (404,30), das „schönste Tuch“ (404,31), „die schönste Schürze“ (404,31–32), der „größte Palmbaum“ (404,32), der „schönste Strauß“ (405,1) werden genannt. Dabei ist Hanns kaum klar, wie begrenzt seine Möglichkeiten sind. Denn Hannas Traum von schönen und kostbaren Kleidern sprengt den Rahmen ihrer ländlichen Umgebung. Wohl deshalb verweigert sie sich den Bewerbungen der reichen Bauernsöhne und deshalb kann auch ihre Beziehung zu Hanns nur vorläufig sein.24 Vom Volk als außenstehendem Beobachter wird das durchschaut: „ ‚Die wird Gott strafen, daß sie so stolz ist‘, sagten oft die Leute, ‚und ihn, daß er so verblendet ist, und ihr Alles anhängt.‘ “ (402,30–32) Ist das nur Kritik an den beiden oder verbirgt sich dahinter auch Missgunst des Volkes gegen Hanns?
Auf ihre ehrgeizigen Hoffnungen spricht Hanna ihren Freund auch einmal an – gewissermaßen durch die Blume –, als sie ihn in Teil 2 fragt, „um was er denn am ersten Beichttage [...] gebeten habe“ (403,25–26). Hanns antwortet: „Ich habe um nichts gebeten ...“ (403,27) Hanna tadelt ihn dafür, denn das Gnadenbild sei „sehr wunderthätig und stark, und was man am ersten Beichttage mit Inbrunst und Andacht verlangt, das muß in Erfüllung gehen, es geschehe auch, was da wolle“ (404,2–4). Mit dieser Frage hat Hanna auf subtile Weise den Vorbehalt in ihrem Verhältnis zu Hanns angesprochen. Eigentlich fragt sie ihn: Bist du auch so ehrgeizig wie ich? Kann ich von dir die Erfüllung meiner Wünsche erwarten? Die Bedeutung dieses Gesprächs25 wird zudem durch formale Besonderheiten hervorgehoben: Hanna spricht in direkter Rede, die sich im „Tännling“ nur selten findet, zugleich sind es die letzten Worte, die von ihr berichtet werden. Weiter ist zu beachten: Jedes Mal, wenn Hanna in direkter Rede spricht, beruft sie sich auf die Macht des Gnadenbildes (393–394, 403–404), jedes Mal verteidigt sie gegen kritische Anfragen ihr Vertrauen auf das Gnadenbild. Das zeigt, wie unbeugsam sie an ihrer Erwartung, ihrem Lebensentwurf festhält, und welches Gewicht das Gnadenbild für sie und damit für die Erzählung hat.
Für die Ökonomie der Erzählung hat dieses Gespräch zwischen Hanna und Hanns zentrale Bedeutung. Es verweist schon – wenn auch für Hanns nicht durchschaubar – auf Hannas spätere Untreue. Erzähltechnisch ist dieses Gespräch ein geschickter Kunstgriff; es sorgt für die Geschlossenheit der Erzählung. Denn für Hanns wird Hannas Insistieren auf der Macht des Gnadenbildes in der Krise, in die er durch ihre Untreue gerät, zum entscheidenden Anstoß, um diese Krise zu bewältigen. Wenn er vor dem Gnadenbild um das Gelingen seines Mordplans betet, folgt er Hannas Rat. Das Gespräch am Anfang bezieht sich also auf den Schluss der Erzählung, wenngleich in verdeckter Form.
Auch die Gemeinsamkeiten von Hanna und Hanns sind zu beachten. Beide gehören zum „Dorf Pichlern“.26 Das „weiße Häuschen“ (389,28–29), in dem Hanna mit ihrer Mutter lebt, liegt „einsam am Rande der Weide“ (390,3) zwischen dem Kreuzberg und Pichlern, und so zählt sie zu den Bewohnern dieses Dorfes (391,4; 395,14). Hanns arbeitet zwar im Wald, aber in Pichlern lebt seine Schwester (423,4–5, vgl. 403,5). Während der Arbeit im Wald unter der Woche wohnt Hanns mit den anderen Holzknechten in einer Hütte,27 die genau beschrieben wird.28 Eine Randbemerkung zeigt, dass auch andere Waldbewohner in Hütten leben (429,7). „Hütte“ ist das Wort für die Wohnstätte der Waldarbeiter und -bewohner. Zum Sonntag kehren die Holzfäller in ihre „Heimath“ zurück (401,29; 402,10–11), offenbar zu ihren Familien. So macht es auch Hanns, wenn er zu Hanna in ihrem „weißen Häuschen“ kommt. Dieses Häuschen wird häufig erwähnt – 27 Mal.29 Es ist der Ort des gemeinsamen Lebens von Hanna und Hanns. Hervorgehoben wird, dass Hanns sonntags bei Hanna ist; fast nebenbei wird erzählt, dass die beiden auch zum Tanzen gingen, „wo sie Viele sehen konnten“ (403,10). Nur seine Schlafstelle hat Hanns in Pichlern bei „den Leuten, wo seine Schwester war“ (403,5). Hanna und Hanns teilen also schon die Lebensformen der Holzfäller zwischen Arbeit im Wald unter der Woche und Sonntagsruhe bei den Angehörigen im Dorf.30
Von den Dörfern Pernek und Pichlern ist der „Marktfleken Oberplan“ zu unterscheiden (382,33).31 Oberplan ist der Hauptort der Gegend in der Mitte eines Tales. Der Kreuzberg mit seinen verschiedenen Stätten liegt als einzelne Erhebung im Tal, aber nicht in Oberplan selbst; vielmehr „gleich hinter“ ihm (383,5). Die Wege, die von ihm nach Oberplan führen, werden ausführlich beschrieben (385,387–388). Oberplan ist Sitz des Pfarrers (391,26; 408,21) und der Schule (408,25); es hat ein Rathaus (408,27–28) sowie ein Gericht.32 Terminologisch wird hervorgehoben: Die Oberplaner leben in „Häusern“.33 Es ist davon auszugehen, dass auch viele Dienstleute des Grundherren hier leben: „... die Forstmeister, Revierjäger, Heger und Holzmeister“ (408,18–19). Oberplan ist Zentrum des Jagdfestes in den umliegenden Wäldern34 und es ist – solange der Grundherr sich in der Gegend aufhält – seine provisorische Residenz (408,27–30; 420,13–14).
Öfters wird Vorderstift erwähnt, eine Örtlichkeit im Weichbild von Oberplan, ein Grenzort zum Wald hin. Der herrschaftliche Förster, „in dessen Reviere der erste Jagdplaz lag“ (408,23–24), lebt dort, und auch die Herrschaften übernachten vor der Netzjagd im dortigen „Jägerhause“ (409,17–18), um „dem Jagdschauplaze näher zu sein“ (409,18). Das festliche „Mittagsmahl“ (415,9) nach der Jagd findet vor diesem Hause statt. Ebenso lebt in Vorderstift der alte Schmied,35 der erst von der Netzjagd in seiner Jugend zu erzählen weiß (406,19–21) und am Schluss das letzte Wort hat, um die Geschichte von Hanna und Hanns autoritativ zu deuten (432,23–25).
Es w...