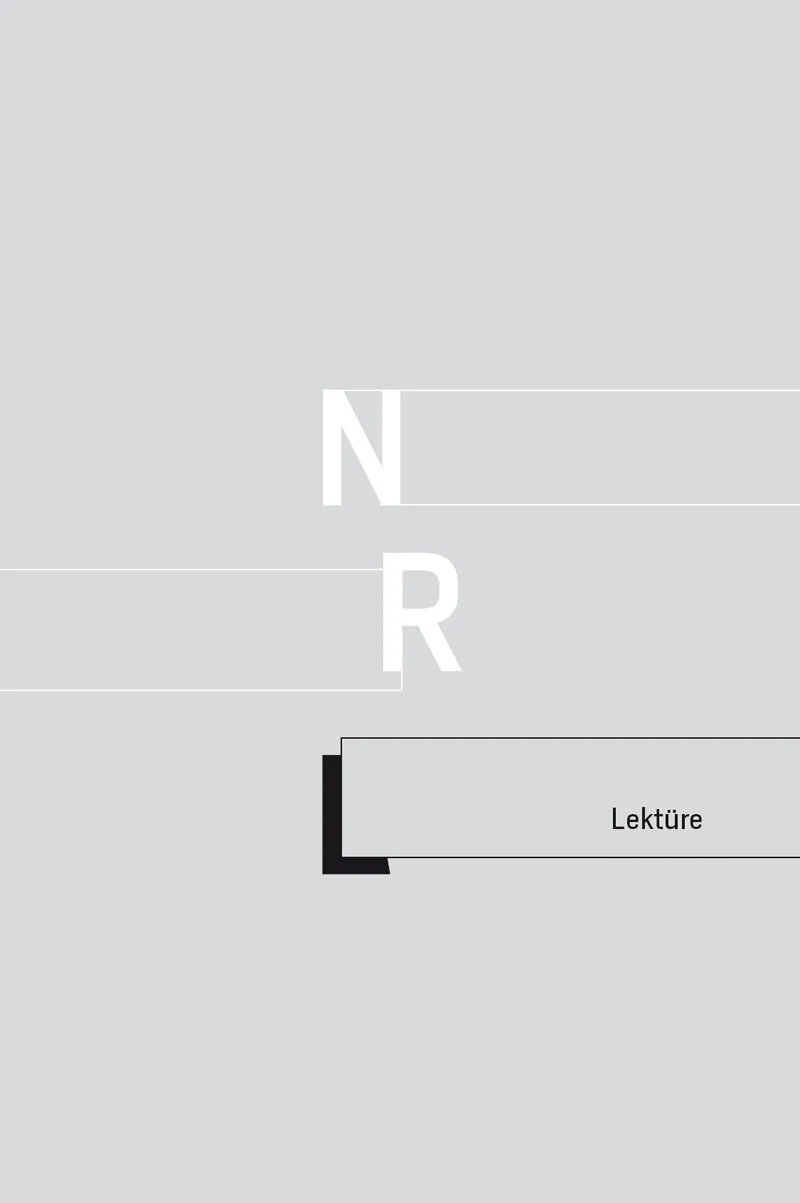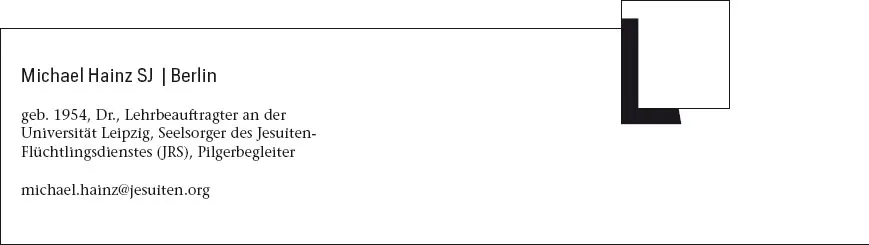![]()
![]()
„… dass ich in dich hineinlaufe in deine Gegenwart“1
Pilger-Literatur im Überblick
Zeitgenössischem Pilgern wohnt ein Zauber inne, der gleichermaßen religionsfreie, spirituell Suchende und kirchlich gebundene Menschen in Bann zieht. Rund 345.000 Pilger(innen) legten im Jahr 2019 die letzten 100 km zu Fuß oder die letzten 200 km mit dem Fahrrad oder Esel nach Santiago de Compostela zurück, 1970 waren es nur 68.2 Nach Schätzungen der Vereinten Nationen pilgern „jährlich 300 bis 350 Millionen Menschen weltweit zu religiösen Stätten“3. Der neuere Pilgerboom lässt sich auch an der europaweit feststellbaren Reaktivierung alter, z.B. der Jakobswege4, und an der Eröffnung vieler neuer Pilgerwege ablesen. So wurden in Österreich neben vielen anderen der Martinus-, Wolfgang-, Benedikt- und Stoakraftweg, die VIA NOVA, der Weg der Entschleunigung sowie, auf dem Pfad protestantischer Bibelschmuggler, der Weg des Buches errichtet. Erstaunlicher noch mutet an, dass mehrere evangelische Landeskirchen in Deutschland im Hinblick auf das Reformationsjubiläum 2017 einen Lutherweg mit einer Gesamtlänge von ungefähr 2.500 km initiierten5, obwohl der Reformator rund 250mal die Pilgerfahrten nach Santiago de Compostela, oft polemisch, im Stil des Grobianismus seiner Zeit, kritisiert hatte.6 Rasant ist auch die Zahl der Publikationen zum Pilgern gestiegen, im deutschsprachigen Raum von knapp einem Dutzend im Jahr 1990 auf mehr als 430 Titel im Jahr 2013.7
Angesichts einer solchen Fülle kann in diesem Beitrag nur ein sehr beschränkter, notwendig selektiver Einblick in die Pilgerliteratur gegeben werden. Er orientiert sich an folgenden Kriterien: Werden die Geschichte, Soziologie, Theologie, Spiritualität oder Praxis des Pilgerns solide behandelt? Kann die Publikation als Impulsgeber für eine Weise des Pilgerns dienen, das – im besten Falle – den ökumenischen und interreligiösen Austausch sowie die (politische) Versöhnung fördert und der Umkehr- und Erlösungsbotschaft des Christentums „zuarbeitet“?
Zur Geschichte des Pilgerns
Verpflichtende oder freiwillige Pilgerfahrten mit oft jahrtausendealten Traditionen lassen sich in allen Weltreligionen nachweisen. Gediegene Einblicke in die Pilgermotive, -formen und -praktiken der abrahamitischen Religionen8 gibt der Sammelband von Hafner, Talabardon und Vorpahl.9 Vorgestellt werden darin unter anderem für den Islam neben der bekannten großen Mekka-Pilgerfahrt (Haddsch) auch die eher persönlichen Pilgerweisen der ‘Umra und Ziyāra (183–195), und für das Judentum die Wallfahrtstraditionen des Alten Israels (11–39) und das chassidische Pilgern (151–182). Die wechselnden Motive des antiken christlichen Pilgerns in das erst nach Konstantin so benannte „Heilige Land“ erläutert Johann E. Hafner (65–85). Maßgeblich für das Ausmaß und die Ziele der Pilgerströme dorthin, nachweisbar ab 170 n.Chr., waren die sich wandelnden Deutungen Jerusalems bzw. des Tempels, die Kirchenbauten Kaiser Konstantins und die Pilgerfahrt seiner Mutter Helena sowie die Inkarnationstheologie.
Die Entwicklung des Pilgerns10 zu den Märtyrer- und Apostelgräbern in Rom (ab dem 4. Jh.) und des Heiligen- und Reliquienkultes muss man sich aus teilweise älteren Werken erschließen.11 Hilfreiche Übersichten über die Motive, Formen und äußeren Bedingungen des Pilgerns im Mittelalter bieten, namentlich am Beispiel von Santiago de Compostela, die einschlägigen Arbeiten des Historikers Klaus Herbers.12 Er geht bei den meisten Personen „meist eher“ von einem Mix geistlicher und weltlicher Pilgermotive aus. Unter ersteren seien „die Wunderhilfe und der Wunsch nach Selbstheiligung“ die wichtigsten gewesen, die seit dem 11. Jh. „ergänzt, aber nie gänzlich verdrängt“ worden seien durch die „Entwicklung der Ablässe“. Hinzu kamen die kirchlicher- und staatlicherseits verhängten „Buß-“ bzw. „Strafpilgerfahrten“ sowie das „Delegations-“ bzw. „Mietpilgern“ im Auftrag anderer Personen.13 Am Beispiel von Santiago de Compostela verdeutlicht Herbers, wie sich in den unterschiedlichen Überlieferungsschichten zum Jakobusgrab die jeweiligen Interessenlagen der Geistlichen von Santiago und der regionalen Herrscher widerspiegeln: Historisch ging es ihnen zunächst um die Gewinnung der kirchlichen Oberhohheit über die traditionellen Zentren Toledo, Braga und Mérida. Erst in einer zweiten Phase wurde der Heilige Jakobus als „Schutzherr“ und hernach als „aktiver Schlachtenhelfer“ im Kampf gegen die Muslime herausgestellt, bevor mit diesem Argument die jährlichen Abgaben von Getreide und Wein aus ganz Spanien an die Kirche von Santiago begründet wurden.14 Für den Rückgang des europaweiten Pilgerns seit dem 16. Jh. macht Herbers neben Reformation, Inquisition und der Regionalisierung der nun als „typisch katholisch“ propagierten Wallfahrten auch wirtschaftliche (Verarmung, Bandenwesen) und politische (Kriege, Französische Revolution) Faktoren geltend.15
Luther und das Pilgern
Kritik an der Notwendigkeit des Pilgerns, an Gefährdungen der Pilgernden durch Betrug, Diebstahl, Tod oder Unkeuschheit, an ihrem Mangel an innerer Disposition sowie an Ungereimtheiten mancher Pilgerziele begleitete das christliche Pilgern seit der Patristik in wechselnden Akzentuierungen, wie Daniel Vorpahl herausarbeitet.16 Die spätmittelalterliche Kritik richtete sich, oftmals wirkungslos, gegen den Aberglauben und die Unglaubwürdigkeit mancher Reliquien, sprach vielen Pilgernden die echte Motivation ab und schlug in ihrer zum Teil kategorischen Ablehnung des Pilgerns scharfe und mitunter bissige Töne an. Martin Luther, so Vorpahl, stehe erkennbar in dieser pilgerkritischen Tradition. Eine Gesamtanalyse der umfangreichen Aussagen Luthers zum Pilgern steht noch aus, doch kommt der norwegische Theologe und Pilgerpastor Roger Jensen nach einer gründlichen Auswertung von dessen Schriften zum Ergebnis, dass der Reformator eine „differenzierte“ Stellungnahme zum Pilgern abgegeben habe, die „im Zuge der Konfessionalisierung des Protestantismus verloren“ ging und „von der Lutherforschung weitgehend vernachlässigt“ wurde. Pilgern sei für Luther „eine Frage des rechten Gebrauchs“ gewesen, und er selbst habe ja auch Jesu Lebens- und Wirkungsstätten besuchen wollen.17 Protestantischerseits, so sein Fazit, sei also das Pilgern grundsätzlich erlaubt. Andere evangelische Autoren, wie Notger Slenczka und Detlef Lienau, teilen Jensens Urteil, und die drei Genannten bemühen sich um eine theologische Neubegründung des Pilgerns aus protestantischer Perspektive: Jensen schöpfungstheologisch und mit Motiven aus Luthers Kleinem Katechismus18, Slenczka mit Bezug auf das reformatorische Anliegen der Selbsterkenntnis19, und Lienau sogar mit einer differenzierten Rehabilitierung der Catholica „Tradition“, „Volksfrömmigkeit“, „Heilige“ und „Ablass“ sowie mit einer eschatologischen Ausrichtung der Identitätsarbeit der Pilgernden.20 Lienau krönt seine langjährige Pilgerforschung und -praxis zudem mit einer profilierten Einweisung in die kontemplative Dimension des Pilgerns.21 Peter Zimmerling wirbt für eine von den „vorreformatorischen Konfessionen“ zu lernende „Erweiterung der Formenvielfalt“ lutherischer Spiritualität: durch die Einbeziehung von „Leib und Seele“ und „Naturerfahrung“, die Offenheit für eine spirituelle Erlebnisorientierung und die Erfahrung von Gemeinschaft sowie die Momente der Stille und des Übens.22
Sozialwissenschaftliche Befunde
Für eine erste sozialwissenschaftliche Einordnung des Pilgerns empfehlen sich neben den Klassikern von Daniele Hervieu-Léger23, Zygmunt Bauman24 und Victor Turner25 sowie der Literaturübersicht von Detlef Lienau26 die Beiträge von Michael Ebertz, Markus Gamper und Julia Reuter: Ebertz stellt die Typen des „alten“, mittelalterlichen Pilgers und des „neuen“ Pilgers gegenüber. Ersterer lasse sich anhand seines „festen, kirchlich weitgehend kontrollierten und auch gesamtgesellschaftlich legitimierten Formats“ kennzeichnen. Der zeitgenössische Pilger hingegen sei in der Regel individualisiert, informalisiert, weitgehend entkirchlicht, „nicht mehr fromm, vielleicht auch nicht mehr religiös, sondern spirituell“ im Sinne einer „Offenheit und Öffnung des Menschen für das Geheimnis über und hinter seinem – rational nicht verrechenbaren – Leben“. Er kompensiere das Fehlen oder Unterlaufen eines „dogmatischen Kerns“ durch den „Stellenwert der Erfahrungsdimension“ und die Haltung des Suchens.27 Gamper und Reuter untersuchen die sozialdemographische Zusammensetzung und die Motive von Pilger(inne)n auf dem spanischen Camino.28 In einem Teilprojekt beschreiben sie die von katholischen Theolog(inn)en mitunter verwischte29 Differenz zwischen den Profilen von Pilger(inne)n und Wallfahrer(inne)n.30 Im Vergleich zu Heilig-Rock-Wallfahrer(inne)n sind Camino-Pilger(innen) demnach jünger, höher gebildet, haben einen paritätischen, also höheren Frauenanteil und bezeichnen sich häufiger als „spirituell“ denn als „religiös“, aber nicht als ablehnend gegenüber der Kirche. Bei ihnen nehmen die Motive „Zu sich selbst finden“, „Ausklinken aus dem Alltag“ und „Stille genießen“ die ersten Plätze ein, während Wallfahrer(innen) stärker zielorientiert sind („Den Heiligen Rock sehen“).
Gründliche soziologische Analysen liefern Rainer Schützeichel und Christian Kurrat: Schützeichel31 versteht Pilgern sozialtheoretisch als Handlungsformat, das bestimmte Regeln aufweist. Es sei einer „Schwellen- oder Umwandlungsphase“ zuzuordnen und stehe den Eigenschaften des Alltagslebens diametral gegenüber. Auch eigne ihm eine spontan-brüderliche und mi...