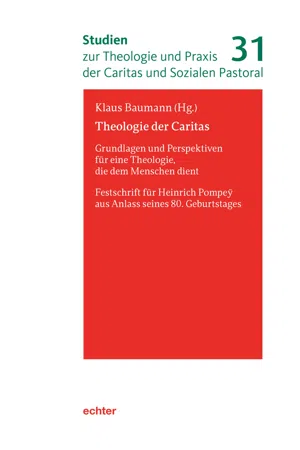![]()
Praktisch-theologische Grundlagen und Perspektiven
![]()
Zur Theo-logik der christlichen Sozialethik
Ursula Nothelle-Wildfeuer
Prolog: Ein originär christlicher Beitrag? Oder: Fabrik bauen statt Mantel teilen?
Selten war ein Grundlagenthema christlicher Sozialethik so aktuell wie das, das der Jubilar mir für das heutige Symposium zugedacht hat:
Da streiten sich auf politisch-gesellschaftlicher Ebene Bayerns Finanzminister Markus Söder und die Bischöfe Marx und Ackermann – mit Recht – um die Zuständigkeit von Staat und Kirche angesichts kirchlicher Kritik an der CSU Flüchtlingspolitik, denn nach Söder sei die DNA des Christentums – die Barmherzigkeit – eben Sache der Kirche, nicht des Staates.
Da formuliert im wissenschaftlichen Diskurs der in Rom lehrende Sozialethiker Martin Rhonheimer in seinem kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung erschienenen Artikel zum wiederholten Mal seine These, dass „der Anspruch der katholischen Soziallehre (wenig stichhaltig erscheint), ein originär christlicher Beitrag zu Fragen einer gerechten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu sein.“1 Diese These impliziert Kritik sowohl an der Tradition der kirchlichen Sozialverkündigung als auch an jeder Sozialethik, die mit Bezug auf die Grundlinien dieser Tradition argumentiert. Der Staat könne nicht barmherzig sein - wie übrigens auch der Markt mit sozialer Gerechtigkeit nichts zu tun habe. Beides hält er für schwerwiegende Kategorienfehler. Was dann allerdings das Proprium einer christlichen Sozialethik ist, bleibt in seinem Beitrag offen.
Eine alte Debatte in neuem Gewand, so könnte man meinen, denn schon Oswald von Nell-Breuning, Ludwig Adolph Geck, Joseph Höffner und Gustav Ermecke, aber auch Johannes Messner und Nikolaus Monzel, allesamt einflussreiche Soziallehrer im 20. Jahrhundert, haben sich in durchaus unterschiedlicher und kontroverser Weise an dieser Frage nach der Bestimmung des Gemeinten als Sozialphilosophie und/oder Sozialtheologie abgearbeitet2 (wobei hier bei Rhonheimer auch von einer Sozialphilosophie nicht mehr die Rede sein kann).
Auch in der jüngeren Vergangenheit gab es zu dieser Frage nach dem theologischen Proprium der Soziallehre und Sozialethik interessante Positionierungen. So sei hier verwiesen auf die des Wirtschaftsethikers Karl Homann, der für die christliche Sozialethik große Bedeutung gewonnen hat: Er setzt an mit der uns allen wohlbekannten Legende vom heiligen Martin. Der römische Soldat begegnet im Vorüberreiten einem Bettler, der am Wegesrand sitzt und im tiefen Schnee und bei bitterer Kälte zu erfrieren droht; Martin hält sein Pferd an, teilt ohne zu Zögern seinen Mantel und gibt dem Bettler die Hälfte. - Nach wie vor ein Beispiel, wenn nicht das bekannteste Beispiel gelungener Mitmenschlichkeit und wahrer christlicher Nächstenliebe.
Diese Wertung scheint aber dem Urteil strenger moderner Ökonomik nicht mehr standhalten zu können: Denn, so kritisiert Homann, das sei eine vormoderne, also der Moderne nicht mehr angemessene Haltung und Handlung: „Vermutlich haben dann beide gefroren, weil der Heilige Martin den Mangel nur gleich verteilt, nicht aber beseitigt hatte. Unter Bedingungen der modernen Marktwirtschaft hätte er eine Mantelfabrik gebaut, dem Bettler und anderen Bettlern Arbeit gegeben, damit diese sich die Mäntel selbst kaufen könnten. Und er hätte dabei sogar selbst noch Gewinn erzielt.“3
Abgesehen von der nicht ganz unwichtigen Nachfrage, ob der Bettler das Warten bis zur Fertigstellung der Fabrik und zum Kauf des Mantels vom selbst verdienten Geld überhaupt überlebt hätte, wirft diese Aussage moderner Ökonomik sehr grundsätzliche Fragen auf: Hat eine genuin christliche, theologisch gegründete Sozialethik bzw. Gesellschaftslehre heutzutage überhaupt noch einen adäquaten Beitrag zu leisten zu einem Konzept der Bekämpfung von Armut - in unserer Gesellschaft wie auch weltweit? Und wenn ja, worin könnte dieser Beitrag bestehen? Oder ist eine christliche Ethik mit ihren entscheidenden Grundelementen gar nicht mehr kompatibel mit den ökonomischen und sozialen Herausforderungen moderner Gesellschaften und darum dann zumindest überflüssig, wenn nicht sogar kontraproduktiv? Oder noch einmal grundlegender: Gibt es überhaupt einen genuin theologischen Zugang zur Sozialethik?
Ist man aber der Auffassung, dass christliche Sozialethik auch heute noch einen Sinn hat und dass es auch eine Theo-logik dieser christlichen Sozialethik gibt, dann muss sich genau dieser theologische Charakter auch plausibilisieren und differenziert entfalten lassen. Dies soll im Folgenden in drei Schritten geschehen:
1. Das Wer der christlichen Soziallehre – Die Kirche als Adressatin und Akteurin ihrer Soziallehre
Es ist Papst Johannes XXIII. gewesen, der in seiner ersten Sozialenzyklika Mater et magistra (Nr. 6) einen neuen Akzent in die Sozialverkündigung setzte, indem er expressis verbis von einem doppelten Auftrag der Liebe, nämlich der sozialen Lehre und der sozialen Tat, sprach. Die Rede von der sozialen Lehre überrascht nicht. Neu aber war in dem Kontext der Verweis auf die „soziale Tat“, hier wird schon die Kirche – und nicht nur die einzelnen Christen – als Akteurin in Sachen der sozialen Frage apostrophiert. Papst Franziskus ist es nun, der inhaltlich genau dies als Auftrag und Anspruch zur Selbstvergewisserung sowie als Maßstab zur dauernden Reform der Kirche ins Stammbuch geschrieben hat. Die Theo-logik der Sozialethik hat also als erstes damit zu tun, dass die Kirche als Verkünderin dieser Soziallehre selbst in besonderer Weise für ihr Handeln auf die Fundamente ihrer Soziallehre verwiesen wird. Sie ist damit in neuer Weise in ihrer Authentizität gefordert!
Papst Franziskus hat in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium, das Bernd Hagenkord als „Programmschrift zur Kirchenreform“4 bezeichnet, eben diesen Auftrag an die Kirche für die heutige Zeit deutlich und konkret reformuliert. Mit Bezug auf die Debatte um das viel zitierte und intensiv diskutierte Wort aus Evangelii gaudium: „Diese Wirtschaft tötet“ (53), um das es uns hier nicht näher inhaltlich gehen soll, betont der Wirtschaftsethiker Ingo Pies sicher zu Recht, dass es notwendig gälte, sich der angemessenen Hermeneutik zu vergewissern und zu bedienen: „Bei diesem Text [sc. Evangelii gaudium. Anm. U. N.-W.] hat man es nicht mit einem kirchlichen Beitrag zum allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs zu tun. Stattdessen handelt es sich um eine päpstliche Verlautbarung zur Binnenkommunikation der Katholischen Kirche.“5 Bereits an der Anrede, aber auch am Gesamtduktus des Textes, lässt sich dies deutlich erkennen. Allem übergeordnet ist die Intention des Papstes, „die Christgläubigen […] zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude geprägt ist, und […] Wege für den Lauf der Kirche in den kommenden Jahren aufzuzeigen“ (EG 1). Der Papst hat also wesentlich die Kirche und ihr authentisches Handeln in dieser Welt und Gesellschaft im Blick, die er als eine „Kirche im Aufbruch“ (EG 20) versteht.
Kirche im Aufbruch ist, so betonte bereits Kardinal Bergoglio im Vorkonklave, „aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen und an die Ränder zu gehen. Nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends.“6 Eine Kirche im Aufbruch kreise nicht um sich selbst, lebe nicht für sich selbst und beanspruche Jesus nicht für sich selbst, sondern lasse ihn nach außen treten. Damit aber – so auch das, was in seinen Aussagen immer wieder anklingt – gibt sie gerade nicht sich selber auf, sondern kommt im Hinausgehen zu sich selber, d.h. zu Jesus Christus und seiner Botschaft.
Dies erweist sich als Gegenbewegung zu einer Tendenz, die gegenwärtig auch immer wieder erkennbar ist: Angesichts des weit verbreiteten Bedeutungsverlustes der Kirche vor allem in den westlichen Gesellschaften, angesichts des offenkundig unaufhaltsamen Autoritäts- und Vertrauensverlusts der Kirche sowie vor dem Hintergrund der Gleichgültigkeit der Kirche und ihren Einrichtungen gegenüber sei es das Beste, in Nischen am Rande der Gesellschaft als kleine Herde und als heiliger Rest zu „überwintern“ in der Hoffnung, dass irgendwann wieder bessere Zeiten für die Kirche und ihre Wahrheit kommen müssten. In deutlichem Unterschied zu einer solchen Kirche, die sich abschottet, spricht Papst Franziskus von „eine[r] ‚verbeulte[n]‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, [die ihm] lieber [ist], als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.“ (EG 49)
Die existentielle Ernsthaftigkeit, mit der der Papst diese Forderung nach der Authentizität der Kirche vertritt, muss auch dort aufhorchen lassen, wo man in vermeintlich einfacher Übernahme und Anerkennung ökonomischer oder gesellschaftlicher Gesetzmäßigkeiten dachte, zu einem christlich verantwortbaren Ergebnis zu kommen.
2. Das Warum der Soziallehre. Genuin theologische Begründungslinien
Gesellschaftlich-politische Diakonie ist, so betont es Benedikt XVI. in Deus caritas est, nicht einfachhin als Sozialarbeit oder Wohlfahrtsaktivität zu verstehen, die getrost auch anderen Akteuren zu überlassen wäre (vgl. DcE 25), sondern ist immer auch der Kirche als ganzer zuzurechnen, ist zu verstehen als das Bemühen darum, das Heil, das Christus den Menschen gebracht hat, unter den Bedingungen der Moderne in die vielfältigen und komplexen Verhältnisse der Menschen hinein zu buchstabieren und erfahrbar zu machen. Vor diesem Hintergrund ist dann die Soziallehre bzw. die Sozialethik auch notwendig im theologischen Kontext zu verorten.
2.1 Soteriologische Begründungslinie: Das umfassende Heil
Immer wieder gab und gibt es außerhalb und innerhalb der Kirche Stimmen, die die Kirche auf die Konzentration auf das Eigentliche, auf das „Kerngeschäft“ verweisen wollen und damit dann ausschließlich Liturgia und Martyria – auszuführen im Binnenraum der Kirche – im Blick haben. Doch hält sich als ein zentrales Motiv von den Anfängen katholisch-sozialen Denkens an als Fundament auch die Überzeugung von der untrennbaren Zusammengehörigkeit von Glaube und Leben:
Der „fromme Glaube genügt aber nicht in dieser Zeit, er muss seine Wahrheit durch Taten beweisen!“7 Ein einfacher und doch so fundamentaler Satz aus der ersten Adventspredigt des Mainzer Bischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler aus dem Jahr 1848, der geeignet ist, das „Programm“ des Sozialbischofs zusammenzufassen. Für ihn bezieht sich diese Rede von den notwendigen Taten auf all das, was er als Aufgabe der Kirche im Blick auf die soziale Frage des 19. Jahrhunderts erkannt hat und was weit über die bis dahin üblichen Wege der Pastoral (Ketteler spricht von Pastoration) hinausreicht. Dass die soziale Frage das „depositum fidei“ berühre, bringt Ketteler auch in dem bekannten Satz aus seinem Buch „Die Arbeiterfrage und das Christentum“ von 1864 zum Ausdruck: „Christus ist nicht nur dadurch der Heiland der Wel...